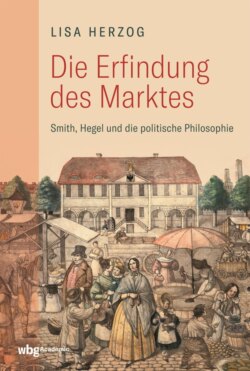Читать книгу Die Erfindung des Marktes - Lisa Herzog - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2 Ein post-Skinnerscher Ansatz
ОглавлениеDiese Untersuchung überschreitet bewusst die Grenzen mehrerer Fachgebiete. Ihr Gegenstand, der Markt, ist den Wirtschaftswissenschaften entnommen. Wie bereits erwähnt, nähert sie sich ihm allerdings auf philosophische Weise, und hat daher mit der Ökonomie, wie sie heute praktiziert wird, wenig gemeinsam. Sie beschäftigt sich mit historischen Denkern, was traditionell die Domäne der Ideengeschichte ist. Indem sie das Denken dieser Philosophen zu Themen wie Identität, Verdienst oder Autonomie in Beziehung setzt, verortet sie sich innerhalb der politischen Philosophie. Ein solcher Ansatz kann äußerst fruchtbar sein. Er birgt jedoch auch einige Fallstricke und macht es erforderlich, seine methodischen Grundlagen explizit zu machen.
Die Gefahren, die auftreten, wenn man historische Autorinnen mit dem Ziel liest, etwas für zeitgenössische Fragestellungen zu lernen, hat Quentin Skinner in seinem berühmten Aufsatz über die Methodik der Ideengeschichte aus dem Jahr 1969 deutlich umrissen. Skinner behauptete, dass wir die Absichten hinter den Worten nicht verstehen könnten, wenn wir Texte aus ihrem Kontext rissen, und daher keinen Zugang zum Sinn des Gesagten bekämen.34
Anstatt bei der Bearbeitung gegenwärtiger Probleme auf historische Autoren zurückzugreifen, „müssen wir lernen, unser eigenes Denken für uns selbst zu vollziehen“, so Skinner.35 Die „Cambridge School“, die sich aus diesem Ansatz entwickelt hat, hat unschätzbare Beiträge zu unserem Verständnis der historischen Zusammenhänge geleistet, in denen viele „klassische“ Denker gelebt und geschrieben haben. Doch diese Errungenschaften anzuerkennen bedeutet nicht, dass man sich bei der Lektüre historischer Autorinnen auf einen kontextualistischen Ansatz beschränken muss.
Man kann sich die verschiedenen Möglichkeiten, wie man einen historischen Text lesen kann, anhand eines Spektrums vorstellen, das von rein „historischen“ bis hin zu rein „systematischen“ Interpretationen reicht. Am einen Ende findet man Deutungen, die sich einem Text ausschließlich im Kontext seiner eigenen Zeit nähern. Sie versuchen, die ursprüngliche Stimme des Autors zu rekonstruieren, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, was er oder sie „wirklich“ gemeint hat, verbinden diese Erkenntnisse jedoch nicht mit systematischen Fragen. Am anderen Ende stehen Lesarten, die den historischen Kontext überhaupt nicht berücksichtigen: entweder auf unbewusste, naive Weise, oder in der bewussten Entscheidung, die Suche nach dem „ursprünglichen Sinn“ aufzugeben, um mit den Texten zu machen, was man möchte.36 Diese beiden Extreme haben eine monologische Struktur: Im einen Fall ist das Ideal, die Stimme der historischen Autorin zu rekonstruieren; im anderen Fall unternimmt der zeitgenössische Interpret keinen ernsthaften Versuch, die historische Autorin zu verstehen, und muss sich daher den Vorwurf gefallen lassen, dass er lediglich seine eigenen Ideen auf den Text projiziere und ihn als „Resonanzboden für die gerade vorherrschenden Anliegen eines bestimmten Fachgebiets“37 benutze.
Es gibt jedoch auch einen Mittelweg, bei dem das Ideal nicht ein Monolog, sondern ein „Dialog über historische Zeiträume hinweg“38 ist. Dieser Ansatz geht davon aus, dass es zumindest einige Begriffe, die wir verstehen, und einige Werte, die wir teilen können, gibt, und das über die Jahrhunderte hinweg. Das Hauptinteresse gilt hier den philosophischen Ideen, nicht den historischen Entwicklungen oder Kontexten. Auf diese Weise nähere ich mich in der vorliegenden Untersuchung Smith und Hegel: Ich konzentriere mich darauf, ihre Aussagen über die Rolle des Marktes in der modernen Gesellschaft, sowie die Argumente, die sie für diese Aussagen vorbringen, zu verstehen. Dabei stütze ich mich auf eine Reihe von Werten und Annahmen, die wir heute nachvollziehen können, auch wenn wir sie vielleicht nicht alle teilen. Dies bedeutet, dass ich versuche, ihre philosophischen Positionen so überzeugend wie möglich darzustellen, allerdings auch auf Spannungen und Schwächen in ihren Darstellungen zu achten, genau wie man es mit gegenwärtigen Fachkolleginnen tun würde. Dieser Ansatz nimmt die historischen Autoren als Denker ernst, die in einem weiteren intellektuellen Kontext als lediglich den historischen Umständen ihrer unmittelbaren Gegenwart schrieben, und die auf Argumente von Platon und Aristoteles ebenso eingingen wie auf diejenigen ihrer Zeitgenossen. Smith und Hegel, und mit ihnen viele historische Autoren, schrieben nicht nur, weil sie die aktuellen Ereignisse kommentieren wollten, sondern auch, weil sie etwas zu grundlegenden Problemen der politischen Philosophie zu sagen hatten. Aus diesem Grund schrieben sie lange Abhandlungen und nicht politische Pamphlete. Und deshalb sahen sie sich auch berechtigt, in einen Dialog mit jenen Denkern einzutreten, die in der Geschichte des politischen Denkens vor ihnen das Gleiche getan hatten. Würde man sie ausschließlich im Kontext ihrer Zeit lesen, würde man ironischerweise ihre eigenen Absichten missachten.
Diese Vorgehensweise bietet die Möglichkeit, etwas zu lernen, das für unsere eigenen Fragen relevant ist, und dabei gleichzeitig neue Erkenntnisse zu gewinnen, indem wir wirklich die Stimme eines anderen hören, nicht nur das Echo unserer eigenen Stimme. Um die historischen Texte so genau wie möglich zu verstehen, ist es unerlässlich, sich den historischen Kontext einigermaßen klar zu machen, selbst dann, wenn das Hauptinteresse philosophischen Aussagen und Argumenten gilt. Doch es liegen bereits zahlreiche kontextualistische Forschungsarbeiten über Smith und Hegel vor: Wenn man sich auf diese stützt, verringert sich die Gefahr, lediglich die eigenen Anliegen in ihre Werke hineinzulesen.39 Darüber hinaus wird die Herausforderung, die von Smith und Hegel verwendeten Begriffe zueinander und zu unseren heutigen Vorstellungen in Beziehung zu setzen, dadurch leichter bewältigbar, dass sich für bestimmte Schlüsselbegriffe, wie zum Beispiel „Staat“40, bereits zu ihrer Zeit eine einheitliche Verwendung etabliert hatte. Die von Waszek analysierte Rezeption von Smiths Denken durch Hegel zeigt, dass sie über die gleichen Phänomene sprechen. Sie in einen Dialog miteinander zu bringen, ist daher in gewisser Weise weniger anachronistisch, als sie so zu behandeln, als gehörten sie völlig verschiedenen geistigen Welten an. Die größten Unterschiede zwischen ihren, sowie zwischen ihren und unseren, Auffassungen liegen nicht in der unterschiedlichen Verwendung bestimmter Begriffe, sondern in den metaphysischen Grundannahmen: in Smiths Deismus und Hegels Metaphysik des Geistes. Im Verlauf der Untersuchung werde ich die Konsequenzen dieser Grundannahmen für ihre Vorstellungen vom Markt und vom Wesen der Gesellschaft im Allgemeinen herausarbeiten.
Was die Fragestellungen und Themen betrifft, zu denen ich Smith und Hegel befrage, so war dieser Prozess tatsächlich eine Art Dialog: Ich trat mit einer Reihe von Fragen an ihre Texte heran, und während einige von ihnen sich als fruchtbar erwiesen, erwiesen sich andere als uninteressant. Doch bei der Lektüre ihrer Texte tauchten neue Themen auf und es erschlossen sich gänzlich neue Sichtweisen auf Aspekte ihres Denkens, die ich für unumstritten gehalten hatte. Durch die Analyse von Smiths und Hegels Verständnis des Marktes trat ich eine philosophische Reise an, die einige überraschende Wendungen nahm. Es war ein zirkulärer Prozess zwischen der Suche nach Antworten auf meine eigenen Fragen in ihren Texten, dem Versuch, den Fragen, die sie sich stellten, nachzuforschen, und der Frage, warum sie sich in bestimmten Fragen unterschieden – ein Prozess, der heutigen philosophischen Diskussionen zwischen Menschen mit unterschiedlichem Hintergründen sehr ähnlich ist. Die interessantesten Momente sind dabei oft diejenigen, in denen man versteht, warum jemand eine Position vertritt, die auf den ersten Blick seltsam und unlogisch erschien.
Diese Art des Dialogs mit historischen Autoren besitzt eine emanzipatorische Kraft: Sie kann Annahmen ans Licht bringen, die man unkritisch aus der Tradition übernommen hat, und einem so eine bewusste Wahl ermöglichen. Dies liegt wieder auf einer Linie mit Quentin Skinner, der schreibt:
Einer der Beiträge, die Historiker leisten können, besteht darin, uns eine Art Exorzismus anzubieten. […] Ein Verständnis der Vergangenheit kann uns helfen zu erkennen, inwieweit die Werte, die durch unsere gegenwärtige Lebensweise sowie durch unsere gegenwärtige Art, über diese Werte zu denken, verkörpert werden, eine Reihe von Entscheidungen widerspiegeln, die zu verschiedenen Zeiten zwischen verschiedenen möglichen Welten getroffen wurden […]. Ausgestattet mit einem umfassenderen Verständnis für das Mögliche können wir von den intellektuellen Verpflichtungen, die wir ererbt haben, Abstand gewinnen und uns in einem neuen Forschergeist fragen, welche von ihnen wir beibehalten sollten.41