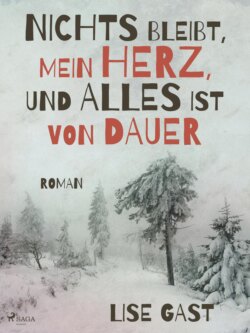Читать книгу Nichts bleibt, mein Herz, und alles ist von Dauer - Lise Gast - Страница 5
2
ОглавлениеDer lustige Sachse
1905
Wieder war es Sommer, und der Vater machte mit Regine Ferien in Südtirol. Sie hatten einen langen Wandertag hinter sich. Regine kam die Treppe herunter und stieß die Tür zu dem kleinen Schankraum auf. Ach, wie gemütlich! Niedere Decke und blank gescheuerte Tische; ein Beisl nannte man das wohl. Ihr Vater saß am Fenster und las die Zeitung.
»Hast du schon etwas bestellt?« fragte Regine und setzte sich zu ihm. Er nickte. Regine war so herrlich müde, wie durchmassiert von diesem Wandertag, aber nicht schläfrig. Gerade kam die Suppe.
»Heiß. Verbrenn dich nicht, Väterchen«, warnte sie und nahm den Löffel auf. »Was meinst du, ob wir den lustigen Sachsen morgen wieder treffen?«
Der ›lustige Sachse‹ war heute der Dritte im Bunde gewesen. Er wanderte allein. Der Vater hatte ihn nach dem Weg gefragt, den sie gehen wollten. Da hatte er sich ihnen angeschlossen.
Er war älter als Regine, sah gut aus und sprach sein Sächsisch sehr mild, sozusagen ein höfisches Sächsisch. Während sie wanderten, erzählte er von einer Aufführung der ›Fledermaus‹ in Leipzig, und Regine lachte und sagte, ein Stück aus dieser Operette sei ihr Lieblingsstück auf der Spieluhr. Sie kannte nur das, wann wäre sie je ins Theater oder gar in eine Operette gekommen!
Der lustige Sachse sang ihr sogleich vor, was sie am liebsten hatte: »Mein Herr Marquis, ein Mann wie Sie müßte das besser verstehen ...«
Ihr Vater war so unmusikalisch wie ein Krokodil, auch Regine war nicht sehr begabt für Musik. Aber sie liebte Musik. Mittags waren sie zusammen eingekehrt, hatten gegessen und Tiroler Rotwein getrunken. Der Wanderkamerad hatte sich inzwischen vorgestellt: Dr. Geist aus Leipzig, am Bibliographischen Institut tätig. Nach dem Essen gingen sie zu dritt wieder los.
Jetzt durchfuhr Regine ein kleiner angenehmer Schreck, als die Tür aufging und Dr. Geist hereinkam, sich umsah, sie und ihren Vater am Fenster erblickte und daraufhin die Tür leise hinter sich zuzog. Er trat an ihren Tisch. Der Vater sah auf.
»Wie nett. Setzen Sie sich doch zu uns«, sagte er.
Regine freute sich darüber. Ihr Vater war manchmal etwas schwierig in bezug auf Leute, die er nicht kannte. Siehe Dempes. Dr. Geist aber schien er zu mögen.
So nahmen die Dinge ihren Lauf. Am nächsten Morgen setzte man sich schon wie zusammengehörig an einen Tisch, und Regine konnte vor Aufregung kaum schlucken. Dr. Geist fragte nach ihren Wanderplänen und meinte, er könne den seinen dem ihren vielleicht anpassen, wenn es ihnen recht sei. Regine wandelte wie auf Wolken.
›Ich bin meinem Schicksal begegnet‹, dachte sie im Stil der damaligen Romane, und wenn man es recht betrachtete, so war sie das auch. Diesmal sang Dr. Geist nicht Melodien aus der ›Fledermaus‹, sondern erzählte, von Regines Vater freundlich aufgefordert, von sich.
Er lebte in Leipzig, war aber nicht dort geboren, sondern in Hosterwitz an der Elbe, wo sein Vater Pfarrer war. Diesem zuliebe hatte er zuerst Theologie studiert, seine Examina gemacht, hatte seine Probepredigten gehalten und dann eine Unterredung mit seinem Vater geführt, in der er ihn wissen ließ, daß er nicht Pfarrer werden wolle. Das kränkte seine Eltern tief, da sie einer langen Ahnenreihe von Pastoren entstammten und es als selbstverständlich angenommen hatten, daß Martin die Tradition fortsetzen würde. Er teilte ihnen mit, daß er sich für die Philologie entschieden habe, aber nicht Lehrer werden wolle, sondern ins Bibliographische Institut eintreten würde.
Martin hatte drei Geschwister, er war der Älteste. Eine Schwester war mit einem Landschaftsgärtner verheiratet, der auf der Insel Mainau lebte und genau gesagt – aber Dr. Geist drückte sich bescheiden und sehr vorsichtig aus – die Mainau gestaltete und umgestaltete. Regine mußte sofort an ihr geliebtes Buch Ekkehard denken. Die andere Schwester hatte die Tradition gewahrt und einen Pastor in Sachsen geheiratet, der aus erster Ehe einen Sohn hatte, für den er eine zweite Mutter suchte. Der jüngste Bruder wollte später die Forstkarriere einschlagen und sollte Güterdirektor beim König von Sachsen in Sibyllenort werden. Jetzt war er noch im Studium.
Dies alles erzählte Dr. Geist nach und nach auf Vaters freundliche Fragen hin, und Regine lauschte mit klopfendem Herzen. Sie versuchte herauszubekommen, wie lange sie noch gemeinsam wandern würden, konnte abends nicht einschlafen und heulte vor Glück und Angst um dieses Glück, kurz, sie benahm sich, wie man sich benimmt, wenn man das erste Mal richtig verliebt ist. Als dann der Abschied kam – Dr. Geist mußte seinen Urlaub früher beenden –, feierten sie am Abend mit einem Glas Wein, tauschten ihre Adressen aus, und Dr. Geist ließ sich versprechen, daß Regine am Morgen nicht aufstehen würde, um ihn zu verabschieden, da er zeitig wegmüsse. Sie war natürlich trotzdem auf und erwartete zitternd den ersten Kuß, den Dr. Geist ihr dann doch nicht zu geben wagte. Von nun an wanderten Vater und Tochter wieder allein, aber Regine hatte große Sehnsucht nach daheim und Martins erstem Brief, der auch prompt auf sie wartete. Sie widersprach nicht, als ihr Vater beim Einsetzen schlechten Wetters zeitiger heimfahren wollte. Von nun an wurden Briefe gewechselt, und am dreizehnten Dezember kam der erwartete, der den Heiratsantrag enthielt. Regine war selig.
Für sie war die Welt verändert, es galten nur noch die Tage, an denen sie einen Brief von Martin erwarten konnte. Sie schrieb eifrig wieder, sie träumte, sie lief spazieren, um ungestört an ›ihn‹ denken zu können, und sie weinte am Neujahrstag herzlich und mit Genuß, weil gerade an diesem Tag kein Brief kam. Er kam am nächsten Tag, und dann, ja dann war es eines Tages soweit, daß Martin selbst kam.
In diesem Jahr war es zeitig Frühling geworden. Regine hatte das Gefühl, als schmücke sich die Welt für den Tag ihres Wiedersehens, und wenn der Garten auch nicht viel hergab – Haberlands waren beide keine geschickten Gärtner –, so stand doch der Park im schönsten Frühlingskleid, und Regine brannte darauf, Martin alles zu zeigen.
Um diese Zeit hatte die Familie es schwer mit Friederike. Es war, als ahnte das Kind, daß es nun für einige Zeit die zweite Geige spielen würde, und das gefiel ihm gar nicht. Friederike war gewöhnt, daß Regine ihr abends vorlas, aus dem geliebten schönen Märchenbuch, das Mutter vor Jahren gekauft hatte. Regine tat das gern, doch jetzt waren ihre Gedanken so von Martin erfüllt, daß diese Vorlesestunde manchmal ausfiel, und fiel sie nicht aus, so fühlte das Kind unbewußt, aber deutlich, daß Regines Gedanken woanders waren, auch wenn sie vorlas. Friederike reagierte, wie ein bis dahin im Mittelpunkt der Familie stehendes Kind, das jetzt an den Rand geschoben wurde, reagieren muß: mit Zorn, mit Eifersucht, mit wütender Trauer. Einmal kam Regine dazu, wie die kleine Schwester dabei war, Seiten aus dem Märchenbuch herauszufetzen. Erschrocken nahm sie das geliebte Buch an sich.
»Was fällt dir denn um Himmels willen ein!« rief sie.
»Weil du nur ›Die zertanzten Schuhe‹ gelesen hast!«
›Die zertanzten Schuhe‹ waren ein ziemlich kurzes Märchen, und Friederike wünschte es sich nie, wenn sie ein Märchen aussuchen durfte. Sie erkannte es aber an den Bildern und hatte an dieser Stelle angefangen, die Blätter herauszureißen. Regine war sehr bestürzt, sammelte die Fetzen ein und klebte sie mühevoll wieder zusammen. Der Mutter erzählte sie zunächst nichts.
Aber auch den Eltern war Friederikes Veränderung aufgefallen. Die Mutter meinte, sie sei einfach ungezogen.
»Vielleicht wächst sie«, sagte der Vater, der kein Krankheitssymptom an ihr feststellen konnte. Dann aber geschah etwas, was nicht verborgen bleiben konnte: der Kutscher meldete, daß Fräulein Friederike, wie er sagte, ihm das Beil gestohlen habe. Er brauche es aber zum Holzhacken. Mutter schickte Regine, um nach der kleinen Schwester zu sehen. Sie fand sie im oberen Flur, wo das Kind dabei war, das Pferdel zu zertrümmern. Die Beine waren schon abgeschlagen – eigentlich eine erstaunliche Leistung für ein so junges Kind. Regine erschrak heftig, sammelte die einzelnen Teile ein und trug sie hinunter zur Mutter. Auch die Mutter war entsetzt.
»Das darf Vater nie erfahren«, sagte sie und tupfte sich die Augen aus, »lauf schnell zum Nentwig, er soll herkommen, ich will mit ihm sprechen.«
Regine gehorchte, und Mutters verzweifelte Bitten, hier helfend einzugreifen, rührten den alten Handwerker sehr. Er versprach, alles wieder in Ordnung zu bringen, und nahm mit, was vom Pferdel noch übrig war.
»Keene Sorge, ich mach’s schunt«, beruhigte er Mutter, die ganz verstört war von der Gewalttätigkeit ihrer kleinen Tochter. Als er gegangen war, berieten sich die beiden Frauen.
Daß Vater nichts davon erfahren dürfe, war beiden klar. Regine meinte, man müsse die Kleine tüchtig »aus den Lumpen schütteln«, wie man dort sagt; die Mutter aber war für Geduld.
Vielleicht war das falsch. Wenn eine von ihnen einmal richtig mit dem Kind gesprochen hätte – »sieh mal, Regine freut sich auf ihren Bräutigam (diese Vokabel benutzte man damals noch), sie will mit ihm ein neues Leben anfangen und kennt ihn noch sehr wenig, aber sie denkt immerzu an ihn; das geht einem so, wenn man verlobt ist« oder so ähnlich. Vielleicht hätte das Kind das schon verstanden. Auf diese Idee aber kam keine von ihnen.
Denn es war so: Die kleine Schwester war für Regine an den Rand des Bewußtseins gerutscht, das spürte das Kind und litt darunter. Immerhin unternahm Friederike keine weiteren Handgreiflichkeiten, sah aber blaß und verstört aus und fand sich erst langsam wieder zurecht. Regine lief mit roten Backen und bemehlter Schürze umher, buk Kuchen, stellte Salate zusammen, zählte die Tage und Stunden und befand sich in einem Rausch, als ein Telegramm eintraf: »Ganymed, Zeile zwanzig.«
»Was kann das heißen?« fragte sie. Ihre Mutter wußte es sofort. Sie war eine große Goetheverehrerin, konnte den ersten Teil des Faust fast ganz auswendig, dazu den gesamten Westöstlichen Diwan und sehr viele andere Gedichte.
»Wenn ich mal nach Weimar käme, das wäre, wie wenn ein gläubiger Katholik nach Rom führe«, sagte sie manchmal.
Jetzt wußte sie gleich, was gemeint war.
»Ich komme, ich komm’ –«
Regine riß den Band mit den Goethegedichten aus dem Regal, um sich zu vergewissern. Und siehe, die Mutter hatte recht. Da stand: »Ich komme, ich komm’ –«
Martin war die Nacht durchgefahren und erschien mit dem ersten Zug. Der Vater hatte den Kutscher mit Regine, die sich das nicht nehmen ließ, zur Bahn geschickt. Sie strahlte mit dem Morgen um die Wette.
Unvergeßlich blieb ihr Martins Begegnung mit der Mutter. Er beugte sich tief über ihre Hand, und sie weinte ein bißchen, aber es waren glückliche Tränen.
»Du hast mir ja gar nicht gesagt, wie schön deine Mutter ist«, sagte Martin später. Regine lächelte glücklich. Ihre Mutter und Martin verstanden sich auf den ersten Blick, beim ersten Wort. Sie sah es ohne Eifersucht und mit tiefer Freude. Diese Liebe von Schwiegermutter zu Schwiegersohn blieb gleich stark, solange die Mutter lebte.
Es war ein Sonnabend, an dem Martin kam. Sie frühstückten auf der Veranda, eine unvergeßlich schöne Stunde in der Frühlingssonne. Die Mutter fragte, ob Martin sich nicht hinlegen wolle. Aber er versicherte, er sei gar nicht müde, er habe die ganze Fahrt über geschlafen, und wenn Regine einverstanden sei, wolle er lieber ein Stück mit ihr Spazierengehen.
Und ob sie einverstanden war! Sie trug ein weißes, fußfreies Kleid und einen großen weißen Hut; Martin fotografierte sie darin, es wurde ein reizendes Bild, das jahrelang in einem Rahmen auf dem Klavier des jungen Paares stand. Eine etwas säuerliche, Regine nicht sehr zugetane Tante bedachte es mit dem Ausspruch: »Im günstigsten Moment«, was die Familie lachend übernahm. Regine war damals sehr hübsch.
Sie gingen los. Wohin? Natürlich »aufs Schloß«, wie man dort sagte, es war der schönste Spaziergang. Erst durchs Dorf, an Dempes Laden vorbei – diesmal vorbei und nicht hinein, Regine wollte dieses erste Wiedersehn mit Martin allein erleben –, über die kleine Brücke, die den Mühlengraben überspannte. Am Anfang und Ende der Brücke standen, wie heute noch, die beiden steinernen Heiligen. Einerseits der Florian, der gegen Feuer hilft – »Heiliger Sankt Florian, verschon mein Haus, zünd andere an –«, hieß es so menschenfreundlich, er stand und goß steinernes Wasser auf ein winziges steinernes Haus. Regine erzählte Martin die alte Geschichte, mit der man die Kinder foppte. Wenn man frühmorgens nichts ißt, danach schweigend dreimal um die Kirche geht und zuletzt vor dem Heiligen niederkniet und sagt: »Heiliger Sankt Florian, was hab’ ich heut gegessen?«, dann sagt er – sie verstellte ihre Stimme, daß sie tief und männlich klang: »Nächts.«
Martin lachte, zog sie im Dämmerlicht des Brauertors, durch das sie jetzt gehen mußten, an sich und drückte ihr schnell einen Kuß auf den Mund, den allerersten. Regine wurde rot vor Freude und Geniertheit.
Auf der anderen Seite der Brücke stand der heilige Nepomuk, kenntlich am Strahlenkranz, den er immer ums Haupt trägt. Dann kam man auf den großen Kirchplatz, wo die alte Kirche steht. Regine zog Martin gleich hinein. Sie liebte, wie jeder in der Familie, diese Kirche über alles. Flüsternd erzählte sie Martin all das, was sich hier zugetragen hatte. Und ging mit ihm, eng eingehakt, von einem Heiligenbild zum andern.
Schlesien ist reich an Barockkirchen, diese aber ist besonders schön. Ein verständnisvoller Geistlicher hatte alles Bunte daraus verbannt und die Figuren in Weiß und Gold gehalten. Da gab es Heilige, die durch ihr Martyrium berühmt geworden waren: einer trug seinen abgeschlagenen Kopf auf einem Buch vor sich her, ein anderer drehte sich mit einem merkwürdigen Instrument den Darm aus dem aufgeschlitzten Bauch.
»Den mußte ich als Kind immer ansehen, es gruselte mich dann so schön«, flüsterte Regine. Die Kanzel hatte ein Dach, auf dem eine Leiter stand, die Jakobsleiter, und auf dieser stiegen kleine steinerne Engel, dikke, überernährte Putten, auf und nieder.
»Der Alte Fritz war oft hier, er war mit dem Abt befreundet«, erzählte Regine eifrig, »einmal fragte er ihn, warum die Engel denn eine Leiter brauchten. Sie hätten doch Flügel. ›Ja, Majestät‹, antwortete der Abt – er hieß Tobias Stusche – ›sie waren damals wahrscheinlich gerade in der Mauser!‹«
An einer der dunklen Bänke aus Holz stand:
»Hier stand und sang Friedrich, der Zweite, der Große, als Mönch verkleidet, während die Österreicher die Kirche nach ihm durchsuchten.« Der Abt hatte ihn schnell in eine Kutte gesteckt und mit den Mönchen in die Kirche ziehen lassen. Wie anders wäre die Geschichte verlaufen, wenn er nicht diese rettende Idee gehabt hätte! Den Adjutanten fanden die Feinde hinter dem Hochaltar. Er hieß von Glasenapp.
»Und draußen an der Prälatur, das sind solche Pfeiler mit kleinen Bänken, dort hat er gesessen und Flöte gespielt.«
»Du kanntest ihn wohl persönlich?« fragte Martin lächelnd.
»Ich glaub’ fast, jedenfalls beinah«, ereiferte sich Regine, »und nachher gehen wir an einem Maulbeerbaum vorbei, den hat er noch gepflanzt oder pflanzen lassen –«, schränkte sie ein. »Er hat die Seidenraupenzucht hier eingeführt.«
Sie gingen über die Himmelbrücke in den Park hinein und stiegen die Terrassen hinauf zum Schloß. Die schön gepflegten Wege schwangen auseinander und wieder zusammen, Bronzefiguren zierten kleine Wasserbecken. Hier ein Knabe mit einem Delphin, dort einer mit einer Schildkröte. Und jetzt der große Platz vor dem Schloß, mitten darauf ein Wasserbecken, auf dessen Rand steinerne Frösche hockten. Laubengänge und verschwiegene Bänke, fast verhüllt, auf stille Besucher wartend. Treppen, die man leicht und beschwingt emporging, der Blick vom Schloß über das Dorf bis zu den Bergen hinüber, die duftblau am Horizont standen. Rings um das Schloß führte ein Weg zum Rosengarten und zur Siegessäule. Martin und Regine schwiegen miteinander, Worte wären zuviel gewesen. Hier sollten einmal ihre Kinder und Enkel gehen, wenn Gott ihnen das gewähren wollte. Martin hatte einen sehr guten Arbeitsvertrag erhalten, den hatte er abgewartet, ehe er Regines Eltern offiziell um die Hand ihrer Tochter bat. Er erzählte jetzt davon, und Regine versteckte ihr Gesicht an seiner Schulter.
Am Sonntag fand das Festessen statt. Der Tisch war aufs schönste geschmückt, Silber und Kristall glänzten, und der Vater hielt eine Rede, zu der er sich erhob. Regine sah vor Verlegenheit in ihren Schoß, Martin entgegnete mit Wärme und Anstand. Kaum hatte er geendet, als es klopfte und Marie, die diesjährige Küchenfee, mit einem Telegramm hereinkam.
»Ich sullts halt glei abgeba, hot er gesaot«, murmelte sie entschuldigend. Der Vater nahm es ihr ab. Aber es war an Martin gerichtet. Martin entfaltete es – las es für sich und dann halblaut vor. Sein Vater war gestorben.
Alle schwiegen.
Später hieß es, dies sei geschehen, weil es dem alten Herrn das Herz gebrochen habe, daß Martin eine Katholikin heiraten wollte. So erzählte man es in Martins Verwandtschaft. Jetzt war davon noch keine Rede.
»Da mußt du wohl gleich wieder fort?« flüsterte Regine, nachdem alle Martin ihr Beileid ausgesprochen hatten. Sie weinte. Martin legte seine Hand auf die ihre.
Die Mutter sprach dann ein paar freundliche Worte. Niemand hatte von ihr eine Tischrede erwartet, aber es tat gut zu hören, wie sie mit dem Herzen mitfühlte. Der Vater stand auf und holte das Kursbuch. Zum Glück ging der nächste Zug erst am Abend.
»Wir können also noch in Ruhe beieinandersitzen bis dahin«, sagte Martin, »laßt euch den schönen Tag nicht verderben.«
Sie gaben sich alle Mühe, einer wie der andere. Regine hatte ihre Kochkünste zeigen wollen und sozusagen künstliche Eier zubereitet. Es waren zwar richtige Hühnereier, aber ausgeblasen und mit einer cremigen Mayonnaise gefüllt. Nun achtete niemand darauf, nur der Vater sagte grimmig, als er das dritte aufschlug: »Wieder eins ohne Dotter!«
Da mußten alle lachen, und der Bann war gebrochen. Beim Kaffee danach wurde schon wieder munter geschwatzt; es wurden Pläne gemacht für die Hochzeit im Mai, es wurde auch gelacht, obwohl man sich dessen ein bißchen schämte. Regine zeigte sich tapfer der raschen Trennung gegenüber, sie tröstete sich damit, daß Martin im Mai nicht ohne sie abfahren würde. Trotz allen Kummers war es ein harmonischer Nachmittag, und Martin fuhr freundlich winkend ab, nachdem er Regine nun richtig und liebend geküßt hatte.
»Jetzt dürfen wir es ja«, sagte er leise, als er merkte, daß Regine verschämt nach dem Bahnbeamten guckte, der mit seiner roten Mütze auf dem Kopf darauf wartete, das Zeichen zur Abfahrt des Zuges zu geben. Er war ein Patient ihres Vaters und kannte sie natürlich. Aber die Verlobung war im Dorf längst bekannt.
»Wie isses denn, richtig verlobt zu sein? Ich meine, so wie du, mit Ring und rumgeschickten Anzeigen und so«, fragte Lore Dempe eines Tages. Sie saßen im Laden, der geschlossen war. Sie hatten noch kein Licht gemacht. Die ›aahle Dempen‹ saß hinter der Kasse, Regine und Lore hockten an der Seite, je auf einem Sack. Die Säcke mit ungebranntem Kaffee, mit Erbsen und Linsen lehnten am Ladentisch. Vorhin war jemand mit einem Brett oder einem Stock an der heruntergelassenen Jalousie entlanggefahren. Das hatte ein schnarrendes Geräusch gegeben – da waren alle drei vor Schreck hochgefahren.
»O diese bösen Bubenhände«, seufzte Frau Dempe. Friederike kroch in den Winkeln des Ladens herum.
»Schön, aber auch nicht schön«, sagte Regine. »Wenn er schreibt, ist’s schön, aber sonst wartet man nur. Und wenn ich denke, ich warte ja darauf, daß ich hier fortmuß, – dann ist es noch schlimmer.«
»Ja, da hab’ ich es besser«, sagte Lore, »ich brauch’ nicht fort. Josef übernimmt den Laden hier.«
Josef Kirchner, ihr Verehrer, war Kaufmann.
Natürlich wußte man im Doktorhaus darüber Bescheid, aber Vater hatte sofort gesagt: »Na, der liebt den Laden und nicht die Lore.«
Regine fand es gräßlich, so zu denken. Und doch verglich sie gleichzeitig in Gedanken Josef mit ihrem Martin. Da tat ihr die Freundin leid. Sie war erleichtert, als Friederike, die sich langweilte, jetzt anfing zu quengeln. Sie wollte nach Hause.
»Bringst du uns noch ein Stück?« fragte sie Lore. Untergehakt bummelten sie die Dorfstraße hinunter.
Es war ein lauer Abend. Sie gingen mitten auf der Straße. Auf dem Fußgängersteg kam ihnen eine kleine Gestalt entgegen, die Gustel, wie sie errieten. Sie ging mit eiligen Schritten, den Kopf vorgebeugt, am Staketenzaun entlang und rannte gegen den Lichtmast, der seit einiger Zeit hier stand. Auch auf die Dörfer kam jetzt Elektrizität, was vor allem Regines Vater sehr freute.
Rums, machte es. Die beiden jungen Mädchen erschraken, mußten aber heftig lachen, als sie hörten, wie die Gustel murmelte: »Ach entschuldigen Sie, Herr Generaldirektor!«
Warum sie den Lichtmast ausgerechnet für diesen hohen Herrn hielt, war unerfindlich. Regine lachte noch, als sie die Messingklingel an der Tür des Doktorhauses zog.
Lore war umgekehrt. Regine trat in die Eßstube, wo ihre Mutter zu sitzen pflegte – nein, nicht allein. Auf dem Stuhl, vor ihrem Platz am Fenster, stand etwas, was Regine lauthals aufjuchzen ließ: Friederikes kleines Schaukelpferd. Da stand es, so gut repariert, daß es kaum auffiel, neue Beine eingeschraubt, tipptopp in Ordnung. Es war nun nicht mehr so hell wie früher, sondern, von liebevollen Kinderhänden glatt gestrichen, dunkler geworden, aber mit dem gleichen ausdrucksvollen Kopf. Die Mutter war sehr gerührt.
»Nun brauchen wir es Vater nicht zu erzählen.«
Aber die beiden Frauen erlebten eine Überraschung. Friederike hatte das kleine Schaukelpferd natürlich auch gesehen, sie stürzte sich aber nicht, wie man hätte annehmen sollen, auf ihr bisher so geliebtes Spielzeug, sondern blieb mit funkelnden Augen davor stehen.
»Das will ich nie mehr haben«, stieß sie hervor, »das könnt ihr behalten. Ich will kein Pferdel mehr – macht damit, was ihr wollt –« Sie drehte sich um und rannte aus dem Zimmer. Als Regine später nach ihr schaute, fand sie die Kleine im Bett liegen, schlafend, das Gesichtchen tränenverschmiert. Merkwürdig. Sie ging zur Mutter zurück.
»Mutter«, sagte sie nach einer kleinen Weile, als sie berichtet und dann geschwiegen hatte. »Wenn wir, Martin und ich, einmal Kinder haben sollten – gibst du es uns dann?«
»Wollt ihr denn Kinder?« fragte die Mutter sacht. Über so etwas sprach man in den Familien nicht. Regine war froh, daß es dunkel war. Kinder. Sich Kinder wünschen, Kinder bekommen – dies alles war ein Kapitel, über das man nicht sprach. Nicht Mutter, nicht Vater, nicht einmal hier, in einem Arzthaus.
»Na ja – Lore sagte –« Regine verstummte.
»Was sagte denn Lore?« fragte Mutter geniert.
»Sie sagte – ich meinte, ob sie glaube, daß sie Kinder bekäme.« Regine brach ab, sich des Unpassenden dieses Satzes bewußt.
»Na? Was –«
»Sie sagte: ›Hach, das wär’ gelacht!‹« gestand Regine und war erleichtert, als sie die Mutter lachen hörte. Mutters halblautes, zärtliches Lachen, das sie so liebte; aber bei solch einem heiklen Thema ...
Sie entfloh, sobald es ging, in ihr Zimmerchen hinauf. Die Mutter blieb zurück. Nachdenklich, auch geniert und mit schlechtem Gewissen. Wäre das nicht eine – ja die Gelegenheit gewesen?
Aber sie hatte sich nicht getraut.
Die Hochzeitsreise des jungen Paares ging nach Wölfelsgrund, einem Luftkurort in der Nähe. Regine hatte, wie es üblich war, weinend am Hals ihrer Mutter gehangen, als sie sich verabschiedeten, und der Abschied vom Vater tat auch weh. Wer würde nun mit ihm auf Praxis fahren? Friederike war noch zu klein.
»Man kann nicht gewinnen, ohne zu verlieren«, hatte Mutter Regine noch zugeraunt. Ob die Tochter es verstanden hatte? Ob sie verstand, daß auch sie, die Mutter, hergeben mußte?