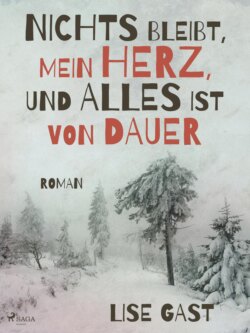Читать книгу Nichts bleibt, mein Herz, und alles ist von Dauer - Lise Gast - Страница 6
3
ОглавлениеLeipzig
1907
Im August des folgenden Jahres kam Regines erstes Kind zur Welt, ein sehr ersehntes Kind, mit Freude und Dankbarkeit begrüßt, der schönste und herrlichste Sohn der Welt.
»Eigentlich müßte er ja Fritz heißen, meinen Eltern zuliebe«, sagte Regine, als sie endlich mit Martin allein war. Sie hatte zu Hause entbunden, in Leipzig-Reudnitz, auf dem Täubchenweg (sprich: Deibschenwech), im dritten Stock, mit Hilfe einer Hebamme und eines Arztes. Es war nicht ohne Zange gegangen. »Aber weil er so ein besonderes Kind ist – er wird bestimmt einmal etwas ganz Großes –, bleiben wir doch bei Alexander.« Alexander der Große – er war fünf Zentimeter länger, als sie selbst bei der Geburt gewesen war, wie sie durch Zufall wußte.
Martin war nach einigem Überlegen einverstanden. Seiner Bescheidenheit stand Regines Begründung ›weil er doch etwas ganz Großes wird‹ zwar absolut entgegen, aber Alexander war gleichzeitig auch ein traditioneller Name in der Familie Geist. So konnte er es vor sich selbst begründen. Regines Mutter kam auf das sofort abgeschickte Telegramm hin angereist, um die Tochter zu pflegen, und Martin fuhr mit dem Schwiegervater in die Alpen. Sie erstiegen die Zugspitze. Das Foto, das dort geknipst wurde, hielt sich generationenlang in der Familie: der Vater mit einem Kopftuch, das über seinen Hut gebunden war. Den Damen wurde diese Besteigung erst hinterher mitgeteilt.
Alexander entwickelte sich normal und bekam, schneller als erwünscht, eine Schwester. Martin war mit einem Kind einverstanden gewesen, er hielt es für seine Pflicht, der Familie einen Erben zu bringen, aber gleich danach ein zweites Kind und noch dazu ein Mädchen? Er sah sehr bedenklich drein und ließ auch ein paar Worte fallen, etwa: dies sei nun genug. Die Mutter und Regine schwiegen.
Der Name für die Tochter machte Schwierigkeiten. Da der Sohn einen so hochtrabenden Namen erhalten hatte, meinte Martin, dürfe man das zweite Kind nicht entgelten lassen, daß es ein wenig zu zeitig und sozusagen ungefragt zur Welt gekommen sei, und stimmte Regine zu, daß es Isolde heißen solle. Isolde Geist, warum nicht?
Das Kind war klein, häßlich und sah einem wenig geliebten Vetter der Familie ähnlich. Dabei war es recht ungebärdig, nicht solch ein pflegeleichtes Baby wie Alexander, der in seinem bisher kurzen Leben noch keine Sorge und keinen Ärger verursacht hatte. Es war gierig und verfressen und wurde vom ›großen‹ Bruder wenig freundlich empfangen.
Auch später entwickelte sich Isolde nicht zu einem hübschen Kind, nicht einmal in der Zeit, in der alle Halbwüchsigen reizend aussehen. Sie hatte etwas zu hellblaue Augen unter einem dunkelblonden Schopf, einen breiten Mund und ziemlich abstehende Ohren. Deshalb flocht Mutter Regine ihr, sobald es möglich war, Zöpfe und rollte sie über den Ohren zu Schnecken auf, eine Frisur, die Isolde haßte. Das Haar kurz zu tragen wie ein Junge, was sie sich heiß wünschte, erlaubten die Eltern ihr nicht. Alexander mochte die Schwester nicht, er faßte sie nie an.
Obwohl diese beiden Kinder zunächst die einzigen blieben und daher aufeinander angewiesen waren, vertrugen sie sich nicht gut miteinander. Alexander, zart und muttergebunden, neidete der Schwester den Platz, den diese robust und ziemlich rücksichtslos bei der Mutter erkämpfte, er nannte sie Isott und später Idiot, ein Spitzname, den die Mutter lachend duldete, stammte er doch von ihrem angebeteten Ältesten. Isolde aber litt darunter, als sie verstand, was er bedeutete. Zunächst war sie dem Bruder körperlich überlegen; wehrte sich, wenn er sie angriff, spuckte und kratzte. Als Alexander mit etwa fünf Jahren zu den Großeltern nach Camenz fuhr – er litt an immer wiederkehrenden Asthmaanfällen, da war Luftveränderung angezeigt –, wurde er dort von der Großmutter mit gleichaltrigen Jungen zusammengebracht und entwickelte sich zu dem, was man einen ›richtigen Jungen‹ nannte. Jedenfalls war er fortan der Dominierende und blieb es sein Leben lang, bemüht, diese Vorherrschaft beizubehalten und Isolde zu ducken, wo es nur ging. Er war der weitaus Begabtere, war älter und ein Junge, also in jeder Beziehung im Vorteil. Aus jener Zeit stammte wohl auch Isoldes sehnlicher Wunsch, ein Junge zu sein.
Die Familie war inzwischen umgezogen und wohnte jetzt nicht mehr auf dem Täubchenweg, sondern in einer netten Vorstadtstraße, allerdings im Osten der Stadt, weil das Bibliographische Institut auch im Osten lag und Martin in Sparsamkeit und Bescheidenheit darauf bestand, seinen Weg zur Arbeit täglich zu Fuß zurückzulegen. Im zweiten Stock einer hübschen Neubauwohnung mit Vorgarten und zwei Balkonen wuchsen die Kinder auf, ohne einen Kindergarten zu besuchen, da sie ja zu zweit waren.
Isolde mußte sich dem überlegenen Bruder unterordnen. Sie tat das nicht ohne Widerspruch. Sie schrie, wenn ihr etwas nicht paßte, und so entstand der Familienruf: »Iso keift.« Sie keifte wirklich, und Alexander triumphierte schadenfroh, wenn nach damaligen Erziehungsregeln derjenige sein Teil abkriegte, den man hörte. Das war immer die Schwester. Trotzdem verlebten die beiden eine bis zu einem gewissen Grade harmonische Kindheit.
Das kleine Schaukelpferd war wirklich mit ihnen gezogen und wurde von Iso zärtlich geliebt. Alexander machte sich nicht viel daraus. Iso jedoch hatte ein liebevolles Verhältnis zu ihm. Friederike fragte nie nach dem Pferdel, wie Großmutter Haberland in ihren langen und gutgelaunten Briefen berichtete. Friederike wuchs heran, entwickelte sich zu einer Schönheit und bekam mit dreizehn Jahren den ersten Heiratsantrag. Ein Maler, der ihr Porträt malte, verliebte sich insgeheim wild und melancholisch in dieses Mädchenkind und schrieb Gedichte auf sie, die Mutter Haberland allerdings unter Verschluß hielt. Friederike bekam sie nie zu sehen, auch dann nicht, als Regine später den Nachlaß der Eltern ordnete und die Gedichte fand. Schorschel, der für Friederike eine freundlichbrüderliche Liebe hegte, besuchte das Doktorhaus oft, er studierte Jura und verbrachte fast jeden Sonntag bei den Haberlands.
Alexander und Iso hatten ein hübsches Kinderzimmer, in dem sie spielten, wenn sie nicht mit Mutter Regine Spazierengehen mußten, eine Notwendigkeit, da sie keinen Garten hatten, um darin zu toben. Diese Gänge stahlen Mutter Regine viel Zeit, und sie begann sie zu hassen. Zu Hause – das Doktorhaus war noch immer ihr Zuhause, was sie allerdings konsequent verschwieg – hatte der große Garten ihre Kinderspiele umhegt, und die Mauer, die ihn abschloß, war ihr Lieblingsplatz gewesen, jeder Baum ein guter Kamerad. Manchmal weinte sie im Schlaf vor Heimweh und erwachte mit schlechtem Gewissen – mußte nicht Martins Heim jetzt ihr Zuhause sein?
Er ahnte nichts davon. Arbeitswütig, wie er war, gewissenhaft, ungeheuer fleißig, brachte er jeden Abend Arbeit mit nach Hause, saß bis elf Uhr abends am Schreibtisch und sah die Kinder nur bei den Mahlzeiten. Im Urlaub allerdings fuhr man nach Schlesien, und darauf freuten sich Mutter Regine und die Kinder das ganze Jahr über.
Alexander und Iso waren in ihrem Kinderzimmer immer beschäftigt. Beide hatten viel Phantasie. Ihre Spiele erstreckten sich über Monate und wurden auch durch die Schule nicht beeinträchtigt. Vorläufig war das Spiel noch die Hauptsache.
Eines Tages entwischte ihnen ein Luftballon und stieg oben an die Zimmerdecke. Sie wollten ihre Mutter nicht zu Hilfe rufen und versuchten ihn selbst herabzuholen. So schoben sie – sie waren vier und fünf Jahre alt – ihren Kindertisch unter den Ballon. Alexander kletterte hinauf und angelte nach dem Faden, aber es reichte nicht. Sie holten das kleine Schaukelpferd, das neben Isos Bett stand, und stellten es auf den Tisch. Immer noch zu niedrig! Alexander brachte den großen Baukasten, nahm ein paar Klötze heraus und legte sie unter die Kufen des Pferdes. Dieser Aufbau war wacklig genug zum Umkippen, aber Kinder haben bekanntlich einen Schutzengel. Alexander stieg auf das Schaukelpferd, und als es noch immer nicht reichte, ließ er sich von Iso die große Papierschere von Vaters Schreibtisch holen, mit der er den Faden schließlich erreichte, ohne herunterzufallen oder sich die Augen auszustechen. Von dieser Unternehmung erfuhr Regine erst Jahrzehnte später.
Iso bewunderte den Bruder nicht, sondern geriet in Zorn, weil er mit Schuhen auf das geliebte Pferd gestiegen war. Als der Luftballon gefangen war, nahm sie das Pferd an sich, legte es in ihr Bett und streichelte es sacht. Alexander sah zu und verhöhnte sie:
»Der dumme Holzgaul!« spottete er. »Der fühlt doch nichts!«
Iso brach in Tränen aus.
»Und wenn ich dir auf dem Rücken herumtrampele – mit Schuhen?«
»Versuch’s doch –!«
Diesmal ließ Iso sich nicht einschüchtern. Sie stieß mit dem Fuß nach dem Bruder, erwischte ihn an der Hüfte und warf ihn um. Er flog gegen den Tisch und brüllte – da kam die Mutter herein.
»Iso, was tust du da –?«
Ritsch, ratsch, kriegte die Tochter ein paar Ohrfeigen, und der Sohn wurde getröstet. Iso kroch zu ihrem Schaukelpferd ins Bett und heulte, aber leise – ihre Mutter hörte es nicht. Die Mutter hörte und verstand häufig nichts von Isos Kümmernissen ...
»Ich will wieder nach Camenz, ich nehm’ dich mit«, flüsterte Iso ihrem Pferd zu, »wir beide gehören hier nicht her – wir wollen nach Hause –«
Sie malte sich aus, wie sie, das geliebte Tier unterm Arm, bei ihrer Großmutter ankäme und wie diese sie in die Arme nähme, sie samt dem Schaukelpferd, und die wunderbarsten Worte der Welt sagte: »Ich hab’ euch lieb. Ihr bleibt bei mir ...«
Im Kinderzimmer über der großen Klappbank, die das Spielzeug beherbergte, hing ein großes Bild. Es zeigte einen Meeresstrand mit Brandung und eine Schar junger Reiter in der Badehose auf Schimmeln, die dem Betrachter entgegensprengten, daß es spritzte. Dieses Bild prägte sich Iso tief ein und lenkte sehr viel später ihren Lebenslauf in eine der Familie wenig erfreuliche, für sie aber von Sehnsucht getragene Richtung.
Iso war eigentlich seit Anbeginn ihres Lebens der heikle Punkt der Familie, das unregelmäßige Verb, das Ärgernis und der Sorgenstein. Sie war kein ›richtiges Mädchen‹, spielte nicht mit Puppen, las Jungensbücher und wäre am liebsten in Hosen herumgelaufen, aber das war damals unmöglich. Als Alexander vier Jahre alt war, begriff sie zum ersten Mal den Unterschied und bildete sich ein, daß man mit vier Jahren ein Junge würde. Diese Enttäuschung an ihrem vierten Geburtstag! Die Mutter fragte, warum sie weine, und Iso gestand es unter Schluchzen. Da lachte ihre Mutter hell auf, und daß sie lachte, nicht tröstete, nicht versuchte, dem Kinde klarzumachen, daß ein Mädchen nicht weniger wert sei als ein Junge, das vergaß Iso nie. Immer hieß es: »Du bist bloß ein Mädchen, du darfst dieses oder jenes nicht.« Daß es ein Vorteil sein könne, ein Mädchen zu sein, war undenkbar.
Die Spiele der beiden Geschwister waren natürlich nach Alexander ausgerichtet, denn er hatte zu sagen. Die Puppenstube, die Iso geschenkt bekommen hatte, damit sie endlich Mädchenspiele lernte, wurde zur Kajüte eines Schiffes. Die Kinder besaßen das Abenteuerbuch »Siegesmund Rüstig«, das wochen- und monatelang nachgespielt wurde. Hauptpersonen dieser Spiele waren kleine Bären, Plischel und Plummel, Petzel und Schluckel. Eine weiße Maus aus Zelluloid hieß Karoline und stellte merkwürdigerweise eine Negerin dar. Auch traurige Erlebnisse gab es für die Kinder. Sie waren schon größer und durften allein zur »Völkerschlacht« gehen – kein Leipziger sagte jemals »Völkerschlachtdenkmal« –, ein Spaziergang, den sie sonst täglich mit Mutter Regine hatten machen müssen. Sie nahmen ein kleines Segelboot mit, das Alexander gehörte. Da hinein kam Petzel, ein Bär des Bruders, und an der »Völkerschlacht« wurde das Schiff unter Beachtung der Windrichtung in das Wasserbecken gesetzt, das dem riesigen Denkmal vorgelagert ist. Nun sollte Petzel dieses Weltmeer überqueren. Den Kindern war es streng verboten, im Wasser zu waten, sie mußten das Schiff also am andern Ufer erwarten.
Aber o weh! Der Wind hielt nicht, was er versprochen hatte, und Petzel segelte keineswegs dem gegenüberliegenden Ufer entgegen. Die Geschwister warteten, lauerten, wünschten, hofften und verzweifelten. Schließlich kenterte das kleine Boot auf hoher See. Sie wußten beide, daß sich ein solches Schiffchen mit nassem Segel nicht wieder aufrichten würde. Da befahl Alexander seiner Schwester, Petzel zu retten. Und trotz des Verbots der Mutter zog sie Schuhe und Strümpfe aus, schürzte ihr Kleid und watete ins Wasser.
Es war eine Verzweiflungstat. Sie glich den vorwärts stürmenden Teutonen, denen, um die drohende Niederlage auszuschließen, die Häuptlinge mit der blanken Waffe folgten. Es gab kein Zurück. Iso watete und watete, weinend und in der Gewißheit, daß dieser Ungehorsam auch noch vergeblich sein würde.
Und er war es. Sie erreichte das Schifflein, aber Petzel war nicht mehr darin. Er war ertrunken. Und auch als Alexander von neuem befahl, den kleinen Bären zu suchen, blieb der Erfolg aus, wenn man es nicht als solchen rechnen wollte, daß Iso unterwärts klatschnaß zurückkam, was zu Hause nicht verborgen bleiben würde.
Schließlich mußten sie den Heimweg antreten. Alexander schickte Iso voraus, um den Sturm zunächst auf sie zu lenken, aber o Wunder, die Mutter schalt diesmal nicht ob des Ungehorsams, sondern lächelte immerhin mitleidig. Sie ging dem Sohn entgegen, gewärtig, er würde wie sie den Verlust ein wenig kindisch finden. Aber nein, auch Alexander war untröstlich.
Die Mutter redete ihm gut zu. Sie stellte in Aussicht, daß das Becken irgendwann abgelassen und man den Petzel denn sicherlich finden würde. Das erstere geschah eines Tages, aber auch intensive Suche nützte nichts. Petzel blieb verschwunden.