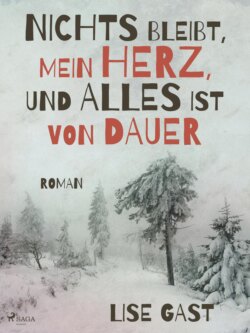Читать книгу Nichts bleibt, mein Herz, und alles ist von Dauer - Lise Gast - Страница 8
5
ОглавлениеWieder Camenz. Ängste
1916
Es waren zunächst glückliche Jahre für die Kinder. Sie sprachen wieder Schlesisch. Sächsisch hatten sie in Leipzig nicht sprechen dürfen. Großvater Haberland hatte seinen Spaß an den Dummheiten, die sie machten. Mitunter wetterte er auch, aber er verschwieg es, wenn er Iso zu Pferde sah – sie hielt sich mehr im Stall auf als im Haus, ritt in die Schwemme, zum Schmied und war gut Freund mit den jeweiligen Kutschern. Mutter Regine wartete auf ihr Kind, eingehüllt in die Liebe und Sorge ihrer Eltern, und war selig, wenn Martin auf Urlaub kam. Friederike ›half‹ im Haus, las den Kindern abends aus dem alten bewährten Märchenbuch vor, zankte sich mit Regine und hatte zwar keinen Schulabschluß, dafür aber um so mehr Verehrer. Eines Tages verlobte sie sich mit einem jungen Lehrer aus der Nachbarschaft. Ihren Eltern paßte das gar nicht, und sie erreichten, daß die Verlobung wieder gelöst wurde. Ein sehr entfernter Vetter, der zufällig Fritz hieß, Fritz Haberland, und aus Neustadt in Oberschlesien stammte, dem Ort, in dem auch Großvater Haberlands Wiege gestanden hatte, verehrte sie von fern. Er schrieb ihr viele Feldpostbriefe – er war in Palästina eingesetzt und erlebte den Krieg wie ein großes Abenteuer. Elfmal wurde er verwundet. Ein Mann, der immer guter Laune war, ein großer, kräftiger, liebenswerter Mann, der Friederikes Eltern als Schwiegersohn sehr willkommen gewesen wäre. Friederike las seine Briefe, steckte sie weg und antwortete nicht oder nur selten. ›Vielleicht lern’ ich noch mal einen netteren kennen‹, dachte sie, und sie hatte insofern recht, als sie noch so jung war.
Im Doktorhaus gingen viele Leute aus und ein. Ein nur leicht verwundeter Medizinstudent, der in einem der beiden Lazarette im Dorf lag, schloß sich an Vater Haberland an und kam dadurch in die Familie. Er war zwei Jahre älter als Friederike und flog natürlich auf die Reize der schönen jungen Arzttochter. Wer sich jedoch bis zum Wahnsinn in ihn verliebte, war nicht Friederike, sondern Iso.
Ein bißchen schmeichelte es Friederike auch, daß dieser junge Mann sie bewunderte. Er hatte schöne, große blaue Augen – Augen wie ein gestochenes Kalb, bemerkte Alexander, als er entdeckte, wie es um Iso stand –, hing an Großvater Haberland, spielte mit Alexander Schach und versäumte keine Unternehmung des jungen Volkes. Er ging mit den Kindern Krebse fangen, brachte Alexander und Iso im Mühlengraben das Schwimmen bei, half im Garten und war ein eifriger Schüler Vater Haberlands. Friederike hatte eben das »Buch der Lieder« von Heinrich Heine entdeckt, das Iso ihr bald stibitzte und daraus auswendig lernte, was immer ihr gefiel. Sie erlebte ihre erste Liebe sehr stürmisch, vergoß Tränen in der Nacht, machte Gedichte, war selig, wenn der Angebetete zu Tisch geladen wurde, kurz, es war eine herrliche Zeit im Doktorhaus. Zwar drängte der Krieg mit Extrablättern und Verwundetenlisten herein, aber sie waren doch ziemlich seitab. Martin war auf Borkum eingesetzt, wo der Landsturm sozusagen auf Wache stand, bräunte sein blasses Gelehrtengesicht und schrieb zuversichtliche Briefe. Die einzige, die Unheil ahnte, war Großmutter Haberland. ›Mütter sind wie Seevögel, sie wittern den Sturm, lange ehe er ausbricht‹, sagte sie manchmal. In dem sehr kalten Winter neunzehnhundertsiebzehn kam Regines drittes Kind zur Welt, Christiane, gesund und mit Begeisterung begrüßt. Friederike erwies sich als die zärtlichste Tante, und Regine dankte Gott, daß ihr Vater das Kind in Empfang nahm, sie wäre ohne Arzt an einer starken Blutung gestorben, hätte er nicht rechtzeitig tamponiert.
Die Taufe wurde ein großes Familienfest. Natürlich richtete man sich mit dem Termin nach Martins Urlaub, dann aber wurde alt und jung eingeladen. Iso mußte ein Festlied nach der Melodie »Wohlauf, noch getrunken den funkelnden Wein!« dichten, das gemeinsam gesungen wurde. Sie tat es mit Freuden, weil sie gerade die Lyrik entdeckt hatte. Alexander allerdings fand, was sie ›dichte‹, sei Kitsch; einmal aber fiel er gehörig herein. Er hatte ein von ihr geschriebenes Poem irgendwo gefunden – Iso versteckte zwar ihre Elaborate meist, ließ sie aber andererseits auch wieder herumliegen, da sie zu Regines Kummer und Ärger sehr liederlich war – und brachte es voller Hohn vor der ganzen Familie zum Vortrag.
»Hört mal, was Idiot von sich gegeben hat!«
Alles verstummte. Er begann mit Pathos:
›»Das Hängelämpchen qualmt im warmen Stalle,
in dem behaglich sich zwei Kühe fühlen,
Der Hahn, die Henne, um den Sproß die Kralle –‹«
Es war ganz still. Alle hörten zu.
»Na? Wunderbar! Einfach klassisch!« kommentierte Alexander, als er die beiden Strophen zu Ende rezitiert hatte. Die Familie schwieg noch immer. Dann sagte die Großmutter langsam, ein wenig in sich hineinhorchend, aber überaus deutlich:
»Das, Alexander, ist, glaube ich, nicht von deiner Schwester. Sie hat es wohl irgendwo abgeschrieben, weil es ihr gefiel. Wenn ich mich nicht täusche, ist es von Detlev von Liliencron. Sei so gut, bring mir mal das dicke Buch dort, da steht es sicher drin.«
Es stand darin. Und Alexander war der Blamierte.
»Sie dichtet aber sonst immer fürchterlichen Quatsch«, knurrte er und warf seiner Schwester einen wütenden Blick zu. Jeder in der Runde verstand, daß dies nur ein schwaches Rückzugsgefecht war. Iso freilich wußte, daß es noch ein Nachspiel geben würde. Alexander boxte, wenn er wütend war, absichtlich grob, ihre Oberarme trugen ständig blaue Flekken. Da sie nicht petzte – Petzen war verpönt –, mußte sie hinnehmen, was ihr blühte. Immerhin, in diesem Fall war er der Dumme gewesen, das war nicht mehr zurückzunehmen.
Isos Liebe zur Dichtkunst wurde in diesem Jahr sehr unterstützt. Der junge Mediziner, mehr und mehr zur Familie gehörend, schlug vor, daß die Jugend des Hauses, also Friederike, die beiden Kinder und er nun jede Woche ein Gedicht lernen und am Sonntag vortragen sollten. Jeder hatte die freie Wahl. Friederike entschloß sich als erstes für die »Wallfahrt nach Kevelaer«, Iso für die »Schwäbische Kunde«. Bald lernte man freiwillig ein zweites dazu, oft lange Balladen wie die »Bürgschaft«; das Auswendiglernen fiel immer leichter. Sogar an die »Glocke« und Wildenbruchs »Hexenlied« wagte sich der eine oder andere. Es war eine höchst anregende Zeit. Meist hockte irgendwo in einer Ecke einer, die Finger in die Ohren gesteckt, und memorierte.
Großmutter Haberland sah es mit Freude und leichter Rührung. Sie selbst wußte unzählige Gedichte auswendig und ließ sich nicht lange bitten, wenn die Kinder mitunter stürmisch nach Bürgers »Lenore« verlangten oder auch nach anderen geliebten Gedichten. Bei manchen wußte sie selbst nicht, woher sie sie kannte, und die Kinder, nun schon größer, baten immer wieder um Gedichte, die sie ihnen ganz, ganz früher aufgesagt hatte: »Wie hoch mag wohl der Himmel sein« oder das Storchengedicht »Man soll nicht aus der Schule plappern«. Vor allem für Iso, die sich so oft und mit Absicht ruppig und jungenhaft benahm, waren Gedichte ein heimlicher Schatz, den sie hütete und stetig erweiterte, ihr ganzes Leben lang.
Im Doktorhaus befand sich unterm Dach eine schöne, helle Giebelstube, in der die Hase-Rosa wohnte. Schon Regine hatte bei der Hase-Rosa Stricken gelernt, und das, meinte sie, müsse auch Iso, obwohl sie für weibliche Arbeiten wenig Talent und niemals Lust hatte. Lieber mistete sie den Pferdestall aus oder schnitt Gras für die Ziegen. Darüber war Regine oft unglücklich und sogar böse.
Die Hase-Rosa war klein, bucklig und, ähnlich wie die Gustel, der Frau Rat gegenüber oft schmeichlerisch, doch zu den Kindern war sie nett. Sie hielt immer Vögel, die frei in ihrem Zimmer umherfliegen durften. Seit Iso erfahren hatte, daß einer davon ein Gimpel war, bewunderte sie diese Vögel noch mehr. Im ›Buch der Lieder‹ hatte sie gelernt: »Du bist ja hold den Gimpeln und heilest Gimpelschmerz.« Demnach mußte ein Gimpel wohl eine Art Paradiesvogel sein.
Die Hase-Rosa verdiente ihr karges Geld mit dem Flicken und Ausbessern von Kleidern. Sie konnte wunderbare Gruselgeschichten erzählen und hatte ein etwas hexenhaftes, aber für die Kinder irgendwie faszinierendes Lachen.
Iso sollte also Stricken bei ihr lernen. Das wurde ihr arg sauer. Der Topflappen, an dem sie sich mühte, wurde und wurde nicht größer, nur dunkler; Maschen fielen, das Ding sah aus wie ein Putzlappen. Wenn Rosas Geschichten nicht gewesen wären ...
Die waren seltsam, sehr verschieden, glichen einander insofern, als sie keine Pointe hatten. Iso wußte nicht, was eine Pointe ist, aber sie fragte oft am Schluß: »Und? Und dann? Was kam dann?« Dann wußte die Rosa aber nicht weiter.
Diese Gruselgeschichten hatte die Rosa alle selbst erlebt, wie etwa die, als sie an der Neiße entlanggegangen war: Da sah sie eine Frau, die Laub zusammenrechte (zusammenrechnete, sagte die Rosa, so sagten auch die Kinder in Schlesien, sogar in der Schule). Rings um einen Baum herum rechnete die Frau, aber nur so weit, wie die Baumkrone reichte. Und hinter sich her zog sie einen breiten, nassen Schwanz, obwohl es überall ringsherum trocken war. Man denke, einen nassen Schwanz! Und als das Weib sie, die Rosa, erblickte, war sie plötzlich verschwunden. Dieses Weib war die Wassernixe.
Iso hatte schaudernd zugehört. Mehr aber kam nicht.
Oder: Die Rosa war beim Pilzesuchen gewesen. Auf dem Heimweg ging sie an einer Hecke entlang. Es war schon dämmerig, und in der Hekke hing etwas Weißes. ›Vielleicht ein Taschentuch, das jemand verloren hat‹, dachte die Rosa, ›ich nehm’ es mir mit und wasch’ es aus.‹ Als sie aber in die Hecke griff, schlugen die Zweige über dem Weißen zusammen, und weg war es. Iso lief es kalt über den Rücken.
Etwas Schönes besaß die Hase-Rosa: ihre Hände. Sie hatte trotz ihrer kleinen Figur große, schöne, bewegliche Hände. Iso sah ihr gern zu, wenn sie spann. Die Hase-Rosa hatte nämlich auch ein Spinnrad.
Einmal sprach Großmutter mit ein paar zufälligen Besuchern über Hände. Iso saß mit einem Buch in der Fensterecke, las aber nicht, sondern lauschte dem Gespräch. Einer der Anwesenden sagte, Bucklige hätten oft schöne Hände, ausdrucksvoll und lebendig. Und nicht nur diese, auch Hexen. Die Großmutter erzählte, sie habe einen Holzschnitzer gekannt, der habe für eine Hexe – er schnitzte Marionettenfiguren – sicherlich ein halbes Dutzend Hände gearbeitet, ehe ihm ein Paar schön genug gewesen sei. Ja, auch ihre Flickfrau habe so schöne Hände.
Wie es manchmal so geht: Ein paar Tage später war Iso hingefallen. Sie hatte sich am Handballen eine Wunde gerissen und zeigte sie ihrer Großmutter. Der Großvater war auf Patientenbesuch.
»Komm, Kind, ich verbinde es dir. Nur wasch dir erst die Hände, wasch sie warm, um die Wunde herum. In die Wunde soll kein Wasser kommen.« Dr. Haberland war immer dafür, ausbluten zu lassen und dann erst zu verbinden. »Sonst wäscht man ja nur alles in die Wunde hinein.«
Iso gehorchte, die Großmutter nahm die verletzte Hand in ihre weichen, glatten, gepolsterten Hände, deckte die Wunde ab, wickelte schneeweißen Mull herum und steckte das Ende der Mullbinde fest.
»So. Morgen ist es heil. Was für schöne Hände du hast, Kind«, sagte sie, die Kinderhand in der ihren drehend. »Was wirst du mal damit anfangen? Bildhauerin werden oder modellieren? Oder –«
»Bucklig werden wie die Hase-Rosa«, zischte Alexander herüber, der der Unterhaltung gefolgt war. »Idiot wird sicher mal bucklig. Mutter sagt das auch. Immer steht sie krumm ...«
Daran war etwas Wahres. Iso war in der letzten Zeit sehr schnell gewachsen und hielt sich schlecht. Mutter Regine sah es mit Ärger. Dauernd hieß es: »Halt dich gerade!«
Überhaupt war Regine dieser Tochter gegenüber recht unduldsam. Alexander, ja, der machte ihr Freude, war gut in der Schule, spielte recht nett Klavier und hervorragend Schach. Iso dagegen hatte eine bockige und schwierige Zeit. Kümmerte sie sich etwa um ihr Schwesterchen? Keineswegs. Die Mutter hatte gehofft, Iso würde nun endlich ein richtiges Mädchen werden; sie würde die Kleine ausfahren, sich darum reißen, sie zu versorgen, kurzum, ein Hausmütterchen werden. Sie selbst hatte sich damals um die kleine Friederike gekümmert, obwohl der Stachel in ihrem Herzen immer ein wenig schmerzte, weil sie glaubte, daß die Eltern Friederike wohl mehr liebten als sie. Daß Iso keine Notiz von dem geliebten kleinen Mittelpunkt der Familie nahm, kränkte die Mutter.
Iso sah zu ihrem Bruder hinüber.
»Selber Idiot!« giftete sie. Alexander klopfte mit dem Knöchel des Zeigefingers an seine Stirn.
»Retourkutsche! Nee, der Idiot der Familie bist du. Immer schon und von nun an bis in Ewigkeit. Und jetzt wirst du auch noch bucklig.«
»Du bist gemein!« schrie Iso wütend. »Immer bist du so gemein zu mir –«
»Kinder, Kinder, gebt Ruhe«, mahnte die Großmutter, »man hört euch bis ...«
Es klopfte. Marie öffnete die Tür, nachdem die Großmutter ›Herein‹ gerufen hatte.
»Die Frau Prinzeß –«
Das fuhr Alexander und Iso in die Beine. Sie waren im Nu verschwunden, hinter dem schweren roten Vorhang, der den Erker von der Eßstube trennte. Die Prinzessin stand schon im Zimmer.
Sie war die Frau des Landrates in Frankenstein, eines Neffen des Kaisers und Bruders des Schloßbesitzers. Sie wohnte mit ihrer Familie auch dort im Schloß. Vier kleine Töchter hatte sie, von acht Jahren abwärts, keinen Sohn. Sonst hätte dieser das Schloß geerbt.
Die Prinzessin war jung und schön; sie trug große weiße Hüte wie die Kaiserin Auguste Viktoria und kümmerte sich um die Verwundeten. Iso und Alexander kannten sie. Die Prinzessin kam öfter zur Frau Rat, war reizend, immer weiß gekleidet, auch die Töchter. Wie kleine Märchenprinzessinnen, mit langen blonden Schlangenlocken, und – das erregte Isos größten Neid – sie hatten ein eigenes Pferd.
Der Prinz besaß sowieso Pferde, und die Prinzessin ritt anmutig und elegant im Damensattel, bewundert vom ganzen Dorf und allen Verwundeten. Den Kindern hatte der gute Onkel eine halbhohe Stute gekauft, Ferrah, auf der sie im Park am »Ende der Welt« reiten durften, einem runden Platz mit schönster Aussicht auf die Berge. Die Prinzessin und ein Reitknecht begleiteten sie, und die kleinen Mädchen stritten sich darum, wer das Pferd führen dürfe. Iso schlich oft hinterher und beobachtete, hinter Sträuchern verborgen, wie sie im Kreis trabten und galoppierten, und starb beinahe vor Neid.
Kam die Frau Prinzeß – sie ließ sich niemals »Königliche Hoheit« nennen, zumindest nicht von der Frau Rat, die sie sehr schätzte –, dann entflohen Alexander und Iso. Sie haßten es, wenn die Großmutter sie bat, sich um die kleinen Prinzessinnen zu kümmern, während deren Mutter bei der Großmutter saß. Mit sauren Gesichtern zogen sie mit dem kleinen Besuch in den Hof, Alexander machte sich sofort unsichtbar, und Iso zeigte den kleinen Mädchen ihre Karnickel. Es waren die einzigen Tiere, die ihr gehörten. Sie wünschte sich sehnlichst, aber vergeblich einen Hund. Mit Karnickeln konnte man nicht viel anfangen, aber den kleinen Prinzessinnen gefielen die Tierchen, sie streichelten und liebkosten sie. Manchmal erzählten sie von Ferrah.
»Wir haben auch ein Pferd«, sagte Iso dann schnell. Es war zwar nur ein Doppelpony, wie man damals sagte, ein Beutepferd aus dem Krieg. Der Großvater fuhr jetzt einspännig und kutschierte selbst, manchmal durfte Iso mitfahren. Davon erzählte sie stolz, auch, daß sie kutschieren durfte.
Eigentlich waren die kleinen Prinzessinnen recht nett. Sie bewunderten alles, was Iso ihnen zeigte, und erzählten von den Hunden ihres Onkels. Er hatte Möpse, die damals Mode waren.
»Einer ist im Park begraben, den hat Onkel sehr liebgehabt«, erzählten sie, »er hat einen weißen Stein auf seinem Grab, darauf steht:
›Hier ruht mein treuer Mops,
auch oft genannt die Moppe,
er teilte meinen Lebensweg von –‹
Die Zahlen weiß ich nicht. Darunter kommt noch:
›Erhöhte mir die Freude,
erhellte mir das Leid
durch stete Freundlichkeit.‹«
Das gefiel Iso. Aber einen Mops wünschte sie sich nicht, lieber einen Foxel. Die Foxel waren munter und zum Spielen aufgelegt, zum Toben und sogar zum Rattenfangen. Hier gab es viele Ratten, denn im Nebenhaus war ein Lebensmittellager, von dort kamen sie. Mutter Regine und Friederike grausten sich vor ihnen, Iso stellte Fallen auf. Der Großvater versprach für jede erlegte Ratte zehn Pfennig.
Eines Tages erschien Schorschel. Er trug eine Uniform, die ihm recht gut stand, und brachte seine Frau mit. Er hatte, wie es jetzt im Krieg üblich geworden war, ganz schnell geheiratet, ehe er an die Front mußte. Zwar war er erst Assessor, aber heute konnte man nicht warten, bis alles komplett war: der Beruf und die Wohnung, die Ausstattung und was sonst noch zu einer standesgemäßen Hochzeit gehörte. Er strahlte vor Stolz und Liebe.
Heidi, seine Frau, war gleichaltrig mit ihm und bereits berufstätig. Sie war Krankengymnastin und Masseuse. Iso fand das großartig. Alles an Heidi war braun, die kurzgeschnittenen Haare – etwas ganz Neues –, die Haut, braun und glatt, als käme sie soeben von der See, und wie lachten ihre Augen! Die waren allerdings nicht braun, sondern grün, schilfgrün, und sie trug auch ein Kleid in dieser Farbe. Diese Augen ...
»So was hat man im Mittelalter verbrannt«, sagte der Großvater und lächelte in diese Augen hinein, »man verbrannte nicht nur alte, krumme, scheußliche Hexen, sondern erst recht junge, schöne ...«
Schorschel war allerdings nicht nur gekommen, um seine Heidi vorzustellen, sondern fragte an, ob man sie ›brauchen‹ könne. Es gebe so viele Verwundete hier und da sei vieles, was in ihr Fach schlage, und ob sie vielleicht auch im Doktorhaus wohnen dürfe ...
»Natürlich darf sie«, sagte Großmutter sofort, »gern, gern, Schorschel! Dann haben wir eine Tochter mehr.«
Es war ihr auch insofern lieb, daß Heidi zu ihnen zog, als Regine und Friederike sich zur Zeit nicht recht verstanden. An wem es lag, der älteren oder der jüngeren, war schwer zu entscheiden. Vielleicht ging es zu dritt besser als zu zweit.
Nun war die Jugend im Haus um eine Person vermehrt, und um was für eine muntere! Heidi freundete sich sofort mit Friederike an, ließ die kleine Christiane nach dem Bad turnen, betreute Großmutters Ischias und lief mit Regine spazieren, wenn sie es zeitlich einrichten konnte.
»Vielleicht denken die Leute, das ist mein Kind«, sagte sie lustig, wenn sie den Kinderwagen im Geschwindschritt durch’s Dorf schob. Nun, die Leute waren wohl besser informiert über die Familie des Doktors, aber Freunde gewann Heidi sofort und überall. Sie wußte schon bald, wer ihr da zunickte, sie hörte zu, wenn man ihr von Krankheiten und Geburten erzählte, sie erteilte Ratschläge und griff zu, wo zuzugreifen war. Auch der junge Mediziner, Heinrich, wie er genannt wurde, sah sie bewundernd an. Er hieß eigentlich gar nicht so. Eines Tages war von Christianes Kinderwagen ein Rad abgefallen – kein Wunder bei Heidis Tempo –, und die Kinderkutsche hing schief.
»Heinrich, der Wagen bricht!« rief Heidi, und der junge Mann stürzte herbei, um zu helfen. Seitdem wurde er Heinrich genannt, und er ließ sich’s gern gefallen. Trug doch einer der Prinzen den Namen Friedrich Heinrich. Der andere hieß Friedrich Wilhelm. Beide Prinzen, hochgewachsen, sehr schmal, überzüchtet, wurden im Dorf sehr verehrt. Sie besaßen das erste Auto in Camenz, einen offenen schwarzen Wagen.
»Halli, hallo!« machte die Hupe. Die Kinder sangen nach der Tonfolge:
Halli, hallo,
mich beißt ein Floh,
ich weiß nicht wo,
bald hie bald do.
Die letzte Zeile war aus Rücksicht auf Eltern und Großeltern geändert und entschärft worden, denn eigentlich lautete sie anders. Aber Wörter wie dieses, das hierher gehört hätte, durften die Geistkinder nicht aussprechen.
Eines abends traten die Eltern – Vater Martin war auf Urlaub da – nachts an die Betten der Kinder, ehe sie selbst schlafen gingen, und unterhielten sich halblaut. Regine zog Alexander die Zudecke zurecht und entwirrte dann Iso, die wie immer verwickelt und merkwürdig verdreht in ihrem Bettzeug lag.
»Nie liegt sie ausgestreckt wie ein vernünftiger Mensch, immer zusammengedreht und krumm. Und ich sag’ ihr jeden Abend, sie solle sich gerade auf den Rücken legen. Meinst du, daß sie krumm wird?«
»Verwachsen? Da sei Gott vor!« sagte Martin erschrocken. »Gibt es in eurer Familie Bucklige?«
»Ich wüßte keinen. Aber sie hat auch solche Hände, so schöne Hände, aber –«
»Weil Bucklige oft schöne Hände haben? Aber damit ist doch noch nicht gesagt –«
Iso schlief nicht. Sie tat nur so. Ein heißer Schreck fuhr ihr durchs Herz. Bucklig werden! Vielleicht fand Alexander sie so häßlich, weil man es schon merkte?
Im Dominium, das zum Schloß gehörte, gab es noch eine Bucklige, die Tochter des Verwalters. Sie war ein paar Jahre älter als Iso, nicht so klein wie die Hase-Rosa, aber auch sie war verwachsen. Sabine hieß sie, war freundlich und lachlustig und wurde allgemein Bine genannt. Obwohl Bine bei jedermann beliebt war, quälte sich Iso bei dem Gedanken, daß sie so werden könne wie Bine. Sie vergaß nie, was die Eltern gesagt hatten, versuchte jeden Abend, gerade auf dem Rücken liegend einzuschlafen, und wachte verkrümmt und zusammengerollt wieder auf. Niemand hatte eine Vorstellung davon, wie sie sich ängstigte und litt.
Es war überhaupt eine dunkle Zeit. Der Krieg wurde immer härter. Gasvergiftete Verwundete kamen ins Lazarett, übermüdete, kaputte, hoffnungslose Landser. Heidi wurde oft zwölf Stunden am Tag eingesetzt, um mit den Beinamputierten das Gehen zu üben, und kam erschöpft und todmüde heim. Friederike wurde von den Eltern nach langem Überlegen in ein Internat nach Gnadenfrei geschickt, es ging und ging nicht mit den beiden Schwestern. Und dann kam die Grippe.
Erst hieß sie die Spanische Grippe und dann Influenza. Es war erstaunlich, wie schnell auch auf dem Lande, wo es immer noch mehr zu essen gab als in der Stadt während der Steckrübenwinter, die Menschen geschwächt und schnell umgeworfen wurden. Viele starben. Die Ärzte, überfordert, versuchten der Krankheit Einhalt zu gebieten, aber auch in die Arzthäuser drang sie ein, diese neue Geißel Gottes. Im Haberlandschen Haus war es Iso, die am heftigsten von ihr befallen wurde. Sie fieberte hoch, phantasierte, behielt nichts bei sich und wurde von den schrecklichsten Träumen geplagt. Aber damals merkte sie, daß ihre Mutter Regine auch sie zu lieben schien. Einmal wachte sie auf und sah die Mutter an ihrem Bett sitzen und weinen.
»Was ist denn?« fragte sie erschrocken.
»Ach ich – ach Iso –«, die Mutter hielt inne. Iso war tief erschrocken. Nach einer Weile fragte sie halblaut, schüchtern, gewöhnt, als das kleine Dummerle angesehen zu werden: »Du, Mutter, wenn man jemanden küßt, der die Grippe hat, kriegt man sie dann selbst?«
»Das kann schon sein«, erwiderte die Mutter.
»Und der andere wird gesund? Man küßt sie ihm ab?« fragte Iso weiter.
»Ach nein, Isokind, leider nicht. Wie gern würde ich sie dir abküssen«, flüsterte die Mutter.
Das vergaß Iso nie. Mutter mußte wohl auch sie gern haben, nicht nur den hübschen, gescheiten älteren Bruder und das süße kleine Knuddelkind.
Auch Großmutter wurde krank. Großvater ging es schon eine Weile schlecht, doch er sprach nicht darüber, er gehörte zu den Ärzten, die die eigene Krankheit leugnen; er operierte noch mit neununddreißig Grad Fieber. Kurzum, es war eine Zeit voller Ängste.
Regine, auch überfordert, achtete wenig auf Iso, und so stand diese zu zeitig auf, angeblich, um der Mutter keine Mühe zu machen. Die Folge war ein übler Rückfall. Sie mußte wieder ins Bett, keiner hatte Zeit für sie, Alexander, vorläufig noch gesund, nützte die Zeit ohne Aufsicht und trieb sich im Dorf herum.
In den Zeitungen standen schlimme Dinge. Großvater, der viel über Politik sprach, erging sich in den düstersten Prophezeiungen. Er sollte recht behalten.
Iso lag in der ›Martinsklause‹, wie das Zimmer genannt wurde, in dem Martin gewohnt hatte, und war viel allein. Über ihrem Bett hing eine quadratmetergroße Deutschlandkarte, die Karte des Deutschen Reiches von damals, von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt. Unvergeßlich prägte sich ihr die Gestalt dieses Landes ein, die Zipfelmütze des schmalen Memellandes, die Verbindung Ostpreußens mit dem Reich, die dann sehr bald durch den polnischen Korridor unterbrochen werden sollte, Schlesien, herausragend in der Gestalt eines Eichenblattes, mit dem kleinen, viereckigen Auswuchs, der Grafschaft Glatz. Die Oder, ihre Nebenflüsse – Oppa, Zinna, Hotzenplotz – diese hatten sie in der Schule auswendig lernen müssen. Iso schaute und schaute, und wenn sie einschlief, sah sie noch immer das Land vor sich. Es war, als sollte sie Abschied nehmen und es sich deshalb noch einmal ganz fest einprägen, für immer, für ihr ganzes Leben. Deutschland und Schlesien, ihre Heimat.
Abschiednehmen tut weh. Iso weinte oft, aus Schwäche, aus Angst vor der Zukunft, in der sie sich bucklig sah, aus einem Gefühl der Verlassenheit heraus. Einmal fand Heidi sie so. Heidi, die ihr erstes Kind erwartete und dadurch noch stärker, noch positiver, noch zukunftsgläubiger war als sonst, setzte sich erschrocken und voller Mitleid an Isos Bett, nahm deren fieberheiße Hände in die ihren und lächelte in Isos Augen hinein.
»Iso, Isomädchen, wer wird denn weinen! Komm, sag mir, was los ist. Sag es mir. Du bist nicht allein.«
Ein Strom von Tränen. Aber bereits der tat wohl. Heidi ließ sie weinen.
»Ich hab’ so Angst ...«
»Wir jagen die Angst fort. Ich helf’ dir dabei. Was glaubst du, welche Angst die Verwundeten haben, daß sie wieder an die Front müssen oder geschädigt und nicht mehr voll arbeitsfähig entlassen werden! Grad heute las ich in einem zerfetzten Buch, das ein Soldat jahrelang im Tornister mitgeschleppt hatte, durch alle Schrecklichkeiten der Front:
Laß doch das Sorgen sein,
das gibt sich alles schon,
und fällt der Himmel ein,
kommt doch eine Lerche davon.
Es ist von Goethe. Glaub mir, auch damals gab es Gründe, Angst zu haben. Das gab es immer, in jedem Jahrhundert. Wir sind keine Ausnahme.«
»Ach Heidi, du – ja du! So schön, wie du bist! Aber ich – ich werde bucklig –« Jetzt war es heraus. Iso hatte es bis dahin niemals ausgesprochen.
»Du, bucklig? Wie kommst du denn auf die Idee?«
Nun endlich war die Schleuse geöffnet. Iso schluchzte und schluchzte. Und unter dem stoßweisen Weinen kam zutage, was sie ängstigte: Sie habe gehört, wie ihre Eltern sich unterhalten hätten, daß sie würde wie die Hase-Rosa oder wie die Bine, keiner würde sie liebhaben, nie würde sie heiraten und Kinder bekommen ...
Heidi ließ sie erst einmal alles herausweinen, ohne ihre Hände loszulassen. Als nichts mehr kam, legte sie ihr Gesicht an Isos Wange, ganz dicht, ganz nahe.
»Hör zu, Iso, ich erzähl’ dir was«, sagte sie leise. »Mir ist es ähnlich gegangen. Nicht, weil mir jemand prophezeit hat, was deine Eltern gesagt haben – sie sagten bestimmt nicht, du würdest verwachsen, sondern befürchteten es nur –, bei mir war es anders. Ich bin mal dumm gestürzt, ganz dumm, von einem Wagen herunter – und hab’ mir die Wirbelsäule verletzt. Ich mußte ein halbes Jahr in Gips liegen. Ich sag’ dir, das war eine Qual. Und niemand weit und breit konnte mir sagen, ob ich mich wieder würde bewegen können wie vorher. In diesem halben Jahr hab’ ich gelernt, trotzdem zu hoffen, zu beten, nicht aufzugeben. Und als ich aus dem Gips herauskam und Übungen machen mußte, die mir sehr, sehr schwerfielen, da hab’ ich gelernt zu wollen. Und wenn man beten und hoffen und wollen gelernt hat, so schwer es einem auch fällt, dann hat man schon gewonnen. Willst du es versuchen?«
»O Heidi!«
»Sieh mal, ich bin den ganzen Tag mit Männern zusammen, die verletzt sind. Die meisten von ihnen wissen nicht, ob sie wieder gesund werden. Da ist mancher, der aufgeben möchte. Immer, immer muß ich dagegenhalten, trösten, ermutigen. Es gibt eine chinesische Geschichte, da jammert ein Mann, weil er keine Schuhe hat. Und dann trifft er einen, der hat keine Füße.
Du hast noch alles, Isokind, was man zum Leben braucht, und sollte sich wirklich herausstellen, daß du eine Neigung hast, nicht ganz gerade zu wachsen – ich sage: sollte; ich selbst glaube es nicht, und ein bißchen von diesem Handwerk verstehe ich ja auch –, dann kann man mit Hoffen und Wollen viel erreichen. Viel? Alles! Berge versetzen. Glaubst du mir das?«
Iso sah sie an, die geliebte und bewunderte Freundin. Frisch und jung, stark und gläubig saß sie da auf dem Bettrand, leuchtend und schön. Iso wußte, daß sie ein Kind erwartete, sie hörte sie früh im Bad röcheln und würgen. Wenn sie herauskam, wischte sie sich Augen, Mund und Nase und lachte: ›So, das hätten wir wieder mal!‹ Und ihre warmen, trockenen, starken Hände taten so wohl.
»Ich will werden wie du, Heidi«, sagte Iso voller Begeisterung. Heidi lachte und gab ihr einen Kuß auf die Nasenspitze.
Eines Tages kam der Großvater von einem Krankenbesuch zurück und brachte einen Hund mit, einen halberwachsenen, schwarzweißen, sehr schmutzigen Foxterrier.
»Da, zum Rattenfangen«, sagte er und ließ ihn in die Eßstube springen. Der kleine Hund lief zielbewußt auf die Großmutter zu und sprang mit einem Satz auf ihren Schoß. Dort blieb er sitzen, an sie gekuschelt, und hob das Schnäuzchen zu ihr empor.
»Ach lieber Gott, du kleines Kerlchen!« sagte sie und lächelte ihn an. Sie machte sich nicht viel aus Hunden, aber alle Hunde liebten sie. Immer liefen sie sofort zu ihr, wenn Dr. Haberland einen anbrachte.
Im Doktorhaus hatte es immer Hunde gegeben, meist größere wie Hektor und Nimrod und Loki. Einer hieß Fafnir, schon als sie ihn bekamen, und der Großvater rief ihn auf gut schlesisch ›Nirdel‹, was Großmutter nicht sehr passend fand.
»Nirdel – wenn du das auf der Straße rufst!« sagte sie leicht entrüstet. »Entweder die Leute denken an einen Nierenbraten oder an eine Operation.«
Iso kannte alle Geschichten, die Großmutter von früheren Hunden erzählte. Wie die Hunde den heimkehrenden Doktor begrüßten, wie Loki, wenn Großvater »Potschen!« rief, sogleich ins Schlafzimmer schoß und die warmen Hausschuhe holte, einen nach dem andern, und dem Herrchen brachte. Großvater war gut Freund mit den Hunden, verwöhnte sie aber, statt sie zu erziehen. Bei Tisch stellte er, wenn er satt war, seinen Teller mit den Resten auf die Erde, und der jeweilige Hund fraß ihn leer. Er als Arzt!
»Jesses, Rudolf, das kannst du doch nicht machen!« schalt die Großmutter und gab der hereinkommenden Marie einen Wink, diesen Teller nachher extra und doppelt abzuwaschen.
»Jesses, Rudolf!« hörten die Kinder manchmal. Es war Großmutters halb resignierter, halb amüsierter Ruf, nie klang er aggressiv, immer irgendwie verdeckt zärtlich. Auch der Großvater hatte einen Standardseufzer, der aber klang oft verzweifelt, vor allem wenn er die Zeitung gelesen hatte und sie fortwarf. »Ach Jerusalem!«
Als Iso aus der Schule kam, stürzte sie sich sogleich auf den Hund.
»Gehört er uns?« juchzte sie entzückt. »Wie heißt er denn?«
»Schuftel«, sagte Großmutter.
»O Schuftel, mein Schuftel! Darf ich ihn baden?« Die ganze Liebe, die Mutter bei Iso der kleinen Schwester gegenüber vermißte, häufte die Tochter nun auf den Hund.
»Aber Ratten muß er fangen, hörst du!« sagte Großvater. »Sonst kommt er wieder weg!«
»Er wird schon«, sagte Iso, als kenne sie ihn bereits seit Jahren.
So wurde Schuftel Isos Hund.
Die Liebe zu ihm überstieg bei ihr alle Grenzen. Damals bereits wuchs in Mutter Regine die Sorge um dieses Kind, das so leidenschaftlich zu lieben vermochte. Ihr Vater nannte es ›hemmungslos‹, ohne zu verstehen, daß Iso sehr wohl gehemmt war, weil sie in der Familie die problematische Stellung des mittleren Kindes einnahm. Regine, deren Leben bürgerlich und in gemäßigten Grenzen verlief, entsetzte sich über die Leidenschaft, zu der Iso fähig war.
»Sie muß streng gehalten werden«, meinte sie und nahm sich vor, so zu handeln. Iso sollte dies ihre ganze Jugend über spüren.
Die Mutter begann sofort, ihre Vorsätze auszuführen. Es kam zum Beispiel nicht in Frage, daß der Hund in Isos Zimmer schlief. Er würde ins Bett wollen; das durfte keinesfalls geschehen. ›Dürfen‹ oder besser ›nicht dürfen‹ wurde für Jahre der Tenor in Isos Leben.
Die Liebe zu diesem Hund war wahrhaftig grenzenlos. Immerzu saß er auf Isos Schoß; sie sprach mit ihm in einer nur ihr und ihm verständlichen Sprache und dichtete ihm die seltensten Eigenschaften an. Schuftel war ein intelligentes Tier und wurde durch die intensive Berührung mit einem Menschen noch wacher und aufmerksamer als ein normaler Hund. Er kannte Isos Schritt, wenn sie aus der Schule kam, und rannte ihr entgegen, sprang an ihr hoch und quiemte und hechelte vor Wonne. Er konnte sehr bald ›schön machen‹ und ›Pfote geben‹, sich tot stellen und durch einen Reifen springen, den Iso ihm hinhielt. Er stieß auf Befehl das Schaukelpferdchen an und lief auf den Hinterpfoten, wenn Iso es verlangte. Nur eines tat er nicht: Ratten fangen. Das machte Iso Sorge. Großvater hatte gesagt: »Ratten muß er fangen, sonst kommt er weg.« Wie brachte man das dem Hund bloß bei?
Eines Tages schien die Gelegenheit da. In der Futterkammer befand sich ein leeres Faß, in dem Hafer oder ein anderes Futtermittel gewesen war. Darin rannte eine Ratte herum, die verzweifelt nach einem Ausweg suchte. Iso glaubte, eine Chance zu sehen, und rief Schuftel. Sie zeigte ihm die Ratte, neigte die Tonne ein wenig und machte dem Hund ein Zeichen hineinzuspringen. Sie nahm fest an, er würde sich jetzt auf die Ratte stürzen und sie erlegen. Wenn sie ihn dann loben und belohnen würde, wäre der Anfang gemacht. Foxterrier wurden ja auch Rattler genannt.
Weit gefehlt! Die Ratte fauchte und schoß auf den viel größeren Gegner los, sprang ihn an, biß ihn seitlich in die Lefze, so daß er aufjaulte, und schon rasten die beiden über den Hof, Schuftel voran, den Schwanzstummel eingezogen, die Ratte hinterdrein.
Dieses Ereignis wurde für Schuftel zum Trauma. Er war noch jung, und es war seine erste Begegnung mit einer Ratte gewesen. Von nun an nahm er Reißaus, wo immer eine Ratte erschien – es gab ja so viele! Der Kutscher trat frühmorgens manchmal auf eine Ratte, wenn er seine Treppe herunterstieg. Die Scheusale waren unglaublich frech. Das Schwein, das in einem Nebengelaß des Pferdestalles lebte, wurde nachts von ihnen angeknabbert, während es schlief. Morgens flog der Marie, die zum Füttern kam, das Blut des Tieres entgegen, als es den Kopf schüttelte: sie hatten seine Ohren angenagt, ohne daß es erwacht wäre.
Dieses Ereignis hatte Folgen.
»Da muß der Köter ran!« sagte der Großvater, als man es ihm erzählte, und Iso erschrak furchtbar. Jetzt mußte es kommen!
Und es kam.
»Wenn der Kerl nicht unter den Biestern aufräumt, muß er weg. Wozu haben wir ihn denn!«
Wütend stampfte er aus der Eßstube. Iso war in den Erker geflüchtet und erstickte dort ihr Weinen, damit die Großmutter es nicht hörte. Die Angst um ihren Liebling zerriß ihr das Herz. Was aber konnte sie unternehmen, um ihn zu behalten?
Die Zeiten wurden immer dunkler. Iso vergaß es nie: Sie turnte außen am Treppengeländer im Flur, versuchte dort hinaufzuklettern, wo die hellgrauen Steinstufen ein ganz klein wenig hervorragten. Innen auf der Treppe stand Rudi, Sohn des Kurzwarenhändlers zwei Häuser weiter. Er ging in ihre Klasse. »Der Kaiser ist weg«, sagte Rudi.
Iso sagte erst nichts. Daß dies etwas Schreckliches bedeutete, merkte sie an Rudis Ton. Scheu flüsterte sie: »Wer sagt denn das?«
»Der Kurt hat’s mir erzählt.«
Der Kurt war Rudis älterer Bruder. Er ging schon in die Oberklasse beim Kantor wie Alexander – Iso und Rudi waren noch in der Mittelklasse bei Frau Reimann. Herr Reimann war eingezogen. Daß die beiden großen Brüder klüger waren, sah Iso ein. Aber weg?
»Ist er tot?« fragte sie scheu.
»Nee, weg«, antwortete Rudi. Iso konnte sich das nicht vorstellen.
Der Kaiser weg? Der, für den alle kämpften und so viele gefallen waren?
»Gefangengenommen?« fragte sie noch.
»Nee, ausgerissen.«
Am nächsten Tag stand es in der Zeitung. Großmutter und Mutter hatten verweinte Augen. Iso wagte nicht zu fragen. Auch Alexander fragte sie nicht. Ob der Krieg nun verloren sei, ob die Franzosen einmarschieren würden, ob alle Häuser abgebrannt werden müßten? Ratlos blieb sie allein und verstand die Welt nicht mehr.
Gern hätte sie Heidi gefragt. Aber Heidi lebte nicht mehr im Doktorhaus. Schorschel, ihr Mann, war in englischer Gefangenschaft, daher war sie zu Tante Mieke, seiner Mutter, nach Patschkau gezogen, um sie zu pflegen. Hanna, seine Schwester, war Lehrerin, aber sie wohnte nicht in Patschkau.
Eines Tages, als Großmutter und Mutter Besuch hatten, stahl sich Iso aus dem Haus. Sie hatte insgeheim Radfahren gelernt und sich das Fahrrad einer Mitschülerin ausgeborgt, mit dem sie die neun Kilometer nach Patschkau bewältigen wollte – sie hatte solche Sehnsucht nach Heidi! Schuftel lief mit, es war ein trockener, sonniger Spätherbsttag, und Iso fühlte sich irgendwie erleichtert, einmal von zu Hause fort zu kommen.
Auf halbem Wege begegnete sie einem älteren Mann, der sie nach dem Weg fragte. Iso stieg ab, sie wollte ihm Bescheid sagen und die Richtung erklären. Da trat er nahe zu ihr hin, näherte sein Gesicht dem ihren – er stank aus dem Mund –, faßte sie an, erst mit beiden Armen, dann mit einem, drückte sie fest an sich und fuhr mit der andern Hand unter ihr Kleid. Iso, völlig unwissend bezüglich dessen, was er vorhatte, versuchte sich zu befreien. Sie schrie aber nicht, was, ohne daß sie es ahnte, ihr Glück war. Sonst hätte er ihr wohl die Kehle zugedrückt.
»Lassen Sie mich los! Was wollen Sie denn von mir?«
»Das wirst du schon merken!« keuchte der Mann. Er zerrte jetzt am Ausschnitt ihres Kleides und fuhr mit der Hand hinein. In diesem Augenblick fühlte Iso, daß sein Griff lockerer wurde, und gleich darauf hörte sie einen gurgelnden Schrei.
»Mistvieh, elende verdammte Lerge«, stöhnte der Mann, und da begriff sie, daß Schuftel eingegriffen hatte. Er hing mit dem Maul am Arm des Mannes, mit festem Biß, riß und riß – der Angefallene schrie vor Schmerz und Wut, ließ Iso aber nicht los. Sie verstand endlich, daß er ihr Böses wollte, und versetzte ihm mit dem Knie einen Stoß vor den Bauch – und war im Augenblick frei. Sie hob das Fahrrad, das auf der Erde lag, hoch, schob es zwei Schritte vor und sprang dann in den Sattel, wie wild in die Pedale tretend. Der Hund hielt den Mann, der nach dem Gepäckträger greifen wollte, um sie aufzuhalten, in Schach, der Griff ging daneben, und schon war Iso ein paar Meter entfernt. Sie fuhr davon wie eine Rasende.
»Schuftel, komm mit!« rief sie noch und merkte, daß ihr die Tränen kamen. Der Hund gehorchte. Nebeneinander jagten sie die Landstraße entlang, bis sie zu einer Kurve kamen und Iso, rückblickend, den Kerl nicht mehr sah. Da stieg sie ab; sie fühlte, wie ihre Knie einknickten, hielt sich mit Mühe aufrecht und lief ein paar Schritte, während sie das Fahrrad schob, saß wieder auf und fuhr weiter. Gottlob, jetzt sah sie die Häuser eines Dorfes, oder war das schon der Anfang von Patschkau?
Heidis Wohnung war nicht leicht zu finden. Als sie endlich dort angelangt war und Heidi auf ihr Klingeln öffnete, war Iso so erschöpft, daß sie der andern nur schluchzend um den Hals fallen, aber kein Wort herausbringen konnte. Heidi merkte, daß etwas Schlimmes geschehen war, zog Iso ins Zimmer, packte sie in einen Sessel und holte zuerst den Kognak, der in der Flasche auf Schorschels Rückkehr wartete, sonst respektiert, aber hier als nötig erkannt wurde. Iso schluckte und hustete, er brannte ihr in der Kehle, aber die Tränen versiegten. Während sie sich das Gesicht abwischte und die Nase putzte, hatte Heidi schon einen Tee aufgebrüht und Honig hineingerührt. Als Iso den Tee getrunken hatte, wurde ihr besser. Heidi blieb bei ihr, Tante Mieke lag, wie Heidi sagte, im Nebenzimmer auf dem Sofa. Das war gut. In ihrem Beisein hätte Iso ihr Erlebnis nie erzählen können. So aber kam sie, wenn auch stückweise und manches nur andeutend, dazu, Heidi über das zu informieren, was sie so außer sich gebracht hatte, und Heidi fand die richtigen Worte. Dieser Mann sei sicherlich Soldat gewesen und habe jahrelang kein Mädchen gesehen, vielleicht war er auch betrunken ...
»Ja, er roch so«, flüsterte Iso.
»Und Betrunkene sind immer gefährlich –«
»Ich fahr’ nicht zurück! Vielleicht lauert er auf mich«, jammerte Iso, aber auch hier wußte Heidi tröstlichen Rat.
»Wir rufen in Camenz an, daß du erst morgen kommst. Ich würde ja gern mit dir fahren, aber du weißt ja, ich hab’ zwei kleine Kinder, Caspar und Mutter.« Sie hatte ihren Sohn Caspar genannt, ein Name, den Iso wunderbar fand. Heidi holte jetzt das Kind ins Zimmer, und Iso vergaß über dem strammen kleinen Pausback ihre Angst.
Freilich, das spätere Gespräch mit der Mutter bedrückte sie sehr. Regine war höchst ungehalten, als man sie endlich erreicht hatte: Iso solle auf jeden Fall noch am gleichen Abend heimkommen. Notfalls mit der Bahn. Als Heidi erwiderte, es gehe kein Zug mehr, schalt Regine noch mehr. Schließlich wurde beschlossen, daß Heinrich, der junge Mediziner, hinüberfahren und Iso heimbegleiten solle. Dabei war noch kein Wort von dem Überfall erwähnt worden, und Iso bat inständig, ihn zu verschweigen. Heidi versprach es ihr. Heinrich erschien endlich auf einem geborgten Fahrrad, aber Iso klammerte sich an Heidi und wollte nicht fort, verstört, wie sie war. Heidi hatte große Mühe, sie zu beruhigen. Und was es mit dem Kaiser auf sich hatte, hatte Iso auch noch nicht gefragt.
Zu Hause gab es schlimme Vorwürfe von Mutter Regine, mit Tränen auf beiden Seiten.
»Nie wieder tust du so etwas! Allein wegzufahren! Wir haben Sorgen genug. Radfahren gibt es von jetzt an nicht mehr. Ich habe mir selbst immer ein Fahrrad gewünscht und nie eines bekommen, du wirst das auch überleben.«
Alexander stand mit glitzernden Augen dabei und verfolgte das Strafgericht mit Schadenfreude.
Am nächsten Tag kam es noch schlimmer. Der Mann, der Iso belästigt hatte, besaß die Frechheit, zum Großvater in die Sprechstunde zu kommen und seinen Arm zu zeigen.
»Ihre Hundelerge war das, ich zeig’ Sie an!«
Großvater gab ihm eine Tetanusspritze und versorgte die Wunde, dann schickte er den Mann weg und nahm Iso vor.
»Dazu ist der Hund nicht da, daß er mir Patienten ins Haus bringt«, grollte er. »Er tut doch sonst keinem was! Wie kam er dazu, diesen Kerl zu beißen?«
Daß er ›diesen Kerl‹ sagte, erleichterte Iso ein wenig. Aber sie brachte es nicht über sich zu berichten, wie die Sache wirklich gelaufen war, sondern heulte und heulte nur.
»Alexander radelt ja auch heimlich, das heißt, Mutter weiß es, aber dagegen hat sie nichts«, schluchzte sie. Und da sagte der Großvater, der sonst immer zu ihr hielt, den Satz, den sie nicht hören mochte: »Ja, der ist aber auch ein Junge!«
Welche Schmach, nur ein Mädchen zu sein!
»Wenn der Hund nur Ärger ins Haus bringt und nicht mal Ratten fängt, kommt er weg«, sagte Mutter Regine noch, als der Großvater Iso mit einem schon wieder liebevollen Klaps aus dem Sprechzimmer geschoben hatte. Iso antwortete nicht.
Von da an war das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter noch schwieriger. Iso galt als verbockt und verstockt. Selbst das sanfte Mahnen der Großmutter, das Kind komme jetzt in die Entwicklungsjahre, nützte nichts. Das Wort Pubertät wurde damals noch nicht gebraucht, bestimmt nicht von Laien. ›Unausstehlich‹, ›nimm dich zusammen‹, ›so war ich nie‹ hörte Iso jeden Tag. Dazu die Angst um den geliebten Hund. Iso sann und sann, wie sie es fertigbringen könnte, ihn zu behalten. Schließlich hatte sie eine Idee.
Sie hatte nie aufgehört, Rattenfallen zu stellen. Jetzt sagte sie sich: Wenn nur mit den Räubern aufgeräumt wird, ist es schließlich egal, wie. Warum sollte sie die Ratten, die sie in den Fallen erlegte, nicht als Schuftels Jagdbeute erklären? Nur merken durfte es keiner, vor allem nicht Alexander. Der würde sofort diese Mogelei an die große Glocke hängen und dem Großvater erzählen, was Iso da ausgeheckt hatte. Er stellte sich immer sehr tugendhaft, wenn es Isos Fehler betraf, während er selbst Mutter und Großeltern fröhlich belog. Und zwar log er mutig und ausdauernd, gab nie zu, wenn er ertappt wurde, nach der Devise, die er einmal von Schorschel gehört hatte: ›Man braucht eine Lüge nur unentwegt zu wiederholen, so wird sie geglaubt. Versuch das mal mit der Wahrheit!‹ Iso dagegen litt unter ihrem schlechten Gewissen und sehnte sich danach, beichten zu dürfen. Das aber durfte sie nicht, wenn sie Schuftel nicht verlieren wollte.
Dazu kam, daß die Großmutter in diesem Jahr nichts von Weihnachten wissen wollte. Weihnachten war für die Geistkinder von jeher der Höhepunkt des Jahres gewesen, die Großmutter aber sagte, nach einem verlorenen Krieg dürfe man nicht feiern. Hier erwies sich Regine als energisch. Sie ging selbst zur Forstmeisterei und besorgte einen Christbaum. Alexander und Iso atmeten auf. In diesem Fall waren sie einer Meinung. Und Regine fand, auch Christiane habe ein Recht auf ihr Christkind.
Vater Martin war noch nicht zurück, so blieb Regine mit den Kindern in Camenz: ›Bis auf weiteres.‹ Den Kindern war es nur recht. Sie fühlten sich mehr und mehr in Schlesien zu Hause, und auch die Nach-, besser Vorhilfestunden in Französisch und Mathematik, die sie von Frau Reimann erhielten, störten sie wenig. Sie befanden sich jetzt im Alter für die höhere Schule, machten sich aber keine Sorgen um die Zukunft in Leipzig. Auch Regine sorgte sich nicht darum, sie war überzeugt, daß Alexander überdurchschnittlich begabt sei und meinte, für die Tochter sei die Schule nicht so wichtig. Sie selbst hatte ja auch keine höhere Schule besucht.
Christiane war inzwischen zu einem hübschen, gepflegten Kleinkind herangewachsen. Da sie ständig betreut wurde – entweder von Mutter oder Großmutter –, machte ihre Erziehung keine Schwierigkeiten. Aber die Mutter stellte laufend Vergleiche mit der größeren Tochter an: ›Christiane ist artig‹, ›Christiane hält sich sauber‹, ›wie kann man nur so aussehen wie du, Iso‹, ›Christiane wird nie so werden –‹ hörte Iso immer wieder – was ihre Zuneigung zur Mutter nicht verstärkte. Als Friederike dann heimkam, schloß sie sich an diese an. Am liebsten aber hatte sie Heidi, doch die kam nur selten. Tante Mieke ging es schlecht, und Schorschel war noch nicht heimgekehrt.
Friederike war sehr schön geworden. Nicht sehr schlank, was zu jener Zeit noch nicht Mode war, aber blühend, mit den schönsten Farben, das dunkle Haar gelockt, so ging sie durchs Dorf, besuchte Lore Dempe, die inzwischen eine quicklebendige Tochter bekommen hatte, und wurde nicht nur von Gustel und Hase-Rosa, sondern eigentlich von jedem im Dorf bewundert und verehrt.
Eines Tages erhielt sie eine Einladung aus Neustadt in Oberschlesien, dem Ort, aus dem ihr Vater stammte. Dort gab es noch viel Verwandtschaft von Haberlands. Fritz Haberland, aus dem Krieg zurück, bewirtschaftete das Stadtgut dort, das die Größe eines Rittergutes besaß; seine Eltern lebten noch, ein Bruder war gerade mit dem Studium der Tierheilkunde fertig, Schwestern gab es auch. Friederike sträubte sich, die Einladung anzunehmen. Sie trug den Eltern immer noch nach, daß diese ihre Verlobung mit jenem jungen Lehrer durchkreuzt hatten, obwohl es keine allzu leidenschaftliche Liebe von ihrer Seite aus gewesen war. Sie weigerte sich zu fahren.
»Du tätest uns einen großen Gefallen«, sagte Vater Haberland, »es sind alles mehr oder weniger nahe Verwandte von uns, und wir haben uns nie um sie gekümmert. Wenn sie uns jetzt die Hand reichen ...«
Er beschäftigte sich in den knappen Stunden, die ihm neben dem Beruf blieben, seit einiger Zeit viel mit Ahnenforschung, und die Haberlands waren eine weitverzweigte Sippe.
»Ihr wollt bloß, daß ich den Fritz heirate«, sagte Friederike wütend, »aber da könnt ihr lange warten. Ich lass’ mir meinen Mann nicht aufzwingen und von den Eltern aussuchen. Wir leben ja nicht mehr im Mittelalter.« Sie las Alexander und Iso abends vor, nun nicht mehr aus dem alten Märchenbuch, sondern aus einer Folge von Bänden mit dem Titel »Am deutschen Herd«, woraus man Geschichte lernte. Da opferten sich die Mädchen für die Eltern, indem sie einen reichen Schwiegersohn anbrachten, den sie nicht liebten, oder sie gingen ins Kloster. Iso fand das alles sehr spannend. Alexander hörte auch zu, aber ihn interessierte mehr die Zeitgeschichte. Er las längst die Zeitungen und focht mit Großvater wilde Debatten aus. Dabei spielten die »Ultramontanen« eine große Rolle. Immer wieder hörte Iso dieses Wort, unter dem sie sich nichts vorstellen konnte, und erlebte die wütende Verzweiflung ihres Großvaters, wenn er die Zeitung gelesen hatte und sie fortwarf.
»Jesses, Rudolf«, hörte sie die Großmutter seufzen.
Und dann kam eines Tages Vater Martin zurück.
Aus dem lustigen Sachsen, der die »Fledermaus« gesungen hatte, war ein ernster, verantwortungsbewußter Mann geworden, der sich um seine Familie sorgte. Nach kurzem Aufenthalt bei den Schwiegereltern, die meinten, er müsse sich erst erholen, fuhr er nach Leipzig und verhandelte mit dem Bibliographischen Institut, das ihn sogleich wieder anstellte. Zu Beginn des neuen Schuljahres würden Geists wieder nach Leipzig ziehen.
Inzwischen hatte sich in Neustadt in Oberschlesien einiges getan. Das Haberlandsche Gut lag am Rande der Stadt, und man betrieb neben der Landwirtschaft feldmäßig Gemüsebau, der viel einbrachte. Das Gut umfaßte über fünfhundert Morgen Land, fünfzig Kühe und sechs Pferde, dazu noch eine Ziegelei. Der junge Landwirt Fritz war groß, breit und weißblond; durch die Kriegsjahre war er erwachsener als andere junge Männer seines Alters. Er verliebte sich auf der Stelle in die ziemlich weitläufig verwandte Cousine, die schöne Arzttochter, die den gleichen Namen trug wie er. Und sie verliebte sich in ihn. Binnen kurzem kam sie für einen Tag nach Hause und rief als erstes den Eltern zu:
»Ich hab’ mich mit Fritz verlobt. Nie hätte ich gedacht, daß ich einen Menschen so liebhaben könnte wie ihn!«
Die Eltern waren zufrieden. So kamen sie doch noch zu dem heißersehnten Sohn Fritz, den sie vor zwanzig Jahren erwartet hatten.
»Wir sind Glückskinder«, dachte Mutter Haberland und faltete die weichen, weißen, gepolsterten Hände.