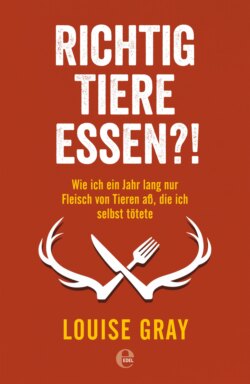Читать книгу Richtig Tiere essen?! - Louise Gray - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Perlen
Оглавление„Ihr dauert mich“, das Walross sprach,
„Ich kenne eure Qualen.“
Und suchte dabei schluchzend aus
Die mit den größten Schalen
Und führt’ das Taschentuch ans Aug
Zu wiederholten Malen.
Lewis Carrol, aus: Das Walross und der Zimmermann
Seit meiner Kindheit sammele ich Perlen. Jedesmal, wenn wir im Urlaub in Torridon im Nordwesten Schottlands Muscheln gesucht haben, habe ich welche gefunden. Sie sind klein und runzelig, lila, grün und grau – aber es sind Perlen. Ich hebe sie in einem Schnapsglas auf, in der Hoffnung, dass es eines Tages randvoll sein wird. Dann werde ich mir eine Brosche aus ihnen basteln.
In Torridon habe ich auch zum ersten Mal darüber nachgedacht, ob es ethisch vertretbar ist, Fleisch zu essen. Ich hatte fünf Jahre als Umweltjournalistin beim Daily Telegraph gearbeitet und regelmäßig vom Anstieg der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre und von der globalen Erwärmung berichtet. Mir war klar, dass die intensive Nutztierhaltung eines der Hauptprobleme darstellte. Ich hatte auch über andere Umweltthemen geschrieben, über den übermäßigen Einsatz von Antibiotika und über die Wasserverschmutzung. Bei näherem Hinsehen waren die Statistiken ziemlich beängstigend: Wir essen bereits 60 Milliarden Tiere pro Jahr, und im Jahr 2050 wird diese Zahl voraussichtlich auf 100 Milliarden gestiegen sein. In den reichen Ländern nehmen die Menschen drei- bis viermal mehr tierisches Protein zu sich, als sie benötigen. Aber in all den Artikeln, die ich über die Folgen des Klimawandels geschrieben hatte – Hochwasser, Dürren, Artensterben –, hatte ich noch nie die Lösung in Betracht gezogen, den Fleischkonsum zu reduzieren.
Als ich die Zeitung zunehmend desillusioniert und ein wenig deprimiert über den Zustand der Welt verlassen hatte, fuhr ich wieder einmal nach Torridon, um für eine gewisse Zeit allein zu sein. Ich brauchte Zeit zum Nachdenken, wollte viel in der Natur sein. Schwarzkehlchen und Graugänse ließen sich direkt vor meinem Fenster nieder, und jeden Morgen konnte ich Hirsche beobachten. Ich lernte, sie zu unterscheiden: Da war der mit der schwarzen Brust, der mit dem blassen Fell und der mit dem großen Geweih, der sich immer als letzter abwandte und davontrabte. Er wirkte so, als wolle er mich herausfordern: Dies ist mein Revier, was hast du hier zu suchen? Oft ging ich in der Abenddämmerung spazieren, wenn das Licht sich in ein blaues Halbdunkel verwandelte. Eines Abends stellte sich mir der Hirsch in den Weg. Ich sah im Dunkeln seine Silhouette, mit seinem prächtigen Geweih schien er den Himmel aufzuspannen. Einen Moment sahen wir uns direkt in die Augen.
Der Name Torridon kommt aus dem Gälischen und bedeutet „Ort der Übertragung“. Ganz sicher übertrugen sich die Natureindrücke auf meine Gedankenwelt. Einige Fragen stellte ich mir hier zum ersten Mal: Was unterscheidet uns von den Tieren draußen vor dem Fenster? Ist es unsere Fähigkeit zu denken? Und wenn ja, sollten wir dann nicht über die Tiere nachdenken, die wir essen? Ich war nicht der Meinung, dass die Lösung darin bestehen könnte, ganz auf Fleisch zu verzichten. Vielleicht lag das daran, dass ich auf einem Bauernhof groß geworden bin (obwohl mein Vater vor allem Ackerbau betreibt). Lachse fressen Jungfische, Greifvögel fressen Wühlmäuse, Wölfe – wenn es noch welche gäbe – würden Rotwild fressen. Tiere zu essen gehört für mich zum Kreislauf von Leben und Tod, in den wir alle eingebunden sind.
Für ein ethisch verantwortungsbewusstes Leben muss man moralische Maßstäbe entwickeln. Dazu gehört, dass man die Folgen seiner Handlungen überschaut. So kam ich auf die Idee, für ein Jahr – gewissermaßen als „anständiger Fleischesser“ – nur solche Tiere zu essen, die ich selbst gefangen, getötet und geschlachtet hatte, und mich ansonsten vegetarisch zu ernähren.
Nach meinem Schockerlebnis mit dem Kaninchen scheinen mir Muscheln, speziell Austern, für den Anfang des Projektes geeigneter. Zur Vorbereitung lese ich den Tierethiker Peter Singer. In seinem 1975 veröffentlichten Buch Animal Liberation: Die Befreiung der Tiere verwendet er den Begriff „Speziesismus“, um die diskriminierende Haltung des Menschen gegenüber anderen Arten zu bezeichnen. Er hält es für nicht vertretbar, dass Menschen über Leben und Tod anderer Lebewesen entscheiden. So wie es inzwischen zum Selbstverständnis unserer Gesellschaft gehöre, Menschen verschiedener Hautfarbe und Herkunft gleich zu behandeln, müssten auch andere Arten respektiert werden. Diese Position gilt innerhalb der Tierrechtsbewegung als extrem. Bei Muscheln zeigte sich Singer zunächst weniger dogmatisch. In der ersten Ausgabe von Animal Liberation billigte er das Austernessen noch (später revidierte er diese Ansicht), da unklar sei, ob Austern Schmerz empfänden. Die Leidensfähigkeit eines Lebewesens ist für ihn das relevante Merkmal.
Auch die Tierrechtsorganisation PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) bezweifelt, dass Austern Schmerzen empfinden. Die Austernschale ist am Untergrund festgewachsen. Für eine Schmerzempfindlichkeit scheint es keinen evolutionären Grund zu geben, denn die Austern könnten sich nicht wegbewegen, wenn ihnen etwas Missbehagen verursacht. Ihr Nervensystem ist sehr simpel; sie haben kein Gehirn, mit dem sie Schmerz verarbeiten könnten. Ich muss an die Perlen denken. Warum hüllen Muscheln ein winzig kleines Objekt in Perlmutt, wenn nicht genau deshalb: weil es ihnen Schmerzen verursacht?
PETA und Singer sind gegen das Fleischessen. Sogenannte Ostroveganer essen zwar keine tierischen Produkte, aber Muscheln. Sie meinen, dass man deren natürliche Proteine und Mineralstoffe ruhig nutzen soll, zumal die Frage nach dem Schmerzempfinden ungeklärt ist. Sie befürworten den Verzehr sogar, weil die Austernzucht einen Beitrag zum Kampf gegen die Umweltverschmutzung leisten kann. Ich bin auch der Meinung, dass zur Klärung der ethischen Aspekte des Fleischessens nicht allein das Schmerzempfinden betrachtet werden kann. Die Bedeutung der Tiere im jeweiligen Ökosystem spielt ebenfalls eine Rolle. Das Meeresgetier prägt seit Jahrhunderten die britische Küstenlandschaft – ebenso wie die Tatsache, dass wir es verzehren. Ich nehme mir vor, herauszufinden, wie Austern geerntet werden, und zwar hier in Essex, wo ich aufgewachsen bin.
Austernfischen scheint mir das perfekte Geburtstagsvergnügen zu sein, ganz besonders mit meinem Vater im Schlepptau. Wir verbringen viel zu selten Zeit miteinander. Es ist ein wunderschöner Sommertag. Mein Vater kommentiert den Zustand der Äcker ebenso wie meine Überholkünste, während wir gen Osten ans Meer fahren. Wir kommen an der Gemeinde Eight Ash Green vorbei, ich zähle die Eschen – eins, zwei, drei, vier, fünf – und frage mich, ob sie das Eschensterben überleben werden. Wir überqueren die Orwell Bridge, das Land wird flacher, alles ist von einer Salzkruste überzogen, die Blätter sind silbern gefärbt. Wir nähern uns der Küste, Felder werden zu Marschland, statt Häusern sehen wir bunt angestrichene, vom ständigen Wind gebeutelte Baracken. Im Hafen von Brightlingsea schippern zahlreiche Boote, Ausflügler genießen den Tag. Einst blühte hier, wie an vielen Orten in Essex, die Fischerei, aber mit dem Aufkommen von Fabrikschiffen draußen auf der Nordsee brach das Geschäft völlig zusammen. Es ist ein Zeichen der Zeit, dass heute nur noch ein Fischkutter im Hafen liegt, mit dem Fischfang kommerziell betrieben wird, ein anderer steht in Diensten des örtlichen Windparks.
Mein Vater und ich holen uns einen Kaffee und schlendern den Steg hinunter auf die Jacqueline Anne zu. Unser Gastgeber am heutigen Tag ist Bram Haward, Austernfischer in der achten Generation. Er packt bereits Eimer und Treibstoffkanister in den Laderaum des zerbeulten kleinen Bootes. Mit Ohrringen und Baseballkappe sieht er eher wie ein Pirat aus als wie ein typischer Kapitän. Er reicht mir seine Hand, und ich gehe an Bord. Beim Auslaufen frage ich mich, wie es hier früher wohl ausgesehen haben mag, als ein Sommermorgen im Hafen noch erfüllt war von lautem Rufen, Kettenklirren und Fischgeruch statt von Kaffeeduft und dem gedämpften Dudeln des Radios. Aber Bram kann sich nicht daran erinnern, dass es eine Fischereiflotte gegeben hat. „Es gab immer nur uns und die Touristen“, sagt er mit einem Seitenblick auf meine Kamera.
Shifting-Baseline-Syndrom: So nennt man das Phänomen, wenn eine Generation sich nicht an einen früheren Zustand, beispielsweise an eine vielfältigere Tierwelt, erinnern kann, sondern der Überzeugung ist, es wäre alles in Ordnung und so wie immer – oder sogar besser als früher –, obwohl sich in Wahrheit sehr viel verändert hat. Ich bin selbst davon betroffen. In den 80ern auf einem Bauernhof aufgewachsen, dachte ich lange, die Umweltbedingungen hätten sich positiv entwickelt, bis ich mich eines Tages mit Graham Madge unterhielt. Er ist Pressesprecher der Royal Society for the Protection of Birds (RSPB, dt.: Königliche Gesellschaft für Vogelschutz) und einer der größten Vogelexperten, die ich kenne. Wir trafen uns anlässlich der alljährlichen Vogelzählung, und ich merkte an, dass meinen Beobachtungen zufolge die Vogelwelt auf dem Land vielfältiger geworden sei – oder nicht? Auf jeden Fall seien mehr Vögel zu sehen als früher.
„Wo sind Sie aufgewachsen?“, fragte er mich.
„In Essex.“
„Und haben Sie jemals einen Kiebitz beobachtet?“
„Nein.“ Ich wollte nicht zugeben, dass ich nicht einmal genau wusste, wie ein Kiebitz aussieht. Hatte der nicht so eine Art Vokuhila-Schweif, der ihm vom Kopf absteht?
„Früher gab es ganze Schwärme davon, genau dort, wo Sie aufgewachsen sind.“ Ich versuchte mir vorzustellen, wie ein Kiebitzschwarm aussieht, aber es gelang mir nicht. Ich bin ohne diesen wunderschönen Vogel aufgewachsen. So viel ist verloren gegangen und geht weiterhin verloren …
Eine große Umweltveränderung ist Bram, dem Austernfischer, allerdings doch aufgefallen: die steigende Anzahl von Pazifischen Felsenaustern. Diese aus Ostasien stammende Spezies hat vor gut 40 Jahren zu uns gefunden und wurde für schicke Restaurants gezüchtet. In den 1960er-Jahren scherte sich noch niemand um den Erhalt von Artenvielfalt; man nahm auch an, dass diese Austern unsere kalten Winter nicht überleben würden. Sie überlebten nicht nur, sondern gediehen prächtig und besiedeln jetzt die Südküste Englands. Inspiriert von ihrem lateinischen Namen Crassostrea giga nennt Bram sie „Gigas“, und sie sind tatsächlich riesig, mit fünf Jahren bereits handtellergroß.
Wir tuckern mit dem kleinen Kutter in der Nähe des Hafens herum. Um die Austern vom Grund zu kratzen, lässt unser Kapitän eine Vorrichtung ins Wasser, die aussieht wie ein Netz auf Skiern und etwa so groß ist wie eine Obstkiste. Es dauert nur ein paar Sekunden, bis das Netz voll ist und wieder an Deck gezogen werden kann. Wir nehmen die großen, schlammbedeckten Austern in die Hände. „Du tust der Umwelt eigentlich einen Gefallen, wenn du die hier isst“, sagt Bram und wirft eine Auster nach der anderen in seinen Eimer. „Ich weiß nur nicht, wie viele du schaffst.“ Hin und wieder stoßen wir auf eine der seltenen einheimischen Austern. Ihre fächerförmige Schale mit schönen lila und grünen Flecken sieht zart aus im Gegensatz zu den knorrigen Pazifischen Austern; sie sind auch viel kleiner – obwohl sie ebenfalls handtellergroß werden können, wenn man ihnen genügend Zeit gibt. Wir werfen die einheimischen Austern zurück ins Wasser. Sie dürfen in Monaten mit „r“ im Namen, also während der Laichzeit im Sommer, nicht verzehrt werden.
Früher waren diese Gewässer voller Austern, die wie festgewachsene Pac-Man-Figuren ihre Schalen auf- und zu klappen. Wie alle Muscheln filtern Austern ihre Nahrung aus dem Wasser. Mittels winziger Haare, auch „Cilia“ (lat.: Wimpern) genannt, lassen sie Wasser einströmen. Sedimente, Nährstoffe und Phytoplankton werden absorbiert, sauberes Wasser wird wieder ausgestoßen. Jede Auster filtert bis zu fünf Liter Wasser pro Stunde. Gleichzeitig wird der Meeresboden durch die Muscheln gefestigt; über Generationen hinweg haben sie felsenartige Riffe gebildet. Ganz Nordeuropa war einmal größtenteils von Austernbänken umgeben. Vielleicht war die graue Nordsee dank ihnen einmal kristallklar? Kaum vorstellbar. Wie gerne würde ich eine Zeitreise zurück machen! Ich möchte wissen, wie es hier aussah, bevor die Muscheln durch Schlamm ersetzt wurden. Ich möchte die Römer sehen, die Colchester in Essex zum Verwaltungssitz ausbauten, weil das Meer hier eine natürliche Proteinquelle darstellte. Wie sie hierher marschiert kamen und die regionale Spezialität genossen. Sallust zufolge, der über Cäsars Britannienfeldzüge schrieb, waren die Austern das einzig Gute, was die armen Briten besaßen.
Austern waren ein Arme-Leute-Essen. Im viktorianischen Zeitalter kamen desto mehr Austern in die Pastete, je ärmer man war – um den Fleischmangel auszugleichen. Austern und Stout, ein schwarzes, obergäriges Bier, waren der Snack fürs Volk. Allein im Jahr 1864 wurden in London 700 Millionen Austern verzehrt. Sie waren billige, leicht erhältliche Proteinbomben, aber das blieb nicht so. Mit industriellen Fangmethoden war die Schüssel schnell leergekratzt. Austern wurden seltener und deswegen zur Delikatesse, besonders die einheimischen Austern, die sich nicht nur von Jahrzehnten der Überfischung erholen mussten, sondern auch mit einer invasiven Spezies zu kämpfen hatten: den „Gigas“.
Vor der Küste Ostenglands versuchen Bram und sein Vater, die einheimischen Austern wieder aufzupäppeln. Sie sammeln junge Austern ein und siedeln sie in Sumpfgebieten an, wo es viel Nahrung für sie gibt. Diese traditionelle Art der Austernzucht wird in ganz Großbritannien betrieben, oft unterstützt von der Regierung oder mit EU-Geldern. In Gegenden wie Schottland und Südwales mussten Saataustern beschafft werden, um seit Langem zerstörte Austernbänke neu aufzubauen. Oft wiesen nur noch Schalenreste oder alte Landkarten mit Ortsnamen wie „Oyster Mout“ oder „Oyster Bay“ auf ihre einstige Existenz hin. Es besteht Hoffnung, dass die neuen Austernbänke eines Tages nicht nur Nahrung liefern, sondern auch das Wasser reinigen und Schutz vor Erosion und Stürmen bieten werden.
Auch in New York gibt es ein Programm, um die Austernpopulation wieder zu vergrößern. Das Billion Oyster Project (BOP) ist nach dem Hurrikan Sandy noch wichtiger geworden. Wie in London waren Austern in New York einst das Essen für die Massen, die Pizza von damals. Aber Wasserverschmutzung und Überfischung haben die Spezies vertrieben. Jetzt werden neue Austernbänke angelegt. Hierbei kommen Austernschalen zum Einsatz, die von Restaurants gesammelt und anschließend für das Projekt aufbereitet werden. Austern zu essen ist nicht nur in Mode – es ist auch ethisch vertretbar.
Bevor ich meine Austern essen kann, müssen sie zur Klärung mindestens 48 Stunden in sauberem Wasser liegen. In der Zwischenzeit feiere ich meinen Geburtstag. Und was schenkt mir mein Vater? Eine Perlenkette.
Etwa eine Woche später, Mitte Juli, mache ich mich zum Austernessen auf. Es regnet, und ich hole meine Freundinnen Jenna und Harriet am Bahnhof von Colchester ab. In Jeans und Anorak tänzeln sie den Bahnsteig entlang. Dies ist ein Tagesausflug, wie er in den Wochenendbeilagen empfohlen wird: „West Mersea – hier heißt es: sehen und gesehen werden. Genießen Sie frische Meeresspezialitäten!“
Der Seenebel ist so dicht, dass wir kaum etwas sehen können, aber irgendwann finde ich meine Austern in einer Holzhütte am Hafen wieder. The Company Shed sieht ein wenig heruntergekommen aus, gilt in der Foodie-Szene aber als Highlight. Die Kellnerinnen tragen Gummistiefel und bringen frischen Fisch an den Tisch, die Gäste bekommen ein Schneidebrett und eine Rolle Küchenpapier und müssen dann allein zurechtkommen. Der Laden ist voller hipper Londoner, die Austern knacken, und die Besitzerin Heather sieht in mir nur eine weitere Food-Bloggerin, die sich hier mal umsehen will. Sie hat keine Zeit für uns; etwas gereizt schickt sie uns durch eine Art Duschvorhang nach hinten zu einer Garage voller Wassertanks. Dort treffen wir auf Phil, einen attraktiven Austernhändler, der uns meinen Fang zeigt und mir ein brutal aussehendes Instrument reicht. Es wirkt wie eine Kreuzung aus Messer und Schraubenzieher. Phil führt uns vor, wie wir das Messer in das „Maul“ der Auster einführen und dann damit hin- und herwackeln sollen, bis die Auster sich öffnet. Dann muss man nur noch die „Füße“ abtrennen, die mit der Schale verbunden sind, und schon ist das Essen fertig.
Profis können angeblich tausend Austern pro Tag knacken. Ich habe schon mit einer einzigen genug zu tun. Austern haben vielleicht kein Gehirn, aber meine hält ganz offensichtlich an ihrem Leben fest. Es ist harte Arbeit, die Auster gibt nicht nach. Endlich habe ich die Schale aufgehebelt, sie öffnet sich mit einem Knacken.
„Na los, runter damit“, sagt Phil.
„Und, wie ist es?“, fragen die Mädels.
Ohne nachzudenken sage ich: „Kennt ihr das, wenn man es einfach nicht schafft zu schlucken?“
Einen Augenblick ist es sehr still, man hört nur das Gurgeln der Tanks und ein Glucksen aus Jennas Kehle. „Äh …“ – die Peinlichkeit der Situation krabbelt mir den Nacken hoch, verbrennt mir die Wangen. Der sexy Austernhändler wird rot, Jenna tut so, als würde sie sich plötzlich brennend für einen Hummertank interessieren. Harriet, meine liebe Harriet, schämt sich wie immer für andere. Mit großen blauen Augen schaut sie den Austernhändler an, als wollte sie sagen: „Tut mir leid, ich möchte mich in aller Form für meine Freundinnen entschuldigen.“
Nachdem wir uns also ordentlich blamiert haben, setzen wir uns in eine Ecke des Restaurants, wo uns erst einmal niemand beachtet. „Okay, du anständige Fleischesserin: Wie fühlt es sich an, ein lebendiges Wesen vor sich zu haben, es zu töten und zu essen?“, fragt Jenna. Sie weiß, dass ich auf meinem Blog von meinen Erfahrungen berichten will. Ich träufele Zitronensaft über die zitternde Auster, die vor mir liegt und die ich lebendig verspeisen werde. Verglichen mit einem Blumenkohl sieht eine Auster schon eher wie ein fühlendes Wesen aus. Aber wie das Walross in Lewis Carrolls Gedicht Das Walross und der Zimmermann, das Austern mit Brot und Butter verschlingt, müsste ich lügen, wenn ich jetzt sagte, mir wäre schwer ums Herz.
„Es ist, als würde man über eine Schatztruhe hinweggleiten – man taucht durch den Algenwald hinunter in eine lebendige Welt, die von lebendigen Wesen überkrustet wird; komplex, bunt und zart.“ Guy Grieve, Gründer der Firma The Ethical Shellfish Company, beschreibt, wie es ist, vor der Isle of Mull nach Muscheln zu tauchen. „Dann hörst du das schrecklichste Geräusch der Welt“, fährt er fort. „Ein knirschendes, klirrendes Geräusch, wie Kettenrasseln, einfach schauderhaft. Und das nächste Mal, wenn du zur Muschelbank kommst, ist alles fort, zerstört, nur noch eine Schutthalde. Alles voller Schlamm, die Unterwasserwelt mit Trümmern übersät.“
Dreimal am Tag macht sich Guy dorthin auf, wo sonst niemand ist. Er sieht, was sonst niemand sieht, und hört, was sonst niemand hört. Er hört die Dredgen: Schleppnetze, die zur Muschelfischerei verwendet werden. „So klingt pure, zügellose, sinnlose Gier“, sagt er. Der Einsatz von Dredgen gehört zu den umstrittensten Fischereimethoden der Welt, und dennoch werden sie vor den Küsten Großbritanniens weithin genutzt. Jedes Schleppnetz ist mit einer großen Harke versehen, die den Meeresboden umpflügt und so die Muscheln einsammelt.
Guy ist ein Abenteurer. Er hat seine Firma gegründet, nachdem er die Welt umsegelt und allein in Alaska gelebt hatte, und kann nicht fassen, dass Dredgen in einem Land wie Großbritannien immer noch erlaubt sind. Er erklärt mir, dass Muscheln sich in einer einmal zu Schutt gemachten Zone zwar wieder ansiedeln können, weil sie sich vom Phytoplankton ernähren, das durchs Wasser treibt. Aber was ist mit der restlichen Unterwasserwelt in ihrer ganzen Vielfalt, den Meeresalgen und Korallen? Hat der Rückgang der Fangzahlen von Kabeljau und Schellfisch, den die Fischerei an der Westküste zu verzeichnen hat, vielleicht auch damit zu tun? Guy meint, es gebe eine Alternative. Im Trockentauchanzug und mit 70 Kilogramm Tauchgewicht macht er sich zum Meeresboden auf und sammelt dort vorsichtig nur die größeren Muscheln ein, ohne den Korallen, dem Seegras und der restlichen „lebendigen Welt“ da unten zu schaden. „Ich möchte in den Garten gehen und Äpfel pflücken, ohne dabei die Blumen zu zertrampeln“, sagt er. „Um uns Nahrung zu beschaffen, müssen wir nicht in den Krieg ziehen und alles zerstören.“
In einem Restaurant in Edinburgh öffne ich später eine der von Guy geernteten Jakobsmuscheln und entferne die schwarzen Innereien, sodass nur das weiße Fleisch und der korallenfarbige Rogen übrig bleiben. Das Fleisch wird kurz gegrillt und kommt dann wieder in die Schale. Ich muss an Botticellis Venus denken: Eine Speise der Götter liegt vor mir auf dem Teller. Natürlich kostet sie mehr als eine mit Dredge gefangene Muschel, 150 Prozent mehr, aber das ist es mir wert. Wie Guy schon sagte: „Wie hättest du deine Jakobsmuschel gern? Mit oder ohne Zerstörung des maritimen Lebensraums?“
Befragt man britische Muscheltaucher und Reusenfischer, drehen sich ethische Fragen vor allem darum, wie die Tiere gefangen werden. Dredgen und Schleppnetze pflügen den Meeresboden um und hinterlassen eine Verwüstung, in der andere Fische keine Nahrung mehr finden. Reusen hingegen beschädigen den Meeresboden nicht. Vor kurzem wurde die Scottish Creel Fishermen’s Federation gegründet, deren Ziel es ist, die Fischerei mit Reuse und Angelkorb populärer zu machen. Bald sollen Garnelen, die auf diese Art gefangen wurden, in britischen Supermärkten durch ein spezielles Gütesiegel auf der Verpackung gekennzeichnet werden.
In Shieldaig Harbour am Loch Torridon hole ich eine volle Reuse ein und nehme den Fang zum Abendessen mit nach Hause. Rosa Kaisergranate schauen aus meiner Plastikkiste hervor, winken mit ihren rasiermesserscharfen Scheren und lassen die Kiste quietschen, als wäre sie selbst ein lebendiges Wesen. Ich lege die Tiere zunächst ins Gefrierfach, damit sie „einschlafen“. Als ich sie später in den Topf werfe, murmele ich ununterbrochen: „Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid …“
Für Krebstiere haben wir offenbar mehr Gefühle als für Muscheln. Ich gebe Phoebe aus der US-Serie Friends die Schuld daran. Es gibt eine berühmte Szene, in der sie Ross als Rachels „Hummer“ bezeichnet, womit sie sagen will, dass die beiden lebenslang zusammengehören. Wie fast alles, was aus Hollywood kommt, ist das völliger Blödsinn – Hummer wechseln ihre Partner recht häufig –, aber es ist dennoch eine schöne Vorstellung.
Meine Großmutter verabscheute es, Krebstiere zu töten. Ich erinnere mich daran, wie ich vor einigen Jahren mal einen frischen Hummer aus Seacliff mitbrachte. Mein Cousin Jack Dale, der als Reusenfischer vor der Küste von East Lothian arbeitete, hatte ihn mir als Geschenk mitgegeben. „Pack ihn einfach auf den Beifahrersitz, das wird schon!“
Aber meine Großmutter – die mir normalerweise jeden Wunsch erfüllte – weigerte sich, ihn zuzubereiten. Das überraschte mich. Meine Großmutter war Bäuerin, konnte Fasane ausnehmen und Kaninchen zerlegen. Und bei einem Hummer war sie plötzlich zimperlich? „Ach, das ist schrecklich“, sagte sie. „Sag mir Bescheid, wenn du es machst, ich will nicht dabei sein.“ Ich muss gestehen, dass ich den Hummer in einen Topf mit kochendem Wasser warf und aus der Küche rannte, um seine „Schreie“ nicht hören zu müssen – das Pfeifen der Luft, die aus den Körperhöhlen dringt. Aber Jack hatte Recht, es „wurde“ dann, und am selben Abend fuhr ich nach London und teilte mir den gekochten Hummer in einem Camdener Biergarten mit Freunden.
Ein paar Jahre später kehre ich zurück nach Seacliff, einem der kleinsten Häfen Schottlands. Erbaut aus demselben roten Sandstein wie Tantallon Castle, die sich im Hintergrund erhebt. Jacks Sohn Robbie ist auch Reusenfischer. Während sein winziges Boot Keyte aus dem Hafen ausläuft, sehen wir eine Robbe von einem Felsen ins Meer tauchen. Eiderenten fliegen vom Wasser auf und ein Eissturmvogel umkreist uns. Eine prächtige britische Küstenszenerie. Robbie und sein Fischereipartner Sam Lowe, beide erst Mitte 20, wissen das auch zu schätzen. Sie arbeiten körperlich hart, fahren bei jedem Wetter raus, holen oft fünf Reusen gleichzeitig ein, aber sie lieben ihre Arbeit – und das liegt nicht zuletzt daran, dass sie so viel von der Fauna mitbekommen.
Wir verbringen einen fantastischen Tag vor der Küste von East Lothian. Kormorane lassen sich auf den Felsen nieder, um ihr Gefieder trocknen zu lassen, und Basstölpel fliegen mit Seetang im Schnabel zu ihren Nestern auf der Insel Bass Rock. Kleinere Hummer, die noch nicht das Mindestfangmaß erreicht haben, werden zurück ins Wasser geworfen, ebenso wie andere Tiere: Kabeljaue, stachelige Seeigel und ein seltsamer Seeskorpion, der wie ein Handy vibriert, wenn man ihn sich auf die flache Hand legt.
Die Hummer, die groß genug sind, bekommen ein Plastikband um ihre Scheren. Ich lasse mir Zeit, sie zu betrachten: den feinen blauen Saum an ihrem gefächerten Schwanz, die riesigen roboterartigen Scheren und die Antennen, mit denen sie sich durch die Unterwasserwelt navigieren. Manchmal gehen sie Hand in Hand, die älteren Hummer führen die jüngeren an. Sie können hundert Jahre alt werden. Ob sie sich nicht doch manchmal ineinander verlieben?
Ich erfahre, dass der humanste Weg, einen Hummer zu töten, darin besteht, ihn zunächst zu betäuben. Das kann gezielt mit einem Messerstich erledigt werden oder mithilfe eines außergewöhnlichen Küchengeräts („Crustastun“). Im Internet kann man sich Bilder davon anschauen; es sieht aus wie eine Art Kopierer. Setzt man den Krebs oder Hummer hinein und schließt den Deckel, bekommt das Tier einen tödlichen Stromschlag verpasst. Klingt vielleicht komisch, aber das Gerät wird in vielen britischen Spitzenrestaurants genutzt. Es bedeutet weniger Stress für die Tiere und nicht zuletzt auch für das Küchenpersonal. Eine größere Variante wird in britischen Krebsverarbeitungsfabriken genutzt.
Leider muss ich den steinigen Weg gehen. Ewan MacMichael, Spitzname: „The Lobinator“, der als Küchenhilfe im Nether Abbey Hotel in North Berwick arbeitet, zeigt mir, wie man‘s macht. Wir nehmen einen Hummer, der zur Betäubung ein paar Stunden bei niedriger Temperatur gelagert wurde, und legen ihn auf ein Brett. Der „Lobinator“ gibt mir ein großes, schweres Messer und erklärt mir, was ich tun muss. Ich soll am Kopf ansetzen und zügig den gesamten Körper zerteilen, um das Nervensystem bzw. die Ganglien zu durchtrennen, die in der Körpermitte des Tieres verlaufen. Es ist schnell vorbei, und der Hummer ist so kalt und starr, dass ich keine Zeit habe, allzu viel darüber nachzudenken, was für eine schöne Kreatur er ist. Aber ich beobachte, dass die Köche diese Aufgabe nicht selbst übernehmen, wenn sie es vermeiden können.
Ich nehme meinen frischen Hummer mit an den Hafen, zum Lobster Shack, einem hippen Pop-up-Restaurant. Früher wäre so etwas hier nicht vorstellbar gewesen. Die Schotten sind bekannt dafür, lieber Junkfood statt ihrer weltberühmten Meeresspezialitäten zu essen. Das heißt nicht nur, dass die Tiere exportiert und oft noch weite Strecken lebendig transportiert werden, sondern auch, dass die Schotten selbst nicht in den Genuss des leckeren, gesunden Fleischs kommen. Wie auch immer, dank Orten wie diesem – und der harten Arbeit der Reusenfischer – ändern sich die Verhältnisse langsam.
Jack und andere Reusenfischer haben mit finanzieller Unterstützung des Coastal Communities Fund eine Hummeraufzuchtstation in North Berwick gegründet, die Firth of Forth Lobster Hatchery. Hier liefern Fischer eiertragende Hummerweibchen ab, und die Eier werden in Tanks gelagert. Neun bis zwölf Monate später schlüpfen die anfangs bloß fingernagelgroßen Hummer. Wegen zahlreicher Fressfeinde würden in der Wildnis nur 0,05 Prozent davon überleben, aber in den Tanks kommen die meisten durch. Im Alter von zwölf Wochen werden sie zurück ins Meer gebracht.
In anderen Ländern ist die Hummerpopulation aufgrund von Überfischung so stark zurückgegangen, dass eine Wiederaufstockung unmöglich ist. In dieser Hinsicht ist die Hummeraufzucht eine Art Versicherung, die den Erhalt einer gesunden Population garantiert. Die Station informiert die Menschen auch darüber, woher ihr Essen kommt. Touristen werden zur Besichtigung eingeladen und können mit Jacks Boot sogar aufs Meer hinausfahren, bevor sie zum Hummeressen gehen. Ich lasse meinen Hummer grillen. Wie beim Kochen entweicht Luft aus den Körperhöhlen, ein gespenstisches Pfeifen ist zu hören, auch die Scheren bewegen sich. Aber über Aberglauben bin ich inzwischen hinweg.
Ich sitze am Hafen mit Blick auf die Insel Bass Rock, genieße meinen Hummer mit Knoblauchbutter und Pommes Frites und denke über meine Erlebnisse nach, als mein Handy klingelt. Es ist eine Nachricht von den Jungs auf dem Boot. Ich muss lachen: Sie haben mir ein Foto von Sam mit einem Tintenfisch auf dem Kopf geschickt und eins von dem stahlblauen Hummer, den sie einen Sommer lang als Haustier gehalten haben -ein kleiner Eindruck von den wundersamen Wesen, die unter der Wasseroberfläche leben und die wir normalerweise nie zu Gesicht bekommen.
Ich nehme Steves Angebot an, weitere „Schädlinge“ zu fangen – in diesem Fall Signalkrebse, eine invasive Spezies. Die Landschaft von Essex sieht so schön aus wie immer, am Rand der Stoppelfelder wiegen sich Silberweiden im Wind, während ich auf der altbekannten Straße nach Hamel’s Park fahre.
Steve nimmt mich mit zum Teich, wo wir Krebsfallen leeren wollen. Er hat den Teich als Biotop angelegt, und es hat funktioniert – im Schilfrohr brüten Sumpf- und Blesshühner. Am Ufer wächst Springkraut, wir schnippen gegen die Schoten und lachen, wenn sie aufplatzen. „Noch eine invasive Art, gegen die man nichts machen kann“, sagt Steve. Die Pflanze mit den purpurfarbenen Blüten, auch „Polizisten-Helm“ genannt, wurde aus Indien importiert und verstopft inzwischen ganze Wasserläufe. „Aber sie bietet den Bienen auch das ganze Jahr Nahrung“, sagt Steve. „Ich sehe das ziemlich entspannt“, fügt er hinzu, während er mit einer Heugabel die Krebsnetze aus dem Teich fischt. „Die Natur kann niemand aufhalten.“
Die Signalkrebse sehen mit ihren roten Scheren wie Miniaturhummer aus, ihr Körper wiederum ist grünblau, wie der Teich. Erst als wir sie in einen Topf mit kochendem Wasser werfen, nehmen sie eine krebsrote Farbe an. Steve fängt sie das ganze Jahr über. „Die sind gekommen, um zu bleiben“, meint er lakonisch. Wir lassen sie in einem Sieb abtropfen und lösen das Fleisch vom Panzer. Es ist eine fummelige, nicht sonderlich ertragreiche Arbeit. Aber sie lohnt sich. Das weiße Fleisch schmeckt so aromatisch wie Kaisergranat.
„Warum essen nicht mehr Leute Signalkrebse?“, frage ich mit vollem Mund.
„Zu viel Arbeit“, sagt Steve.
„Und warum tust du es dann?“, frage ich.
„Weil ich es schon als Kind musste“, sagt er. Seine Mutter war krank. Steve lernte, sich selbst Nahrung zu beschaffen. Tiere zu fangen war für ihn kein Spiel und ganz sicher kein Sport – es ging ums Überleben.
Sorgfältig zerlege ich einen weiteren Signalkrebs. Ich will mein Projekt weiter verfolgen. Nicht nur, weil ich mich voll und ganz von dem Kaninchen-Erlebnis erholt habe, sondern weil ich langsam begreife, wie wichtig das Thema ist. Alle interessieren sich dafür, und zwar viel mehr als für den Klimawandel, da hören viele gerne weg. Wenn ich weiß, woher unser Essen kommt, kann ich selbst entscheiden, und das, was ich liebe, schützen und bewahren. Ich will ein Landmensch werden wie Steve, ich will in der Lage sein, mich von dem zu ernähren, was unsere schöne Landschaft bereithält. Steve schüttelt den Kopf und sagt, ich solle dann mal besser anfangen zu üben.