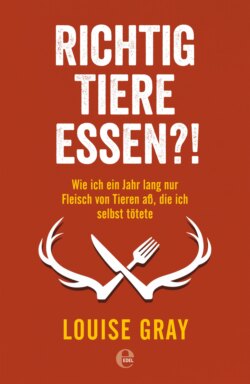Читать книгу Richtig Tiere essen?! - Louise Gray - Страница 14
Die Minions
ОглавлениеSapere aude – wage es, weise zu sein.
Lateinisches Sprichwort
Auf meinen ersten Schlachthofbesuch bereite ich mich nicht vor. Ich stelle weder Recherchen zu dem Betrieb an noch erzähle ich meinen Freunden oder meiner Familie, wo ich hinwill. Ich ziehe an dem betreffenden Tag eine neue Bluse von Topshop an, die mit kleinen Rehkitzen bedruckt ist. Das Schwierige ist: Die Schweine habe ich zuvor bereits kennengelernt.
Die Gorgie City Farm schien mir ein guter Ausgangspunkt zu sein. Die Schweine, eine niedliche, seltene Rasse namens Gloucester Old Spot, führen dort ein aktives und glückliches Leben. Sie werden nicht bloß gemästet, um zu Würsten verarbeitet zu werden, sondern dienen Kindern aus sozial benachteiligten Edinburgher Familien als Streicheltiere. Als ich die Farm eines Morgens Mitte November besuche, bestaunt eine Familie gerade die kleinen Ferkel. Die Kinder werfen Hände voller Getreide in den Stall und sehen zu, wie die Ferkel über das Stroh rutschen. Wie aufgeregte Welpen wackeln sie so heftig mit ihren Schwänzen, dass sie die Kontrolle über ihre Hinterbeine verlieren. „Oh, Mama, schau mal, die sind ja wie die Minions!“ Geschäftsführer Ross Mackenzie lächelt. Für jemanden, der tagsüber meistens knöcheltief im Mist steht, ist er bemerkenswert sauber – vielleicht ein Resultat seiner Zeit beim Militär. Er kennt jeden Freiwilligen beim Namen („Das ist Steven, er hat die Schule abgebrochen und interessiert sich jetzt für Landwirtschaft …“) und auch jedes Tier („Das ist Gandalf, ein herrenloser Hamster …“).
Die Farm liegt umgeben von Wohnblocks am Ende der Autobahn M8 im Westen von Edinburgh. Sie wurde in den 1970er-Jahren als eine der ersten gemeinschaftlich betriebenen Farmen in Großbritannien gegründet – als noch niemand ahnte, dass ein Bauernhof in der Stadt für viele einmal die letzte Verbindung zur Natur darstellen würde, geschweige denn, dass eine Generation heranwachsen würde, die nicht weiß, woher Milch und Fleisch eigentlich kommen. Ebenfalls als eine der ersten war die Farm mutig genug, ihre Hauptattraktion in Schinkensandwiches zu verwandeln. 2012 hat Ross die Idee ins Spiel gebracht. Der frühere Projektmanager und Hauptmann in der Logistiktruppe der britischen Streitkräfte erkennt klar und unsentimental die Möglichkeiten des Unternehmens. Für das Betreiben einer kostenlos zugänglichen Einrichtung mit 100.000 jährlichen Besuchern sowie für die Arbeit mit schwierigen Teenagern und behinderten Kindern gibt es zwar ein bisschen Geld von der Kommune, aber das reicht hinten und vorne nicht. Es ist ein ständiger Kampf, die Farm am Laufen zu halten, und Ideen zur Beschaffung von Geldern sind immer willkommen, so kontrovers sie auch sein mögen.
Es hätte keinen besseren Zeitpunkt für Ross’ Vorschlag geben können. Durch den Pferdefleischskandal wollten mehr Leute als je zuvor wissen, woher das Fleisch auf ihrem Teller kam. Gleichzeitig waren Köche zunehmend an Tieren aus Freilandhaltung interessiert – nicht nur wegen des von Starköchen wie Hugh Fearnley-Whittingstall ausgelösten Trends, das ganze Tier von der Schnauze bis zum Schwanz zu verwerten, sondern auch, weil Tiere aus Freilandhaltung besser schmeckten. Schweine sind soziale Wesen und genießen das Leben im Streichelzoo. Ihr glückliches Leben bedeutet weniger Adrenalin, das den Geschmack des Fleisches verdirbt. Die Schweine bekommen hier abwechslungsreiche Kost, darunter Abfälle vom örtlichen Supermarkt, auch deswegen hat ihr Fleisch eine bessere Qualität. Vor allem aber war die Idee in finanzieller Hinsicht sinnvoll. Wie jeder Schweinebauer weiß, ist es praktisch unmöglich, Geld zu verdienen, wenn man lebendige Schweine auf dem freien Markt anbietet, es sei denn, man hält die Kosten so niedrig wie möglich – und wir wissen alle, wie das geht. Es kostet etwa 100 Pfund, ein Schwein aufzuziehen, und hinterher bekommt man gerade mal 50 Pfund dafür. Wenn der Bauer ein ganzes Schwein an ein Restaurant verkaufen kann, sieht das Geschäft besser aus. Wenn man den ganzen Schlachtkörper verkauft, bringt das 350 Pfund ein, womit die Transport- und Schlachthofkosten in etwa gedeckt sind. Auf der Gorgie City Farm werden im Café auch die hauseigenen Würste verkauft; die Einnahmen kommen der Farm zugute.
Ich habe über Fred Berkmiller von der Farm erfahren. Der französische Koch hat mir vorgeschlagen, an diesem Beispiel zu zeigen, wie wir die Herkunft unserer Nahrung zurückverfolgen können. Wie viele andere Besucher hier möchte ich wissen, woher unser Essen kommt, will aber ein bisschen tiefer in den Prozess einsteigen. Und obwohl mir prophezeit wurde, es sei unmöglich, einen Schlachthofbesuch zu organisieren, ist es dann doch bemerkenswert einfach. Ein guter Koch kann einen nämlich mit Bauern, Schlachtern und Metzgern in Verbindung bringen, die den Anfang der Verarbeitungskette bilden. Über solche Kontakte sichern sich die Köche nämlich die besten Zutaten. Fred ist nicht nur ein guter, sondern ein großartiger Koch. Er hat für jede Zutat eine besondere Bezugsquelle und möchte mein Projekt gerne unterstützen – auch wenn es ihn bekümmert, dass ich mich weigere, seine Schweinskopfsülze zu probieren. Er findet, ich sollte den Weg der Schweine von der Gorgie City Farm bis zu seinem Restaurant verfolgen und hat den Kontakt zu Ross persönlich hergestellt.
Ross gibt sich freimütig, was das Schicksal seiner Schweine angeht. Letzten Endes steht außer Frage, dass dies glückliche Tiere sind. Anders als in vielen industriellen Betrieben werden die Sauen auf der Farm nicht in sogenannten Abferkelständen gehalten, die verhindern sollen, dass sie sich zu viel bewegen und ihre Ferkel versehentlich erdrücken. Zwar sterben deswegen auch auf der Gorgie City Farm jedes Jahr ein paar Ferkel, aber das ist eben Teil der Viehhaltung und eine der Tatsachen, über die Ross die Öffentlichkeit aufzuklären versucht. Die Schwänze der Schweine werden nicht kupiert, auch ihre Zähne werden nicht gekürzt, weil sie nicht so eng zusammengepfercht werden, dass sie sich gegenseitig angreifen. Der große alte Eber, der allseits Bewunderung erntet, und die trächtige Sau, die vor Ferkeln fast platzt, haben ihren eigenen gemütlichen Stall. Wir gehen daran vorbei, um uns die jungen Sauen anzuschauen, die in ein paar Tagen zum Schlachthof gebracht werden sollen. Sie befinden sich im hinteren Teil der Farm, weit weg vom Streichelzoo. Als Teenager geraten Schweine, ähnlich wie pubertierende Jugendliche, ein wenig ins Hintertreffen. „Sie werden wirklich hässlicher“, sagt Ross.
Die vier Sauen wirken auf mich ganz zufrieden. Durch die Gitter ihres Stalls schnüffeln sie an mir, ihre Augen werden von den riesigen Ohren verdeckt, die ihnen wie ein schlapper Pony ins Gesicht hängen. Ich bin beeindruckt, wie intelligent sie sind. Sie können einen Wasserhahn per Knopfdruck selbst betätigen. Es ist allgemein bekannt, dass man mit Schlössern und Riegeln vorsichtig sein muss, denn Schweine befreien sich selbst, wenn sie den Mechanismus verstehen. Zumindest in Großbritannien kennt jedes Kind das Buch The Sheep-Pig oder den Film Ein Schweinchen namens Babe, der auf dieser Geschichte beruht.
„Wie heißen sie?“, frage ich.
„Wir geben ihnen keine Namen“, sagt Ross. „Also, die Freiwilligen tun es manchmal, aber ich finde das nicht gut.“
Ross lädt mich ein, die hauseigene Wurst zu probieren, und das Wasser läuft mir im Mund zusammen. Natürlich muss ich ablehnen, denn das Fleisch stammt ja nicht von einem Tier, das ich selbst getötet habe. Also nehme ich mit einem Kaffee vorlieb. „Zuerst hatte ich Angst, dass wir auf Facebook einen Skandal auslösen, schließlich lieben alle Peppa Wutz“, sagt Ross. „Aber den Leuten gefällt die Idee.“ Eine Wurst im Brötchen kostet auf der Gorgie City Farm 1,50 Pfund, es gibt keine schicken Extras, kein Bio-Siegel, lediglich stillen Stolz über die gesunden Lebensmittel. Die Würste verkaufen sich gut. Es ist schön zu sehen, dass sich jemand außerhalb der eher in der Mittelschicht angesiedelten Foodie-Szene mit so viel Leidenschaft dem Ziel widmet, qualitativ hochwertiges Fleisch anzubieten. „Warum, verdammt, sollten arme Leute nicht auch über so was nachdenken oder dieses Fleisch kaufen?“, fragt Ross,
Der dreifache Vater räumt ein, dass er in Sachen Viehhaltung ein relativer Neuling ist. Seine Aufgabe ist es, Menschen eine Chance zu geben. Wenn es um die Tiere geht, wendet er sich an Denis, der im Overall über das Gelände schlendert. Anders als Ross mit seinem gekämmten Haar und gepflegten Fingernägeln sieht Denis Rankine genau so aus, wie man sich einen Viehzüchter vorstellt. Er ist groß und rotwangig und lässt sich weder von den Tieren noch von den Freiwilligen etwas bieten. Mit einigem Stolz erzählt er mir, dass er früher seltene Rassen für das Königshaus gezüchtet hat. Jede Art ist anders, sagt er, man muss sie nur verstehen, damit sie ruhig bleiben. Ein Schaf folgt einem immer; ein Schwein geht sogar rückwärts – wenn man ihm einen Eimer über den Kopf stülpt. Deswegen hat der Schlachthof, mit dem die Farm zusammenarbeitet, auch einen guten Ruf: Hier wird dafür gesorgt, dass die Tiere in den paar Stunden, die sie an dem für sie fremden Ort verbringen, zum ersten Mal weg von zu Hause, Ruhe haben. „Seltsamerweise ist der Schlachthof ein ruhiger Ort“, sagt Denis. „Sehr ruhig.“
Wir sprechen darüber, wie es ist, zum ersten Mal einen Schlachthof zu besuchen. Vielleicht, weil ich so offen über mein dünnes Nervenkostüm spreche, vielleicht auch einfach wegen des Themas geht das Gespräch plötzlich in eine völlig andere Richtung. Ross hat Männer erlebt, die dafür trainiert hatten, zu töten – keine Tiere, sondern Menschen. „Soldaten werden desensibilisiert“, sagt er. „Sie müssen sich professionell verhalten. Nicht, weil sie keine Gefühle haben, sondern weil das ihre Aufgabe ist.“
In seiner Militärzeit war er in TELIC 8 im Einsatz, einer der Basisstationen, die im Irakkrieg die meisten Männer verloren haben. Er koordinierte die Versorgung mit Munition und Bomben und überwachte die Sanitätsstation. Er erlebte, wie Soldaten tot nach Hause transportiert wurden. „Wir hatten viele Rückführungen“, sagt er leise. Mir wird klar, dass wir nicht mehr über Schweine sprechen. Wir sprechen über den Tod. Ross erzählt mir von einer Methode zur Stressbewältigung nach einem traumatischen Ereignis, Trauma Risk Management (kurz: TRiM). „Unsere Ärzte waren darin geschult. Man erzählt, was einem passiert ist, und das Erlebnis wird zu einer Geschichte. Als wäre es einem nicht passiert.“ Ich mache mir Notizen und frage mich, ob Ross damit etwas über meinen bevorstehenden Schlachthofbesuch sagen möchte. Gibt er mir einen Ratschlag – oder spricht er über sich selbst?
Als ich gehe, laufe ich noch einmal Charlene über den Weg, einer hübschen Blondine, die von der Schule abgegangen ist und Tierkrankenschwester werden möchte. Vorhin habe ich sie kurz kennengelernt; jetzt mistet sie gerade die Schweineställe aus. Ich versuche, einen Witz zu machen: „Isst du dann später auch ihren Schinken?“ Sie schaut mich mit unverhohlener Verachtung an. „Ich kaufe Schinken bei Aldi, etwas anderes kann ich mir nicht leisten.“
Ich mache mich von der Redaktion aus auf den Weg zum Schlachthof. Beim Scottish Field, dem Magazin, für das ich arbeite, wissen alle von meinem Projekt. Wie die meisten meiner Freunde und Bekannten unterstützen sie mich sehr, mitunter wirken aber sie auch ein bisschen verwundert, vielleicht verstört. „Also, ich fahre dann mal zum Schlachthof.“ Die Redakteure tippen weiter. Was sollen sie auch sagen? Wir haben uns darüber unterhalten, einige von ihnen waren auch der Meinung, dass sie als Fleischesser eigentlich über das Schlachten Bescheid wissen sollten – aber sie wollen es nicht wissen, nicht im Detail. „Na, wie auch immer, bis dann!“
Ich schnappe mir mein Notizbuch und marschiere hinaus. Ich merke, dass ich versuche, den Termin so normal wie möglich anzugehen, sonst kriege ich das nicht hin. Ich steige ins Auto und stelle das Navi ein. Mein Weg führt über die M8, die Edinburgh und Glasgow miteinander verbindet. Ich kenne die Route noch gut aus meiner Zeit als junge Reporterin bei der Press Association, als ich viel in Schottland unterwegs war – und viele Strafzettel für zu schnelles Fahren kassiert habe. Damals habe ich die Familien der im Irak gefallenen Soldaten vom Infanteriebataillon Black Watch besucht. Auch die Landschaft ist mir vertraut. Je weiter westlich man kommt, desto dunkler wird das Grün, der Dialekt verändert sich, es wird regnerischer. Ein feiner Nieselregen überzieht die Berge von Lanarkshire, während ich in Schottland an Überresten der Industrialisierung vorbeifahre: New Lanark, stillgelegte Minen. Leere Bürohäuser, die gebaut wurden, um neue Jobs zu schaffen.
Als ich Wishaw erreiche, haben mich die blasse Wintersonne und die Countrymusik auf Radio 2 schon ein bisschen melancholisch gemacht. Die Stadt spiegelt meine Stimmung wider. Das Jugendzentrum ist zugenagelt, der Pub mit einem Metallgitter versperrt, das Bürgerhaus geschlossen. Vor kieselgrauen Häusern wehen leere Plastiktüten über den Rasen. Ich fahre die Hauptstraße entlang und überlege, dass der Schlachthof wohl kaum im Stadtzentrum sein wird. Der Schlachthof, an dem wir früher auf dem Weg zur Schule immer vorbeigefahren sind, befand sich jedenfalls mitten im Nirgendwo. Ich erinnere mich, dass es dort stets nach Hundefutter roch.
Schließlich erreiche ich den Schlachthof – er liegt direkt gegenüber von einem Geschäft, in dem man der Schaufensterdekoration zufolge Luftballons, Süßigkeiten und Prinzessinnenkrönchen aus Plastik kaufen kann. Außerdem gibt es einen Brautmodeladen, einen Discounter und einen Hundesalon. Auch hier verlieben sich Menschen ineinander, denke ich. Sie heiraten, arbeiten, haben eine Familie zu ernähren. Einige von ihnen mögen sozial benachteiligt sein, einige müssen im Schlachthof arbeiten. Aber auch sie lassen ihrem Hund die Haare trimmen, ehelichen ihre Liebsten, krönen ihre Tochter zur Prinzessin.
Der Schlachthof ist ein mit grünem Wellblech verkleidetes Gebäude. „Wishaw Abattoir“ steht in großen Lettern über dem Eingang. Abattoir ist das englische Wort für Schlachthof; niemand versucht zu verschleiern, was hier getan wird. Ich stelle mein Auto auf dem Parkplatz ab. Es riecht nach Gülle, wie auf einem großen Bauernhof. Ich klopfe an das Fenster am Empfang und werde von einer attraktiven blonden Dame begrüßt, die Audrey heißt. „Ich bin hier mit Philip verabredet“, sage ich. „Ich habe vor ein paar Tagen mit ihm telefoniert.“ „Oh.“ Sie schaut mich verlegen an. Im Hintergrund sehe ich den Geschäftsführer, der sich gerade schnaufend und keuchend einen Arbeitsoverall anzieht. Er heißt Philip Goodwin, ich habe mir seinen Namen beim Telefonat notiert.
„Hat sie Schutzkleidung dabei?“ Er spricht über mich, nicht mit mir.
„Äh, nein, sollte ich das?“ Ich habe keine Ahnung, was Schlachthof-Schutzkleidung überhaupt ist.
Philip murmelt irgendetwas und verlässt das Büro. Audrey bittet mich herein. Das Büro riecht auch nach Gülle, aber Audrey sieht schick aus. Sie arbeitet seit sieben Jahren hier und scheint ihren Job zu mögen, obwohl sie allein vom Äußeren nicht ganz hierher passt. Den Schlachtbetrieb selbst hat sie noch nie betreten, sagt sie. Sie hat sich nur einmal im Fernsehen eine Dokumentation darüber angeschaut. Sie könne da nicht hinsehen, sagt sie, es sei zu furchtbar. „Also, was für Männer arbeiten hier?“, frage ich. Solche, die damit fertig würden, sagt sie. Manche bleiben. Andere entscheiden nach einem Tag, dass es nichts für sie ist. Der Betrieb bildet auch aus. „Kommen die Mitarbeiter hier aus der Gegend?“ –„Ja, die meisten. Ein paar aus Osteuropa, die arbeiten vor allem in der Kuttelei.“ Ich frage mich, was das wohl ist.
Philip kommt, immer noch schnaufend, mit Schutzkleidung für mich zurück. Der Overall ist mir ein paar Nummern zu groß und hängt wie eine Pluderhose über die ebenfalls zu großen Gummistiefel. Ich streife mir ein Haarnetz über und setze einen Schutzhelm auf. Ich sehe lächerlich aus. Wozu ich überhaupt einen Helm brauche, verstehe ich nicht. Was zur Hölle sollte auf mich herabfallen?
„Na, dann komm.“ Philip öffnet eine riesige Metalltür, die auch den Tresorraum einer Bank versperren könnte. Ein kalter Lufthauch weht uns entgegen, es riecht nach Desinfektionsmittel und muffigem Kühlschrank. Wir gehen einen kühlen Betonflur entlang. Ich muss mich so darauf konzentrieren, nicht mit meinen riesigen Gummistiefeln zu stolpern, dass ich fast in Phil hineinlaufe, als er plötzlich stehen bleibt.
„Du sprichst mit niemandem, okay?“
„Oh, ja klar, okay.“
Wir betreten den Schlachthof. Jetzt verstehe ich, warum ich einen Helm brauche. Über mir klirren und quietschen Ketten. Von den Metallgerüsten an der Decke hängen schwingende Haken mit Tierkadavern, eine Szenerie wie aus einem Steampunk-Comic. Die Rinder wurden an den Hinterbeinen aufgehängt. Sie sehen monströs aus – wie prähistorische Biester in Höhlenmalereien, blutrot, mindestens doppelt so groß wie ein Mensch und in der Mitte gespalten. Ich schaue nach oben, halte meinen zu großen Helm fest und sehe dann, dass die Wände mit Blut bespritzt sind. Schreiendes Rot auf weißen Badezimmerfliesen, wie nach einem Massaker in einem Gangsterfilm. Die Assoziation kommt mir klischeehaft vor, aber es stimmt: Nur in Filmen habe ich so etwas schon mal gesehen. Ich versuche verzweifelt, mich zu konzentrieren, an Fragen zu denken, die ich stellen könnte, vernünftige Fragen.
Philip schreitet vor mir durch dieses fremde Land, er spricht eine Sprache, die ich kaum verstehe: „Anhängen, Stechen, Lebendgewicht, Schlachtgewicht …“ Männer bewegen sich schweigend durch den Raum, jeder geht seiner Aufgabe nach. Sie tragen Gummistiefel und Plastikschürzen, ihre blauen Overalls sind oft über den Ellbogen abgeschnitten, sodass man ihre Tattoos sieht. Es sind überwiegend große Kerle, aber die Haarnetze geben ihnen etwas seltsam Feminines. An ihren Gürteln klirren Messer. Manche tragen Kettenschürzen und Kettenhandschuhe. Ich höre eine Kettensäge, und ein Mann geht mit einem halben Schaf über der Schulter an mir vorbei.
Phil erklärt mir den Ablauf hier. Er erzählt mir von der gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchung der Schlachttiere und des Fleisches durch amtliche Tierärzte und Fleischkontrolleure. In seinen Worten werden die Tiere nicht geschlachtet, sondern „abgefertigt“. Sie werden nicht ausgeweidet, sondern es wird eine „Eviszeration vorgenommen“. Ich lasse mir das Wort auf der Zunge zergehen: Eviszeration. Ich glaube nicht, dass ich das jemals schon gehört habe. Die Innereien – Herz, Lunge und Leber – liegen zur Untersuchung in Schalen. Bauchfett hängt von einem Gestell, der Anblick erinnert mich an die Unterhosen einer alten Oma. Wenn ich nicht so entsetzt wäre, könnte ich darüber vielleicht lachen. Tierteile, die ich nicht einmal bestimmen kann, werden auf ihrem Weg zur Kuttelei an mir vorbeigerollt. Es ist, als hätte ich eine Zeitreise unternommen und wäre auf einem mittelalterlichen Fleischmarkt gelandet.
„Okay, dann lass uns mal nach deinen Schweinen schauen.“ Dieses Mal gibt es keine Bedenkzeit. Ich folge Phil in den Tötungsraum und zwinge mich, hinzuschauen. Die Schweine kommen in Zweierpaaren herein, denn sie sind die intelligentesten Tiere hier und nicht gern allein – jedenfalls nicht in undurchsichtigen Situationen. Genau wie uns beruhigt es sie, einander ansehen zu können. Sie blinzeln, ein wenig verunsichert und verwirrt, wo sie hier gelandet sind. Dann kommen zwei Schlachter, starke Männer, sie können die Schweine mit ihren Beinen zurückdrängen. Die elektronische Betäubungszange – etwa so groß wie eine Heckenschere – wird beim ersten Tier angesetzt, es zappelt kaum und geht gleich zu Boden, auch wenn der Strom zur Sicherheit noch weiterfließt. Das andere Schwein sieht für einen Moment perplex aus, aber nicht panisch, dann ist es selbst an der Reihe und geht zu Boden. Die Tiere werden sofort hochgezogen und aufgehängt. Eine Sekunde, zwei, drei, vier, nach weniger als 15 Sekunden ist die Kehle schon durchtrennt und Blut spritzt hervor. Das war’s.
Ich schreibe alles Mögliche in mein Notizbuch, um meine Eindrücke festzuhalten, aber „auf humane Weise abgefertigt“ steht nicht da. Man hat mir gesagt, dass es schnell geht, und das stimmt. Das Töten ist gar nicht das Brutalste an der Sache. Sondern das, was danach geschieht: Abrühen, Häuten, Verbrennen – die „Eviszeration“.
Ich stehe an der Seite, versuche niemandem im Weg zu sein, ein gefährliches Gefühl in diesem Raum voller Messer, Feuer, gespaltener Hufe. Die Sauen hängen kopfüber, ihre Köpfe sind blutüberströmt, es tropft von ihren Ohren, ihren Wimpern. Phil erklärt es mir in seiner Sprache. „Zunächst wird die oberste Hautschicht entfernt.“ Ich sehe ein Schwein, das vor ein paar Tagen vielleicht noch an mir geschnuppert hat, schwer auf ein Förderband plumpsen. „Es wird abgebrüht, nicht gekocht.“ Der Körper kommt sauber aus dem heißen Wasser. Die jetzt borstenfreie, faltige Haut an der Lende sieht aus wie die eines Elefanten. „Das Maul und der Anus werden abgeschabt.“ Das restliche Haar wird mit einem Gasbrenner abgeflämmt und das Fleisch mit einem Brandzeichen versehen, es riecht nach Scheiße, nach Blut und jetzt auch noch nach verbranntem Fleisch. Ich halte den Blick gesenkt, versuche Notizen zu machen, aber mein Kopf ist leer. Ich konzentriere mich darauf, ruhig zu bleiben, doch meine Beine zittern, und meine Notizen ergeben keinen Sinn: „Beine gespreizt, Schwein wird gedreht, Flamme, Rost, Blut, ein Meer von Blut …“
„Die Männer töten zwanzig Schweine pro Stunde“, sagt Phil. „Sie haben Acht-Stunden-Schichten von sieben bis halb fünf, mit Pausen.“ Es ist schwere körperliche Arbeit, nicht zu vergleichen mit einem Bürojob. Die Männer schärfen ihre Messer und machen dann weiter, schneiden die Schweinefüße und -schwänze ab. Sie sind kräftig und wirken so gefühllos wie ihre Werkzeuge. Sie sind beschäftigt, hellwach, haben rötliche Wangen und Tätowierungen bis zum Handgelenk, einer trägt Diamantohrringe wie David Beckham.
Denis hat gesagt, der Schlachthof sei ein ruhiger Ort, im Tötungsraum ist er aber nicht gewesen – weiter als bis zum sogenannten Wartestall begleitet kaum ein Viehhalter seine Tiere. Die rostigen Geräte scheppern und dröhnen, die Flammen der Gasbrenner rauschen. Ich bin vor dem Schreien der Schweine gewarnt worden, aber ich höre nicht einen Mucks. Wochen später erzählt mir eine spanische Freundin von einer Schlachtung in ihrem Heimatdorf: „Diese Schreie werde ich nie vergessen.“ Hier quiekt niemand „wie ein abgestochenes Schwein“. Vielleicht würde es das Ganze irgendwie leichter machen, wenn das Schlachten Teil von etwas Größerem wäre, einer Tradition, ein Familienereignis, wie es früher im Winter überall in Europa stattfand. Ich fühle mich furchtbar allein, verwirrt, überfordert.
Mir ist bewusst, dass Phil mich auf die Probe stellen will, aber das ist mir egal. Ich muss den Raum verlassen. Meine Hände zittern und ich muss mich zusammenreißen, um einen Fuß vor den anderen zu setzen. Es sind nicht nur die riesigen Stiefel, die meine Schritte verlangsamen, sondern auch mein beinahe unkontrollierbares Zittern. „Ich will das nie wieder sehen“, schreibe ich. Und: „Ich esse NICHTS mehr, was aus dem Schlachthof kommt.“
Die Männer um mich herum arbeiten weiter. Einer pfeift. Irgendwelche Innereien fliegen an meinem Kopf vorbei. Ich nehme an, jetzt machen sie sich über mich lustig. Ein Wagen mit Fleischabfällen wird an mir vorbeigeschoben und Blut aus Milchkannen in den Abguss geschüttet. Ich schaue auf den Boden – er ist rot gestrichen. Natürlich ist er das. Muss er ja, sonst wäre er andauernd blutverschmiert. Wie Lady Macbeths Hände würde er nie wieder sauber werden. Ich frage mich, ob alle Schlachthöfe rote Böden haben.
Niemand könnte das hier jemals filmen, denke ich, es ist zu krass: allein das weinrote Blut, das schäumend aus der Milchkanne fließt! Kein Zuschauer würde das glauben, es kommt einfach zu viel Blut aus der Kanne, es sieht fast wie ein Getränk aus, dickflüssig und nahrhaft. Ich muss hier nicht mal verdeckt recherchieren, um vollkommen schockiert zu sein. Dieser Vorgang – auch wenn er legal ist, auch wenn es sich um das „beste Verfahren“ handelt – ist einfach zutiefst verstörend. „Her mit den Überwachungskameras“, sagt Phil. „Wir haben nichts zu verbergen.“ Nein, wirklich nicht, denke ich – bis auf alles. Niemand würde es ertragen, auch nur einen Teil hiervon zu sehen. Aus gutem Grund stammen die Videos, die im Internet kursieren, ausschließlich von Protestgruppen. Es gibt keinen ästhetischen Weg, das zu filmen oder zu fotografieren. Oder darüber zu schreiben.
Phil kommt zu mir, er schaut die Wände an, die Männer, überallhin, nur mir nicht in die Augen. „Gefällt dir nicht, das Ganze?“, fragt er.
„Nein, tut es nicht.“ Ich spüre Wut in mir hochkochen. Was willst du mir sagen, Phil? Ich sehe, dass ich ihm leidtue, wie ich hier in meinem Clownsaufzug stehe, mit krakeligen Notizen und zittrigen Händen.
„Verleg dich bloß nicht aufs Bäume-Umarmen, Louise. Wenn man aufhört, Tiere zu halten, wo zur Hölle sollen die dann alle hin? Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass deine Schweine auf humane Weise zu Tode gekommen sind.“ – Ich nicht, aber ich bin mir bei gar nichts mehr sicher. „Die Menschheit muss entscheiden, ob wir Fleisch essen oder nicht“, fährt Phil fort. „Wenn die Löwen in der Serengeti aufhören, Antilopen zu jagen, dann höre ich auch auf. Und ich sag dir was: Ich wäre lieber so ein ahnungsloses Schwein, als dass ein Löwe mich zerfleischt.“ Nein, denke ich, mir wäre alles lieber als diese Hölle. Wenn ich die Wahl hätte, hätte ich lieber einen Löwen auf den Fersen, wirklich. Phil seufzt.
Das Reinemachen hat begonnen, Dampf und Sprühnebel erfüllen den Raum. Ich bin jetzt froh über meinen Overall. Ich will dieses Wasser mit Gott-weiß-was- für-Partikeln darin – Gehirn, Innereien, Blut – nicht auf meinen Kleidern haben. Es riecht nach Waschsalon, nach frischer Wäsche. Stärker parfümiert als Spül- oder Waschmittel, süßlicher; ein Duft, der enorm viel überdecken muss.
Wir gehen zurück ins Büro. Ich stelle mich in die Ecke, als hätte ich etwas falsch gemacht. „Ich glaube, ich habe dich traumatisiert“, sagt Phil nicht ohne gewisse Genugtuung. Und ich glaube, er könnte sogar Recht haben. Ich nehme das Haarnetz vom Kopf, ziehe den Overall aus und bereue ein wenig, meine neue Bluse angezogen zu haben. „Ha, Bambi!“, lacht Phil.
Audrey ist immer noch da, aber niemand bietet mir eine Tasse Tee oder auch nur ein Glas Wasser an. Phil setzt sich an seinen Tisch und packt sein Lunchpaket aus. Er hat Schinkensandwiches dabei – was sonst. „Hat hier jemals ein Vegetarier gearbeitet?“, frage ich. Audrey und Phil lachen: „Nein.“ Ich frage nach Phils Familie, und endlich kommt bei ihm eine weichere Seite zum Vorschein. Der Schlachthof ist ein Familienbetrieb, Phil hat die Leitung von seinem Vater übernommen. „Ich wollte so werden wie mein Vater“, sagt er. „Will das nicht jeder Sohn?“ Er ist vierfacher Großvater. Sein fünfjähriger Enkel hat ihn schon im Schlachthof besucht, aber noch keine Schlachtung miterlebt – noch nicht.
Ganz offensichtlich ist Phil stolz auf seinen Job. „Ich finde es befriedigend, eine Aufgabe gut zu erledigen“, sagt er. „Leute zu ernähren. Wer will schon amerikanisches Rindfleisch essen, bei dem man nicht weiß, wo es herkommt? Ich sorge dafür, dass unsere Bauern ihr Fleisch hier vor Ort verkaufen können.“
Das stimmt. Mit welchem Recht meine ich, über jemanden urteilen zu dürfen, der einer ordentlichen Arbeit nachgeht? Ich komme mir dumm vor, voreingenommen, verhätschelt. Dieser Schlachtbetrieb wendet vielleicht nicht die raffiniertesten, modernsten Schlachtmethoden an, aber er hat einen guten Ruf. Er beschäftigt Leute aus der Region, und was am wichtigsten ist: Während andere kleine Schlachthöfe schließen, sorgt dieser dafür, dass Kleinbauern weiterhin Tiere zur Fleischproduktion halten könne – dieselben Bauern, die uns bitte schön mit nachhaltig produziertem Fleisch versorgen sollen.
Phil legt seine Füße auf den Tisch. „Politiker und Journalisten haben mehr Stress als ich …“ Kann ich bestätigen, denke ich. „Ich leiste gute Arbeit, und darauf bin ich stolz.“ Ich frage ihn, welche Auswirkungen die Arbeit auf seine Angestellten hat. „Ich glaube nicht, dass sie sich groß damit auseinandersetzen. Sie sehen nur eine Gestalt, die wieder verschwindet, einen Gegenstand. Hier arbeitet niemand, der das nicht will“, sagt er. „Die Männer, die sich für die Schlachterei interessieren, bleiben ihr Leben lang hier, andere hören nach ein paar Tagen wieder auf.“ Tendenziell sind Schlachthof-Mitarbeiter tatsächlich über Jahrzehnte hinweg in einem Betrieb beschäftigt – so wie Phil. Aber es gibt auch Hilfsarbeiter, die für diese Arbeit von Stadt zu Stadt ziehen. Phil erzählt mir von einem 19-jährigen Jungen, der eben erst hier angefangen hat, weil ihm sein vorheriger Job in einer Autowaschanlage keine Perspektiven geboten hat. „Er macht sich wirklich gut, kann sein, dass er dabei bleibt …“
Pam Morrison, eine der leitenden Angestellten, kommt herein. Sie trägt einen weißen Arbeitsmantel und Gummistiefel, ihre Frisur ist von Haarnetz und Helm völlig unbeeindruckt geblieben. Pam war früher Filialleiterin bei Marks & Spencer und sieht aus, als könnte sie jederzeit wieder dort anfangen. Sie ist dezent geschminkt und trägt Goldschmuck. Ich bin überrascht, dass sie sich dafür entschieden hat, stattdessen hier zu arbeiten, aber sie betont, der Job sei interessant und gut bezahlt. Wie viele Schlachthof-Mitarbeiter stammt auch sie aus einer Metzgerfamilie.
„Ja, es ist eher eine Männerwelt“, sagt sie. „Aber was erwartest du? Man muss ja kräftig sein für die Arbeit.“ Sie selbst ist vernünftig, sorgfältig, praktisch veranlagt – Eigenschaften, die man hier ebenfalls braucht. „Wir tun keinem Tier vorsätzlich Leid an“, sagt sie. „Ich liebe Tiere.“ Ich mache mich zum Aufbruch bereit, gebe ihr die Hand und versuche zu lächeln, aber sie will mir unbedingt noch ein Foto von ihren Hunden zeigen, zwei Japan-Spitzen. Ich sollte sicher seufzen und sagen, wie süß sie sind, aber ich bin wie betäubt, ich sehe nur weißen Plüsch. „Ich würde jedem Menschen an die Kehle gehen, der einem Tier etwas zuleide tut“, sagt sie.
Ich setze mich in mein Auto und warte auf Tränen, aber es kommen keine. Ich muss mit jemandem reden, der mich gut kennt, und rufe meine Schwester an. Wie immer muss sie gleichzeitig ihre Kinder hüten und ist ein bisschen abgelenkt, also erzähle ich ihr im Schnelldurchlauf, was gerade passiert ist. Ich sage ihr, dass ich geschockt bin, mich schmutzig fühle, als hätte ich etwas falsch gemacht. Sie versucht, mich wie ein Kind zu trösten. „Du hast nichts falsch gemacht, es ist alles in Ordnung, du wirst dich schon wieder davon erholen. Du musst mit Vernunft an die Sache herangehen, dich davon distanzieren.“
Ich weine nicht, aber ich sage ihr, wie lieb ich sie habe, was ungewöhnlich ist. In unserer Familie sagen wir so etwas eher selten, eigentlich nur im Ausnahmefall. Dann fragt sie: „Soll ich Vegetarierin werden? Soll ich den Kindern kein Fleisch mehr zu essen geben?“ Und ohne nachzudenken sage ich: „Nein.“ Es ist ein interessanter Moment. Ich komme wieder zu mir. Das hätte doch eigentlich mein erster Gedanke sein müssen: dass das Schlachten ein Ende haben soll. Aber nein, mein erster Gedanke ist: Ich möchte nicht, dass irgendjemand das mit ansehen muss. Niemand sollte sich das je ansehen müssen.
Alles hat sich verändert. Ich glaube nicht mehr, dass jeder einen Schlachthof besuchen sollte. Wir sollten davor beschützt werden, unsere Unschuld bewahren, wie Kinder. Heutzutage erlebt man nicht mehr mit, wie das Schwein auf dem Nachbarhof gestochen und zerlegt wird. Es sei denn, man lebt in einem Dorf in Frankreich oder Spanien, wo solche Traditionen noch gepflegt werden. Wir sind zu schwach, wir müssen uns davon abkoppeln. Um uns zu schützen, um zu überleben. Aber eine leise Stimme in mir fragt: Geschehen nicht genau deswegen all die schlimmen Dinge auf der Welt, Kriege, Folter? Bist du nicht mutig genug hinzuschauen? Obwohl du es doch besser machen willst?
„Nein, Louise“, sagt meine Schwester. „Lass dich jetzt nicht wieder in eine deiner Gedankenspiralen reinziehen.“ Dann heult ein Kind, und sie legt auf.
Ich reiße mich zusammen und mache mich auf den Heimweg. Das Radio bleibt ausgeschaltet. Ich hoffe, dass ich während der Fahrt alles ein bisschen verarbeiten kann. Und ich denke nicht an die Schweine, ich denke über mich selbst nach. Ich habe Angst, dass ich die Büchse der Pandora geöffnet habe und sie nie wieder schließen kann. Dass ich das alles niemandem erklären, nie mit jemandem teilen kann. Ich bin alleine. Ich fahre von der M8 ab und lasse meinen Tränen freien Lauf.
Der Geruch hält sich tagelang. Zuerst denke ich, es wäre noch Gülle oder Blut an meinen Schuhen, aber dann wird mir klar, dass ich es bin. Ich schwitze meine Angst aus; ich kann es riechen, so wie Tiere Angst riechen können. Ich habe Erinnerungsflashs. Im Traum, im Bad, als ich plötzlich Nasenbluten bekomme, rot auf weißen Fliesen, an der Fleischtheke im Supermarkt. In den Nachrichten wird von einem weiteren Nahostkrieg berichtet, von weiteren Bomben im Irak, in Syrien. Wenn man die Büchse erst einmal geöffnet hat …
Schließlich nehme ich all meinen Mut zusammen und besuche Fred und die Schweine. In der Küche herrscht Hochbetrieb. Fred läuft zwischen Zubereitungstisch, Backofen und Spüle hin und her, ruft Anweisungen durch den Raum. „Schau mal!“ Er hebt den Deckel von einem Topf, ich sehe Lorbeerblätter, Nelken und Schweinefüße; er holt eine Bratpfanne hervor und stellt sie auf den Herd. Er klatscht sich auf die Hüften, die Schultern, den Hintern: „Lende, Schulter, Schinken.“ Das Schwein ist hier wieder etwas anderes: ein Gegenstand. „Willst du den Kopf sehen?“ – „Nein! Na gut, doch.“ Der Kopf wirkt hier anders, er sieht okay aus. Aber dann muss ich an die schwarzen Flecken der Gloucester Old Spots denken, an das Kratzen ihrer Borsten, an Peppa Wutz. Ich frage mich, wie etwas Positives – das Leben auf der Gorgie Farm, Freds Vorschlag, die Tiere zu begleiten – sich in einen solchen Albtraum verwandeln konnte.
„Ach, Louise“, sagt Fred. „Du darfst keine Beziehung zu den Tieren aufbauen – vor allem nicht zu Schweinen. Die Bauern tun das nicht, niemand tut das.“ Fred bittet die Bauern nie, ihm Fotos von den Rindern zu schicken, die er verarbeitet; es ist zu verstörend. „Alle hassen das, niemandem gefällt das“, sagt er. „Aber als Koch habe ich die Verantwortung: Meine Gäste vertrauen darauf, dass ich sie und ihre Kinder gut versorge. Bestimmte Dinge musst du wissen, zu anderen musst du Abstand halten.“ Fred ist es wichtig, eine Farm zumindest einmal besucht zu haben, um gesehen zu haben, dass es den Tieren dort gut geht. Er weiß, wie sie getötet werden, und verarbeitet den gesamten Schlachtkörper. „Ich will eine Verbindung herstellen zwischen den Männern, die sie großgezogen haben, denen, die sie getötet haben, und mir. Ich will sicherstellen, dass die Tiere von Menschen aufgezogen wurden, die eine Leidenschaft fürs Essen haben.“
Er akzeptiert den Tod als Teil des großen Ganzen – einen Teil, über den jeder Bescheid wissen sollte. „Wir sind schwächer als früher“, sagt er. „Weil wir überhaupt keine Beziehung mehr zu unserer Nahrung haben.“ Fred gibt den Supermärkten die Schuld daran. „Es ist verführerisch zu denken, dass die verantwortlich dafür sind, woher unser Essen kommt – sind sie aber nicht. Denk nur an den Pferdefleischskandal. Letzten Endes hatte der sogar sein Gutes, denn er hat die Leute zum Nachdenken gebracht.“ Fred legt eine Hand an den Kopf. „Wir müssen wissen, woher die Tiere kommen, wegen der Qualität, wegen des Geschmacks.“ Er legt eine Hand auf die Brust. „Und weil dein Herz es wissen will.“
„Essen bedeutet Freiheit“, sagt Fred. „Wenn du das verstehst, hast du die Wahl. Wenn du es ignorierst, nimmt der Supermarkt dir alle Entscheidungen ab. Ich weiß, woher ein Tier kommt, und ich weiß, wie man es mit Respekt behandelt. Ich verarbeite alles, bis auf die Zähne und die Knochen.“ Er zeigt mir einen Kochtopf mit Schweinebauch in Sauerkraut, holt marinierte Lendenkoteletts und knusprige Schweineohren hervor.
Ich denke daran, was Ross gesagt hat – dass man einen traumatischen Vorfall verarbeiten kann, indem man Geschichten erzählt. Fred erzählt Geschichten mit seinem Essen. Und indem ich mich mit Fred unterhalte, tue ich das Gleiche. Wir erzählen alle Geschichten, die ganze Zeit. So geben wir unserem Leben Sinn, unseren Entscheidungen, unserem Essen.