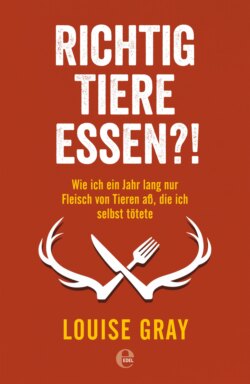Читать книгу Richtig Tiere essen?! - Louise Gray - Страница 12
Meine Macnab-Challenge
ОглавлениеSo wie niemand als Künstler geboren wird,
so kommt auch niemand als Angler auf die Welt.
Izaak Walton
In dem Buch Der vollkommene Angler von Izaak Walton, einem Klassiker aus dem 17. Jahrhundert, lernt ein junger Mann, wie man angelt. Es ist eine charmante Geschichte mit sanftmütiger Philosophie und nach der King-James-Bibel das am zweithäufigsten aufgelegte Buch in englischer Sprache. Ich nehme es zur Hand und verstehe schnell, warum. Die Sprache ist veraltet, aber die Botschaft ist zeitlos. Das Buch verspricht Frieden sowie Verbundenheit mit der Natur und mit Gott, wenn wir nur alle angeln gehen. Ich bin begeistert.
Angeln scheint mir ein guter Einstieg zu sein, wenn ich lernen will, mir meine Nahrung selbst zu beschaffen. Angler sind ein freundliches Völkchen, und sie sind überall – allein in Großbritannien angeln vier Millionen Menschen. Mein erster Angellehrer ist der Journalist und Autor George Monbiot. Eigentlich treffen wir uns, um über Rewilding zu sprechen: den Versuch, lokal ausgestorbene Arten, sogar Wölfe, wieder in den Highlands anzusiedeln. Aber der Abend ist zu schön, um nur herumzusitzen und zu reden, also gehen wir am Loch Dughaill in der Nähe von Shieldaig Fliegenfischen. Es ist Ende April, die Kuckucke sind gerade aus Afrika zurückgekehrt. Nach dem langen, harten Winter hat das Farndickicht einen Orangeton, das Moos glänzt; alles Grün wurde vom hungrigen Wild weggeknabbert, doch Veilchen und Primeln kommen schon wieder hervor.
Während er eine Fliege heraussucht, erklärt mir George, was derzeit in der Natur vor sich geht. Die Zuckmücken schlüpfen bald, und dann werden die Forellen auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Gemeinsam betrachten wir seine Sammlung an handgefertigten Fliegen. Eine Fliegenbox hat durchaus Ähnlichkeit mit einer Juwelensammlung. All die schönen Farben und die lächerlichen Namen: eine „Wickham’s Fancy“ oder eine „Grouse & Claret“? Eine „March Brown“ oder eine „Half Hog“? Letzten Endes sucht George einen kleinen braunen Köder aus, der auf mich eher schäbig wirkt.
Wir befinden uns im westlichsten Überbleibsel des kaledonischen Kiefernwaldes. Coille Creag Loch, das Waldgebiet am Ufer des Sees, erstreckt sich über die umliegenden Berge. Die Abendsonne scheint auf die 250 Jahre alten Kiefern; der Wald selbst ist 8000 Jahre alt. Es ist eine andere, beinahe mediterrane Welt, jedenfalls verglichen mit dem kniehohen Gestrüpp, das in anderen Gegenden Großbritanniens als Wald bezeichnet wird. Hier findet sich das, was George wiederbeleben will: ein Umfeld, in dem man Waldameisen, Fichtenkreuzschnäbel, rote Eichhörnchen oder sogar Luchse auf der Suche nach Beute umherstreifen sieht.
„Am Fliegenfischen gefällt mir, dass es dem steinzeitlichen Jagen ähnelt“, sagt George. „Besonders, wenn man den Fisch sehen kann. Du hast mit der Angel den gleichen Abstand zum Tier wie unsere Vorfahren mit dem Speer. Es geht darum, den Fisch zu finden, ihn zu verfolgen, sich langsam hinter ihm aufzubauen, sich auf die Umwelt einzustellen. Man muss sich darüber im Klaren sein, was der Fisch tut, was er vorhat und was um ihn herum geschieht. Was für Fliegen sich über dem Wasser befinden. In welchem Stadium sie sind. Es ist ja nicht so, dass du den Fisch aufspießt – der Fisch spießt sich selber auf, das ist eine ganz andere Art von Gefecht.“ Außerdem ist es leise, denke ich. Schüsse erschüttern die Welt. Beim Fliegenfischen wirft man die Schnur, und wenn man Erfolg hat, kommt der Tod in aller Stille.
Forellen ernähren sich von Insekten und Kleintieren. Sie schwimmen gegen den Strom, um an ihre Beute zu kommen. Innerhalb von Minuten hat George einen Fisch an der Angel, der sich „selber aufgespießt“ hat. George holt die Schnur ein, er lacht vor Aufregung. Es ist eine Bachforelle, goldbraun mit roten Punkten. George hat eine Angel ohne Widerhaken benutzt und lässt die Forelle gleich wieder frei. Ich denke an eines meiner Lieblingszitate aus Der vollkommene Angler: „Du kannst nicht verlieren, was du nie besessen hast.“
Bachforellen sind wandelbare Tiere. Sie können als Jungtiere ins Meer abwandern und sich dort in silberfarbene Meerforellen verwandeln. Sie können aber auch in dem See bleiben, in dem sie geboren wurden. Sie können auf den Grund des Sees herabsinken und als hässliche Feroxforellen ihre Geschwister fressen. Oder sie bleiben an einer Flussmündung und führen dort ein wahres Lümmelleben ohne jemals ins Meer weiterzuschwimmen.
Schnepfen hüpfen über die Steine, langsam macht mir die Sache richtig Spaß. Man sagt, Angeln habe etwas Meditatives. Aber ich bin nicht entspannt – ich will unbedingt einen Fisch fangen! Vielleicht steckt ein Steinzeitjäger in mir? Ich ziele auf Stellen, wo das Wasser sich kräuselt, weil dort gerade ein Fisch an der Wasseroberfläche ist, aber wieder kommt George mir zuvor. Diesmal hat er erstaunlicherweise zwei Fische gefangen. Der zweite ist silbern: Es handelt sich also um eine ins Meer abgewanderte und wieder zurückgekehrte Forelle, die sich mit ihrem Schwanz in der Schnur verheddert hat. Wir sind begeistert von diesem außergewöhnlichen Zufall, Anglerfreude kommt auf. Ich verstehe, warum vier Millionen Menschen süchtig danach sind.
Ein paar Tage später fange ich am Loch Damph schließlich meine erste eigene Forelle. Wie George habe ich eine kleine braune Fliege als Köder benutzt. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Köder nennt, auf jeden Fall ähnelt er den Mücken, die mich umschwirren. Die Dämmerung bricht an, und die Fledermäuse kommen hervor. Schon nach ein paar Würfen spüre ich den Zug einer Forelle. Sie hat die Farben des Sees, der Bauch ist cremegelb wie ein Sandstrand, der Rücken golden und schwarz wie die Wasseroberfläche.
Ich bekomme einen Schreck, als ich ihre winzigen, nadelartigen Zähne sehe. Dieser Fisch kann töten, wenn er will. Ich entlasse ihn wieder ins Wasser, in die Umwelt, an die er sich so gut angepasst hat. Er scheint kurz durchzuatmen, bevor er wie ein Pfeil davonschießt – wer weiß, wohin? Es ist ein großartiges Gefühl. Die meisten Angler lassen ihren Fang wieder frei. Aber wenn ich einen Fisch essen will, muss ich wohl auch einmal einen töten.
Wie bei den Muscheln ist die Wissenschaft geteilter Meinung darüber, ob Fische Schmerz empfinden oder nicht. 2003 behaupteten Wissenschaftler der Universität Edinburgh, den ersten Beweis dafür gefunden zu haben. Sie injizierten Bienengift in die Lippen von Regenbogenforellen und beobachteten, dass die Fische ihre Mäuler daraufhin an Kies rieben. Andere Studien besagen, dass Fische keine geeignete Gehirnstruktur oder ausreichend Nervenrezeptoren haben, um Leid zu empfinden. Fühlende Wesen sind Fische zweifellos. Sie bauen ihre eigenen Nester, sie kommunizieren im Schwarm, und wenn ein unerfahrener Fischer die Uferböschung heruntergetrampelt kommt, fliehen sie. Sie bluten, genau wie wir.
Fische wie die Forelle sind ein wichtiger Teil des Ökosystems, und in Großbritannien gelten viele Arten als bedroht. Übermäßige Grundwasserentnahme im Südosten des Landes trocknet die Nebenflüsse aus, bei Stürmen gelangt Abwasser in die Flüsse und der Einsatz von Düngemitteln lässt die Algen in den Gewässern wuchern. Viele Leute bekommen das kaum mit. Es sind die Angler, die sich für den Lebensraum ihrer Beute einsetzen. Die weitgehend unbekannte britische Umweltorganisation Fish Legal, die zum Anglerverband Angling Trust gehört, leistet hier hervorragende Arbeit. Sie schlägt Alarm, wenn Gewässer verschmutzt werden, und verfolgt die Übeltäter.
Wenn sie die Fische nicht ins Wasser zurücksetzen, töten die Angler sie mit einem Schlag auf den Kopf, anstatt sie ersticken zu lassen, wie es auf Fabrikschiffen der Fall ist. Und sie töten nur sehr wenige Tiere. Angler schützen unsere Flüsse. Wenn sie gelegentlich ein oder zwei Fische zum Abendessen mit nach Hause nehmen, werfe ich ihnen das nicht vor.
Angler sind ein freundliches Völkchen, und ich werde oft eingeladen, meine noch etwas amateurhaften Fähigkeiten zu verbessern. Andy Richardson, ein Wildheger aus Fife, meint, er könne mir einen Fisch „garantieren“. Wir treffen uns an seinem Haus, der Devil’s Lodge. Andy nimmt seinen Labrador und einige handgebundene Köder mit, deren genaue Beschaffenheit ein Anglergeheimnis bleiben soll. Jetzt im Frühling kommen am River Eden gerade die Windröschen hervor. Als wir durch Bärlauch stapfen, sehe ich die ersten Schwalben am Himmel. Am Boden entdecke ich Tierspuren. Ich vermute, dass ein Otter hier entlanggelaufen ist, aber Andy korrigiert mich – die Spuren stammen von einem Dachs.
„Ach, der Fluss ist tot, jedenfalls im Vergleich zu früher“, sagt er mit einem Nicken in Richtung der gedüngten Felder um uns herum. In Andys Kindheit tummelten sich Forellen und Lachse im Fluss. Inzwischen wird der Bachforellenbestand künstlich wieder aufgestockt, Lachse und Meerforellen sind selten geworden. Freiwillige Helfer beschneiden die Bäume und legen sich mit Abwasserbehörden und Bauern an, damit die Wasserverschmutzung weniger wird, aber nichts bringt die Meerforelle zurück. Vielleicht sind auch die Fischfarmen oder das Überfischen des Meeres das Problem?
Ich werfe die Schnur ins flache Wasser, sehe eine Wasseramsel hin- und herflitzen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie gerade ein Nest baut oder ihre Jungen füttert. Als wir schließlich eine Bachforelle fangen, steht Andy schon mit einem Fischtöter bereit – dabei handelt es sich um eine mit einem Gewicht versehene Geweihsprosse. Ich gebe dem Fisch einen Schlag auf den Kopf, und obwohl er noch ein paarmal mit dem Schwanz schlägt, liegt er bald ganz still da. Es ist ein brutaler Akt. Lord Byron hat sich früher über die Grausamkeit des Fischetötens beschwert, aber ich denke, Fisch gegessen hat er doch. Ich streiche über die bunt schillernden Schuppen. Die Forelle ist silberner als ein gewöhnlicher Seefisch, und ihre Schuppen fassen sich ganz anders an als Fell. Vielleicht liegt es daran, dass Fische als Kaltblüter so anders sind als wir, dass das hier sich für mich okay anfühlt. Vielleicht bin ich aber auch selbst kaltblütig geworden.
Ich nehme den Fisch aus, schneide mit einem Messer von der Kloake, dem Loch direkt vor der Afterflosse, bis zum Kinn. Die Innereien zu entnehmen ist ganz einfach. Schließlich gleite ich mit dem Daumennagel an der Wirbelsäule entlang, um die Blutgefäße und die Nieren zu entfernen. Von Andy habe ich ein Büschel Bärlauch und Tipps für die Zubereitung bekommen. Später reibe ich den Fisch mit Butter ein und fülle ihn mit den intensiv duftenden grünen Blättern, dann umwickele ich das Ganze mit Alufolie. Als ich das Päckchen 20 Minuten später aus dem Ofen hole, riecht es nach Knoblauchbrot. Aber der Geschmack der Forelle kommt auch heraus, sie hat ein kräftiges, köstliches Aroma.
Eine Taube zu schießen heißt zunächst einmal, mit der Flinte schießen zu lernen. Flinten unterscheiden sich deutlich von der Waffe, die ich beim Kaninchen benutzt habe. Die Munition wird nicht in ein Magazin gegeben, sondern direkt in den Lauf, und die einzelnen Patronen enthalten einer Ladung voller Schrotkugeln. Drückt man den Abzug, wird eine tödliche Garbe in die Luft gefeuert – je mehr Kugeln, desto größer die Chance, das Ziel zu treffen.
Flinten sehen meistens ein bisschen schicker aus. Die Jagd mit der Flinte wird eher als „Sport“ betrachtet, und es wird mehr Aufhebens um die Gestaltung der Waffe und des Zubehörs gemacht. Ich habe keinen Waffenschein, sodass ich mir kein Gewehr kaufen darf. Außerdem ist Schießunterricht extrem teuer. Ich muss mich also an meinen Vater wenden. Das bringt uns in eine seltsame Situation. Für meine Brüder war es eine Selbstverständlichkeit, schießen zu lernen. Aber ich habe nie darum gebeten, auch nur einen Blick in den Waffenschrank werfen zu dürfen. Ich weiß, dass ich Glück habe, es ist etwas Besonderes, vom eigenen Vater unterrichtet zu werden, aber ich bin auch ein bisschen nervös. Nicht nur, weil es ums Schießen geht, sondern weil die Atmosphäre im wahrsten Sinne des Wortes „geladen“ ist. Mir fällt das Schießen ohnehin nicht leicht, und ich bin von Natur aus ein eher ungeschickter Mensch. Außerdem verspüre ich den Druck, zeigen zu müssen, dass ich die Sache genauso gut hinbekomme wie meine Brüder.
Mein Vater öffnet den Stahlschrank und sucht eine alte Waffe aus, eine einläufige Flinte, die um 1890 von Charles Boswell hergestellt wurde. Mein Vater nimmt sie aus ihrem Leinenbehälter, der an den Griffen sorgfältig mit Klebeband verstärkt ist, und überprüft zunächst, ob der Lauf leer ist. Die Flinte sieht schön aus. Ich bin weit davon entfernt, einen Waffenkult zu betreiben, habe mich da immer mit Vorsicht genähert, kann aber nicht übersehen, wie kunstvoll die verschnörkelten Gravuren auf dem Patronenlager gearbeitet sind, wie elegant der lange Lauf und der Schaft aus Walnussholz wirken. Die Waffe hat ein 12er-Kaliber, was sich wie bei der Büchse auf den Innendurchmesser des Laufs bezieht. Bei Flinten bedeutet eine niedrigere Zahl aber merkwürdigerweise eine größere Waffe. Die Zahl besagt nämlich, wie viele Kugeln in der Größe des Laufinnendurchmessers man bräuchte, um auf ein englisches Pfund bzw. 453,6 Gramm zu kommen. Eine Flinte im Kaliber 20 ist also eine eher kleine Waffe, weil in ihren Lauf eine Kugel passt, die ein Zwanzigstel von einem Pfund wiegt. Ins Kaliber 12 passt dagegen eine Kugel, die ein Zwölftel von einem Pfund wiegt. Das Gewehr, das mein Vater hervorgeholt hat, wurde wahrscheinlich für einen Jungen hergestellt, der schießen lernen sollte. Ich frage mich, wer dieser Junge war und ob er den Ersten Weltkrieg überlebt hat. Was für eine schreckliche Zeit für Kindheit und Jugend! Vielleicht gehörte die Flinte auch einer Frau, einer dieser Damen, die auf den Fotos aus der viktorianischen Ära so elegant mit ihren Gewehren posieren?
Schießen geht mit einer Reihe von Verhaltensvorschriften einher, die vor allem die Sicherheit beim Umgang mit der Waffe gewährleisten sollen. Andere in Gefahr zu bringen wird, gelinde gesagt, als unfein betrachtet. Es gibt für jede Situation eine korrekte Verhaltensweise, und man muss mit kritischen Blicken rechnen, wenn man etwas falsch macht. Mein Vater zeigt mir, wie man die geöffnete Flinte trägt: Man legt sie sich mit nach unten gerichtetem Lauf über den Arm, wie einen langen Abendmantel – jeder soll sehen können, dass der Lauf leer ist. Die wichtigsten Regeln nennt ein Gedicht von Mark Hanbury Beaufoy, A Father’s Advice (1902), das die Toilettenwände vieler englischer Landhäuser ziert. Es beginnt mit dem Hinweis, dass man die Waffe nie auf einen anderen Menschen richten soll, und schließt mit den etwas unheimlichen Worten: „Alle Fasane dieser Welt / ersetzen nicht den Mann, der fällt.“
Die „Bos“, wie mein Vater das Gewehr nennt, ist nicht ganz leicht zu handhaben, ich muss mich erst daran gewöhnen. Ein paar Nachmittage lang nehme ich die ungeladene Flinte mit auf einen Spaziergang rund um den Hof. Wenn du sicher bist, dass niemand in der Nähe ist, hebst du sie auf Schulterhöhe, legst deine Wange an den Schaft, entsicherst die Waffe und zielst. In regelmäßigen Abständen bleibe ich stehen, betätige den Verschluss … Schulterhöhe … Wange … Sicherung … und flüstere: „Peng.“
Als Nächstes nimmt mein Vater mich zum Tontaubenschießen mit. Ich lege das Gewehr rechts an, aber wie sich herausstellt, ist mein linkes Auge dominant. Um meine Position besser bestimmen zu können, hilft es, wenn ich das linke Auge schließe. Ich muss ein bisschen üben, aber dann schieße ich mit befriedigender Beständigkeit Tontauben vom Himmel. Mein Vater rät mir, meinen Blick auf das Ziel zu richten, nicht auf das Ende des Laufs. „Taube sehen, Taube schießen“, sagt er. So lernen es die meisten Neulinge, wobei sie oft aufs Geratewohl auf Wildtauben schießen. In Schottland sind die „fliegenden Ratten“ besonders bei Bauern extrem unbeliebt. Tauben fressen Pflanzen, die gerade aus der Erde hervorsprießen, und können ganze Ernten vernichten. Also verbringen viele junge Männer, darunter immer mehr Hobbyschützen, ihre freien Nachmittage damit, Hunderte von Tauben zu schießen. Auf dem Hof meines Vaters hocken die Tauben in den Scheunen, in denen das Getreide gelagert wird. Mein Vater geht hinein und klatscht in die Hände. Die Vögel kommen herausgeflattert und verteilen sich in alle Himmelsrichtungen. Ich hebe das Gewehr, versuche an alles zu denken, was ich gelernt habe: Schulter … Wange … Sicherung – „Oh.“ Sie sind alle schon davongeflogen.
Mein Vater kommt. „Und, hast du eine erwischt?“
„Nein.“ Meine Stimme zittert.
Wir versuchen es noch ein paarmal. Mein Vater brüllt mich an, und zwar zu Recht, weil ich einen unkonzentrierten Moment lang das Gewehr auf ihn richte. Ich verliere die Nerven. Es bringt nichts. Ich kann das nicht! Ich bin den Tränen nahe. Das hier ist kein Tontaubenschießen. Es gibt keine Zeit zum Nachdenken. Es ist schwierig und gefährlich und ich bin nicht in der Lage, das zu tun, womit kleine Jungs sich ihr Taschengeld verdienen.
Zum Verspeisen eignen sich Ringeltauben (Columba palumbus) am besten. Weil Landwirte heute den Winter hindurch Getreide anbauen und aufgrund des Klimawandels ist die Population in den letzten Jahren auf 20 Millionen angewachsen. Für die Bauern stellen Ringeltauben wegen der Ernteschäden, die sie verursachen, ein großes Problem dar. Deswegen ist die Taubenjagd in Großbritannien auch für Hobbyschützen erlaubt. Wildtaube kann man beim Metzger oder Wildhändler kaufen, aber die meisten Tauben, die in Restaurants serviert werden, stammen seltsamerweise aus Käfighaltung in Frankreich. Viele Menschen, die Jagd als Sport begreifen, ziehen wildlebende Vögel Zuchtvögeln wie Fasanen vor.
Tauben sind nicht leicht zu schießen, weil sie zu rasanten Flugmanövern neigen. Man muss sie wie jedes andere wilde Tier genau beobachten und ihre Lebensbedingungen verstehen lernen. In gewisser Weise sehe ich Tauben zum ersten Mal, denn jetzt schaue ich wirklich hin. Ich beobachte, wie sie durch die Luft gleiten. Sie erinnern mich an Kinder auf dem Roller; sie schlagen mit den Flügeln, bis sie scheinbar jauchzend wieder in die Tiefe schießen, als wären ihre weißen Flügelbänder eigentlich Rennstreifen.
Tauben sind berechenbare Tiere, sie haben bevorzugte Flugrouten, so wie wir unsere Fahrbahnen. Profis legen Köder aus, um die Vögel anzulocken. Ich weiß, wo sie sich jeden Abend niederlassen. Als es dunkel wird, bin ich allein im Garten. Die „Bos“ hängt über meinem Arm, aber ich lege nur hin und wieder an, um zu zielen. Normalerweise würde ich lieber einfach nur hier stehen, den Sonnenuntergang beobachten, dem Gurren der Tauben im Wald hinter mir lauschen und meinen Gedanken nachhängen. Aber heute ist es anders. Ich will das schaffen. Nicht wie die Jungs, sondern auf meine eigene Art, leise und bedächtig.
Fast hätte ich schon wieder aufgegeben, als ich eine Taube heranflattern sehe. Ich lasse mir Zeit – „Taube sehen, Taube schießen“. Eine Explosion aus Federn, und die Taube trudelt zwischen den Bäumen zu Boden. Ich sichere das Gewehr und gehe ins dunkle Unterholz, um sie zu holen. In der nach Kiefern duftenden Abenddämmerung komme ich mir vor wie in einer anderen Welt. Ich hebe die Beute vom Boden, bewundere die dunkelrosa Halsfedern und das graublaue Brustgefieder. Es lässt sich ganz leicht auszupfen. Ich gehe nach Hause, und der Wind trägt die Federn davon, während der Himmel sich ebenfalls rosa färbt.
Ich besuche meine Großmutter und erzähle ihr von der Taube. Sie sagt, dass sie nur ein einziges Mal Taube gegessen hat. „O ja, mit einem Mann, der in mich verliebt war …“
„Jemand anders als Opa?“
Ein kanadischer Offizier, der in Edinburgh stationiert war, führte sie zum Essen ins Royal Northern aus, das heutige Balmoral. Weil Krieg war, gab es kein Huhn, nur Taube. Inzwischen steht Taube wieder auf der Speisekarte – als Wildgericht. Ich stelle mir die schöne, junge Beatrice Flockhart vor, wie sie in ihrer Taube herumstochert. Sie hat den kanadischen Offizier nie wiedergesehen und nie wieder Taube gegessen. Großvater, sagt sie, habe nie viel geschossen, nicht nach Arnheim. Er war in Kriegsgefangenschaft, danach waren ihm Waffen endgültig verleidet. Er hatte gesehen, was man damit anstellen kann.
Ich schmore die Taube in Rotwein mit Zimt und weiteren Gewürzen. Es ist leicht zu verstehen, warum es Taube im Balmoral gibt. Moorhuhn mag exklusiver sein, aber Taube ist nicht weniger lecker. Das Fleisch ist rubinrot, fast wie Rindfleisch. Ich esse langsam und denke über die Erfahrungen nach, die ich bis jetzt mit dem Schießen gemacht habe. Es wird mir nie leicht von der Hand gehen. Für meine nächste Beute, Reh, will ich mir genügend Zeit nehmen.
Chris Wheatley-Hubbard bringt Männern und Frauen nicht nur Schießen bei, sondern die Kunst der Tarnung und Treffsicherheit. Seine Auffassung vom Jagen geht tiefer. Mit leiser Stimme, schlanker Gestalt und rotem Bart wirkt er nicht wie ein Waffenenthusiast. Er besteht darauf, dass ich ihn auf seiner Farm in Wiltshire besuchen komme und eine Nacht im Zelt in den Wäldern verbringe, um seine Herangehensweise zu verstehen. Bei einem Tee am Lagerfeuer erklärt er mir seinen ganzheitlichen Ansatz bei der Pirschjagd. Er glaubt, dass wir immer noch auf die Fähigkeiten zurückgreifen können, die Menschen vor ein paar Generationen zum Jagen gebraucht haben. Wir müssten nur wieder mit diesen Instinkten in Verbindung kommen. Dabei gehe es nicht darum, sich in einen testosterongetriebenen Höhlenmenschen zu verwandeln, sondern darum, langsamer zu werden, innezuhalten und wirklich zu hinzusehen.
Wir sind noch weit davon entfernt, uns mit einem Gewehr an ein Tier heranzupirschen. Zunächst geht es ab in den Dreck. Wir legen uns auf den Bauch und starren auf ein Fleckchen Erde, das Chris mit vier Stöcken abgesteckt hat. „Was siehst du?“, fragt Chris.
„Äh – Gras, Blätter, Dreck.“
„Und was noch?“
Ich schaue genauer hin, ich schaue und schaue, bis ich schließlich Muster und Umrisse erkennen kann. Chris deutet auf Blätter, die erst kürzlich hergeweht sind, dann untersucht er die Erde darunter: „Ist das eine Hirschspur? Kannst du etwas erkennen?“ Ich bin nicht sicher, bis wir ein Haar finden. Es ist innen hohl: ein Hirschhaar. „Bei der Spurensuche geht es um eine Geschichte“, sagt Chris. „Welche Geschichte erzählen die Erde, die Blätter, die anderen Tiere und die Gerüche über das, was hier geschehen ist? Was für ein Charakter war das Lebewesen, das hier vorbeikam? War es mutig? Schüchtern? Gehetzt? Wenn du das Stück für Stück zusammensetzt, weißt du viel mehr.“
Wir gehen auf eine Übungspirsch. Auf der Suche nach Wild kriechen wir durchs Unterholz. Sicher, angemessen, vernünftig – diese Schlagwörter helfen mir einzuschätzen, ob das Ziel es wert ist, einen Schuss abzugeben. Gibt es im Hintergrund etwas, das die Kugel abzufangen könnte? Wo sind die anderen Tiere? Gibt es Hindernisse in der Schussbahn? Chris bringt mir bei, meine Schritte sorgsam zu setzen, kein Geräusch zu machen. Vor allem ermutigt er mich, im Wald zu sitzen und zu lauschen. Warum schlagen die Vögel Alarm? Kreist ein Greifvogel über unseren Köpfen? Wonach riecht es? Allein durch die Spurensuche und das intensive Beobachten habe ich das Gefühl, mit der Natur verbunden zu sein. Wer sich so durch die Landschaft bewegt, versteht das Ökosystem besser. In der Stadt sind wir zwar auch jeden Tag unterwegs, aber wir lassen von Handys und Routenplanern den Weg weisen. Wir sind so damit beschäftigt, durch das Leben zu hetzen, dass wir nicht mehr hinschauen oder lauschen. Wir haben vergessen, wie man sich draußen zurechtfindet. Ich hätte nicht erwartet, dass ich diese Lektion ausgerechnet beim Jagen lerne.
Wie Tauben gelten Rehe, die „Elfen der Wälder“, unter Landwirten als Plage. Sie fressen Kohl, Raps gern auch Erdbeerpflanzen. Es ist nicht schwierig, einen Bauern zu finden, der mir erlaubt, Jagd auf ein Reh zu machen.
Beim ersten Mal gehe ich mit Sam Thompson auf eine Morgenpirsch in den Cairngorm Mountains. In roter Hose, kariertem Hemd, Fleeceweste und nach eigenen Worten „so groß wie ein Haus“ stapft er wie einer anderen Zeit entsprungen durch die Gegend. Wir haben uns auf der Royal-Highland-Landwirtschaftsschau kennengelernt, und er hat mich umgehend auf die Pirsch eingeladen. Ich erzähle ihm, dass ich bereits eine Forelle gefangen und eine Taube geschossen habe.
„Aha, eine angehende Macnabberin!“
„Eine was?“
Sam erklärt mir, dass die Teilnehmer der Macnab-Challenge an einem einzigen Tag einen Lachs, ein Moorhuhn und ein Reh erlegen müssen. Ich mache es auf die einfache Tour – eine Forelle, eine Taube und ein Reh über einen Zeitraum von mehreren Monaten.
Sam ist ein guter Lehrer. Wir üben Schießen, und er schmuggelt einen Blindgänger unter die Munition. Ich drücke ab – und obwohl es keinen Knall gibt, zucke ich zusammen. „Das war das berühmte Mucken“, sagt Sam. – „Ja, das berühmte Mucken.“ Man nennt es auch Bock- oder Jagdfieber, wenn das Herz schneller klopft und man beim Schießen nicht stillhalten kann. Das ist mir wahrscheinlich auch bei dem Kaninchen passiert. Beim nächsten Schuss konzentriere ich mich darauf, nicht zusammenzuzucken. Wie dumm, dass ich nicht vorher schon darauf geachtet habe, aber es war eine natürliche Reaktion. Jetzt, wo ich über das Mucken Bescheid weiß, kann ich es unter Kontrolle bringen. Ich atme ganz ruhig, und in einem Moment der absoluten Konzentration spüre ich, wie mein Geist sich löst und fast wie in Zeitlupe zusammen mit der Kugel vorwärtsbewegt. „Guter Schuss!“, sagt Sam.
Am nächsten Tag gehen wir in der sommerlichen Morgendämmerung auf Rehpirsch. Die Täler wirken wie reingewaschen, die taubedeckten Blätter glitzern silbern, die Farben kommen mir weicher vor als sonst. Es riecht nach Birken und Farnkraut, ich höre die Vögel zwitschern. Zu dieser Stunde scheint alles möglich. Ein Rehbock steht auf seinen staksigen Beinen am Horizont, dann läuft er davon. In den Tälern sehen wir Rehe zwischen Silageballen grasen, von Regenpfeifern umschwirrt. Oben in Glenbeg schleichen wir mit Sicht auf die Cairngorm Mountains über federndes Heidekraut; auf den Gipfeln liegt selbst jetzt im Juli noch Schnee. Wir legen uns in die Heide, sehen Rehe oben am Hang grasen, alles geht ineinander über: durchs Fernglas schauen, reden, lauschen, warten. Als die Sonne aufgeht, verändern sich die Farben. Es wird hell und klar; die Rehe sind verschwunden. Wir sind zurück in der plumpen Menschenwelt.
Wir kehren mit leeren Händen heim. In seinem Junggesellenhäuschen serviert mir Sam Rhabarber-Crumble mit Vanillesoße zum Frühstück. An der Wand hängt die Rehbock-Trophäe „John McClane“, benannt nach dem Action-Held aus Stirb langsam. „Ich hab ihn jahrelang verfolgt“, sagt Sam. „In gewisser Weise bereue ich es, andererseits – bin ich froh, dass ich ihn erlegt habe und niemand anders.“
Die Rehe entziehen sich mir weiterhin. Ich starte einen zweiten Versuch, eine Abendpirsch an der Küste von Angus. Dass ich dabei von einer TV-Crew begleitet werde, macht die Sache nicht gerade einfacher. Die Produzenten von Landward, einer BBC-Sendung über schottisches Landleben und Umweltfragen, haben mich kontaktiert. Sie wollen über die Frau berichten, die nur Tiere isst, die sie selbst getötet hat, und haben vorgeschlagen, mich auf der Pirsch zu filmen. „Kann aber sein, dass ich Bammel bekomme“, sage ich. „Ich schieße nicht, nur weil ihr dabei seid.“ – „Das ist völlig in Ordnung“, sagen sie und klingen wie Ärzte, die einem gleich den Gips abnehmen wollen. „Du musst nichts tun, was du nicht tun willst.“
Gut gelaunt geht es los, und wir erkunden die Rapsfelder an den Klippen von Auchmithie. Die Abendsonne färbt den Sandstein rot, Möwen segeln über unsere Köpfe hinweg. Zusammen mit der Moderatorin Sarah Mack spaziere ich an Feldrändern entlang, die gerade mit Wildvogelsamen bepflanzt wurden, und erzähle ihr von den Kenntnissen, die ich mir im Zusammenhang mit der Jagd angeeignet habe.
Als die Dämmerung anbricht und die Rehe zum Fressen aus den Wäldern kommen, kriechen wir an Trockenmauern und Bächen entlang, immer gegen den Wind, der unseren Geruch mit sich fort trägt. Der Kameramann ist uns auf den Fersen, verfolgt mit uns die Rehe. Kurz sehen wir ein Geweih über die Rapspflanzen lugen, auch am Horizont können wir Umrisse der Tiere ausmachen, aber der Wind hat gedreht und die Rehe sind scheu. Sie müssen sich auf ihren Geruchssinn, ihr Sehvermögen und ihr Gehör verlassen, um Feinde auszumachen. Wenn es windig ist, sind sie noch aufmerksamer und nervöser als sonst. Mit einer Filmcrew im Schlepptau gestaltet sich die Pirsch schwierig. Wir geben unser Bestes, können aber manchmal ein Lachen nicht unterdrücken, zum Beispiel, als wir einem wütenden Hereford-Rind in die Quere kommen und einen anderen Weg nehmen müssen.
Schließlich finden wir die perfekte Beute, einen schwarzen Bock. Sein Fell ist dunkler als das der anderen Tiere, er ist also schon älter und geeignet, erlegt zu werden. Aber da taucht plötzlich der Landbesitzer auf – zweifellos, um zu schauen, wie es um seinen Prachtbock steht – und wieder ist eine Chance vorbei. Sarah fragt, ob ich enttäuscht bin, ich verneine. Vielleicht bin ich sogar froh? Ein Teil von mir freut sich auf jeden Fall, dass der Bock noch lebt.
Die Welt verändert sich, als es dunkel wird: Die Fledermäuse kommen heraus, die Fasane suchen sich einen Schlafplatz und die Käuzchen beginnen zu schreien. Wie große Katzen schleichen wir unter Zweigen entlang, in denen Regentropfen hängen, Dornen und Nesseln stechen mir in die Handflächen. Ich fühle mich den Rehen näher. Meine Sinne sind geschärft. Ich kann die feuchte Erde und die Kiefernnadeln riechen. Wir unterhalten uns nur noch im Flüsterton, und obwohl es für uns alle beschwerlich ist, macht es Spaß, zu dieser magischen Stunde durchs Unterholz zu kriechen.
Ein Bock taucht zwischen den Bäumen auf und verschwindet wieder, eine Ricke kommt hervor. Ich visiere sie an, sie steht nah genug, dass ich ihre Ohren zucken sehen kann. Ich darf sie zu dieser Jahreszeit nicht töten – nicht, dass ich das wollte –, und so habe ich die Möglichkeit, sie zu beobachten. Allein dafür hat die Warterei sich gelohnt. Sie ist aufmerksam, schaut alle paar Sekunden auf, ihr Gesicht und die Schnauze sind dunkler als ich erwartet habe. Von Nahem sind die Tiere noch viel schöner, als wenn man sie elegant durch die Gegend springen sieht. Wir bleiben und beobachten die Ricke so lange, bis es ganz dunkel ist und ich das Gewehr beiseitelegen und meine Niederlage eingestehen muss. Wir lassen eine Thermosflasche mit Tee und einem Schuss Whiskey kreisen und sehen zu, wie die Kartoffelfelder erst lila und dann schwarz werden. Ich entschuldige mich beim Team – ein wenig beschämt, dass ich es nicht schaffe, auch nur die Anfängerversion der Macnab-Challenge zu bestehen. „O nein!“, protestiert Sarah. „Uns hat der Abend gefallen. Darum geht es doch, oder? Der Punkt ist: Wir halten Fleisch für eine Selbstverständlichkeit. Aber du willst es dir selbst beschaffen, und das ist eben nicht so einfach wie zum Supermarkt zu gehen. Wenn du Fleisch isst, weißt du es ganz anders zu schätzen.“
Sie hat recht. Es gefällt mir, zu lernen, wie man auf die Pirsch geht und schießt. Ich treffe interessante Menschen und lerne viel über das Leben auf dem Land. Aber es geht auch um das Fleisch im Supermarkt. Es ist nicht realistisch, dass alle Menschen auf die Jagd nach Wildtieren gehen. Um eine anständige Fleischesserin zu werden, muss ich herausfinden, wie Tiere unseretwegen aufgezogen und geschlachtet werden.