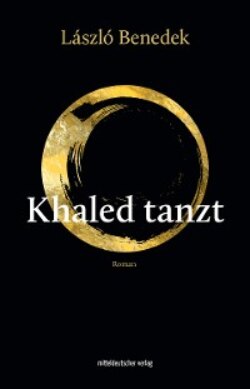Читать книгу Khaled tanzt - László Benedek - Страница 7
ОглавлениеKerstin
Kerstin, die Khaled manchmal zur Seite stand, schreibt dem Doktor einen Brief, worin sie vom eigenen Leben erzählt. Sie erzählt darin von ihrer Lebensgeschichte, die dazu geführt hat, sich um Khaled zu kümmern.
— —
Khaled und Kerstin waren schier unzertrennlich. Ohne sie hätte Khaled viele seiner Aktivitäten nicht bewerkstelligen können. Die Frau leistete fortwährend Fuhrdienste. Während Khaled anderweitig beschäftigt war, besorgte sie für den Jüngling den Einkauf oder setzte sich auf einen Cappuccino und einen Apfelstrudel in ein nahe gelegenes Café.
Kerstin befand sich schon längst im Rentenalter, lebte zusammen mit ihrem Mann im niederösterreichischen Bromberg. Kinderlos geblieben, hatte sie unendlich viel Freizeit. Deshalb bot sie der lokalen Diakonie ihre Hilfe bei der Flüchtlingsbetreuung an. Hier begegnete sie Khaled, der ihr sogleich sympathisch war. Alsbald sah sie ihn jeden Tag. Als Deutschlehrerin war sie den Organisatoren der Flüchtlingshilfe sehr willkommen. An Sprachunterricht gab es einen großen Bedarf. Anfangs hielt sie ausschließlich Gruppenunterricht. Doch mit der Zeit gab sie den begabteren und fleißigeren jungen Flüchtlingen auch Einzelunterricht. Khaled machte von dieser Möglichkeit Gebrauch. Kerstin spürte gleich, dass Khaled überdurchschnittliche Fähigkeiten besaß. Er merkte sich alles Gehörte, auch wenn er freilich mit der sprachlichen Umsetzung weit vom Niveau eines Muttersprachlers abwich. Sogar mit der Aussprache gab es keine allzugroßen Probleme. Khaled zu unterrichten, war eine besondere Freude. Von Tag zu Tag, von Woche zu Woche machte er Fortschritte. Auch war ihm anzumerken, dass er gern lernte.
Kerstin stand im Dienst der Diakonie Wiener Neustadt. Das Zentrum firmierte unter dem Namen Lares Niederösterreich Süd. Niederösterreich hatte mehrere solcher Zentren. Seit 2015 wurde Flüchtlingen hier Hilfe angeboten. Auch zahlreiche freiwillige Helfer standen bei der Kinder- und Schulbetreuung zur Verfügung, nahmen die sich in der Fremde hilflos und verloren vorkommenden Asylsuchenden an die Hand, begleiteten sie zu den Behörden, regelten so manches für sie, transportierten sie von einem Ort zum anderen, halfen, sich auch in den ihnen unbekannten Freizeitangeboten zurechtzufinden.
Kerstin gehörte zu einem geschätzten Mitglied dieses Freiwilligentrupps. Als pensionierte Deutschlehrerin war sie sehr gefragt. Die Flüchtlingsflut des Jahres 2015 setzte halb Österreich in Bewegung. Alle wollten helfen. Die Arbeit der Freiwilligen wurde von Flüchtlingsorganisationen koordiniert. In Aufnahmelagern sollten die Asylsuchenden gemäß gängiger Praxis möglichst nur kurze Zeit verbringen. Nach Erledigung der Registrierung und der Aufnahmeformalitäten wurden sie in leerstehenden Pensionen oder in Einfamilienhäusern untergebracht, wo man sie in Gruppen einteilte, die von einigen Betreuern beaufsichtigt wurden.
Khaled wurde in das Hirtenberger Laura-Gatner-Haus eingewiesen, eine Unterkunft für jugendliche alleinstehende Flüchtlinge. Die Mehrheit der Asylsuchenden stammte aus Syrien, dem Irak und aus Afghanistan.
Hirtenberg liegt zwischen Wien und Wiener Neustadt. Kerstin wohnte damals schon in Bromberg, einer verwunschenen Ansiedlung der wildromantischen Buckligen Welt. Von hier aus fuhr sie mit dem Auto nach Wiener Neustadt und nach Hirtenberg, eine halbe Stunde beziehungsweise vierzig Autominuten entfernt von Bromberg.
Über verschneite und vereiste Serpentinen beförderte Kerstin ihren Schützling nach Hohe Wand zum Chefarzt Dr. Arany, damit dort die Unterhaltungen stattfinden konnten. Während Khaled beim Doktor zur Gesprächstherapie weilte, schlürfte Kerstin in unmittellbarer Nachbarschaft auf der Terrasse des Alpengasthofs Postl ihren gewohnten Cappuccino. Der Nebel hatte sich schon verflüchtigt, sodass sich dem Blick des Betrachters ein herrliches Panorama darbot.
Kerstin wusste sehr wohl, dass Doktor Arany Khaleds Kindheit interessierte. Kindheitserinnerungen hat jeder Mensch. Doch es bleibt sich nicht gleich, welcher Art solche Erinnerungen sind. Auch Kerstin hätte viel zu erzählen. Keineswegs nur schöne Dinge. Der Weg nach Bromberg, bevor sie in einer schmucken Siedlung der Buckligen Welt ein Zuhause gefunden hatte, war ein langer. Ursprünglich stammte sie von norwegischen Eltern ab, genauer gesagt, von einer norwegischen Mutter und einem deutschen Vater. Geboren wurde sie unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Januar 1946.
Norwegen nahm unter den skandinavischen Ländern einen besonderen Platz ein. Schon 1940 war es von den Deutschen besetzt worden. Und die Besatzung dauerte bis zum Kriegsende. Zeitweise waren dort drei- bis vierhunderttausend Wehrmachtsoldaten stationiert. Angesichts ihrer blauäugigen blonden Kinder wurden die Norweger für Arier gehalten.
Himmlers „Lebensborn“-Plan war darauf ausgerichtet, für einen ständigen Nachwuchs der arischen Rasse zu sorgen. In den skandinavischen Ländern, so vor allem in Norwegen, waren die SS-Angehörigen dazu angehalten, mit norwegischen Frauen Kinder zu zeugen. Im Europa der Nazis, so auch in Frankreich und Österreich, erblickten überall arische Nachkommen der Besatzer das Licht der Welt. Gemäß verschiedenen statistischen Erhebungen betrug die Zahl der während des Krieges und unmittelbar danach in Norwegen geborenen „Lebensborn“-Kinder zwölftausend. Zu ihnen gehörte auch Anni-Frid Lyngstad, eine der späteren Sängerinnen von ABBA, geboren 1945 nach Kriegsende als Tochter einer norwegischen Mutter und eines deutschen Vaters. Als kleines Kind emigrierte Anni-Frid zusammen mit ihrer Mutter nach Schweden, wo sie von ihrer Großmutter großgezogen wurde.
Nach dem Krieg verwandelte sich das privilegierte Dasein der „Lebensborn“-Kinder von einem Tag auf den anderen in eine Hölle. Überall im Land wurden ihre Mütter als Verräterinnen, Nazinutten und die Kinder selbst als Bastarde, Ratten und Hurenkinder beschimpft. „Vater Deutscher“, diese beiden Wörter genügten, um die „Lebensborn“-Kinder zu diskriminieren. Viele von ihnen wurden in psychiatrischen Anstalten weggesperrt. Die Ächtung der Kinder war allgemein verbreitet. Vielen von ihnen wurden Jahrzehnte später vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Entschädigungszahlungen zugesprochen. 1998 bat der Ministerpräsident Norwegens die Betroffenen im Namen des norwegischen Volks um Entschuldigung. Allerdings war dieser Akt der Gerechtigkeit für die erlittene Unbill der vorangegangenen, vierzig Jahre währenden Diskriminierung keine wirkliche Wiedergutmachung.
Zur Schicksalsgemeinschaft norwegisch-deutscher Kinder gehörte auch Kerstin. Als kleines Mädchen wusste sie lediglich, dass der Vater noch vor ihrer Geburt im Krieg den „Heldentod“ gestorben sei.
Die mit ihrer Herkunft zusammenhängenden Erniedrigungen blieben auch ihr nicht erspart. Kerstin begriff nicht, warum sie von ihren Altersgenossen geschnitten wurde, warum man sie anders behandelte. Über den Vater schwieg sich die Mutter aus. Mehr, als dass er im Krieg gefallen sei, konnte Kerstin nicht in Erfahrung bringen. Sobald sie sich nach dem Vater erkundigte, wurde die Mutter nervös und beendete unwirsch das Gespräch, noch bevor es eigentlich begonnen hatte. Auch Kerstins Frage, warum die Mutter nie etwas vom Vater erzähle, wurde kurz abgefertigt.
Kerstins Mutter gehörte der Christengemeinschaft an, einer in Norwegen gegründeten kleinen lutherisch-christlichen Kirche. Ihr vollständiger Name: Brunstad Christian Church. Ihr Sitz befand sich im norwegischen Brunstad, wo Kerstin zusammen mit ihrer Mutter lebte. Die alleinerziehende Mutter wurde zusammen mit Kerstin in den Schoß der Kirche aufgenommen.
Kerstin fühlte sich in der Gemeinde wohl. Die Lichtgestalt des Vaters aber blieb nach wie vor in nahezu undurchdringliches Dunkel gehüllt. Da sie der Mutter keine Informationen entlocken konnte, kamen dem pubertierenden Mädchen die Inspirationen der Altersgenossinnen mehr als gelegen. Sie ermunterten Kerstin, selbst Nachforschungen anzustellen. Insgeheim tastete sie sich in der Tiefe des Wäscheschranks voran. Der Erfolg blieb nicht aus. Unter den Bettlaken entdeckte sie liebevoll von einem Seidenband zusammengehaltene Briefe. Das Herz schlug ihr bis zum Hals, während sie die offensichtlich nicht für ihre Augen bestimmten Kuverts öffnete. Sie fand darin in Perlschrift geschriebene Briefe, deren Adressatin Berta war, Kerstins Mutter. Als Absender der wohl drei oder vier Briefe entpuppte sich ein Mann namens Heinrich. Der letzte Brief stammte aus dem Jahr 1947. Mehr verrieten ihr die Briefe nicht. Denn sie waren auf Deutsch verfasst, in einer Kerstin damals noch fremden Sprache. Schnell versenkte sie den Briefstoß des Unbekannten wieder unter den Bettlaken. Da sie wegen der gewiss verbotenen Schnüffelaktion ein schlechtes Gewissen hatte, verriet sie sich der Mutter gegenüber mit keinem einzigen Wort. In ihrem tiefsten Inneren aber hoffte sie, dass dieser ominöse Heinrich ihr Vater sein könnte. Vielleicht war er ja gar nicht gestorben, wie man ihr gesagt hatte.
Jedenfalls wurde sie in der Gemeinde auf die Gründung von kleinen Partnerkirchen in anderen Ländern aufmerksam. Ende der fünfziger Jahre entstanden in Dänemark, Schweden und sogar Deutschland Gemeinden, die den Vorstellungen der norwegischen Christengemeinschaften folgten. Kerstin bat ein Mitglied ihrer Gemeinde, den an der Wandzeitung des Gemeindehauses angeschlagenen Aushang zur deutschen Gründung einer Partnergemeinde zu übersetzen.
Der Mann kam der Bitte nach. In dem an die Brunstader Gemeinde gerichteten Schreiben der Hamburger Christengemeinschaft wurde der Freude Ausdruck verliehen, dass man nun gleichfalls die Gedanken und das Leben Jesu Christi verkündigen, das christliche Evangelium und die Bibel verbreiten wolle.
Der Übersetzer war überrascht, mit welcher Begeisterung die Halbwüchsige diese Nachricht zur Kenntnis nahm. Im Stillen stellte er fest, dass es unter den jungen Menschen offenbar noch begeisterungsfähige Gläubige gab.
Von diesem Tag an betrieb Kerstin intensiv das Erlernen der deutschen Sprache. Allmählich verinnerlichte sie die Überzeugung, dass ihr Heinrich irgendwo in Deutschland leben musste und lediglich aus unerfindlichen Gründen von seiner geliebten Familie getrennt worden war. Für sie bestand nicht der geringste Zweifel daran, dass die Briefe Ausdruck nicht enden wollender Sehnsucht nach der innig geliebten Tochter sein mussten. Kerstin wollte sich die deutsche Sprache möglichst schnell aneignen, um die Botschaften des vermeintlichen Vaters zu verstehen. Als sie schließlich das Gefühl hatte, Deutsch schon ein wenig zu verstehen, wühlte sie an einem verregneten Sonntag erneut im Wäscheschrank herum, forschte unter den Bettlaken nach den Briefen. Doch außer den Kadavern einiger Kakerlaken konnte sie absolut nichts finden. In grenzenloser Wut verstreute sie die Bettwäsche auf dem Fußboden. Auf die Geräusche aufmerksam geworden, erschien die Mutter plötzlich im Raum, wo sie Kerstin vorfand, die die Laken auseinanderfaltete und wie wahnsinnig nach etwas zu suchen schien.
Überrascht zwar, bei der Suche ertappt worden zu sein, vermochte sie ihrer Verzweiflung dennoch nicht Einhalt zu gebieten und stellte die Mutter zur Rede, wollte wissen, wo Heinrichs Briefe geblieben seien.
„Also du warst das!“, stellte Berta wütend fest.
Mutter und Tochter standen sich feindselig gegenüber.
„Die Briefe? Die gehen dich einen feuchten Dreck an!“
Kerstin war sich darüber im Klaren, dass der Mutter nicht mehr zu entlocken sein würde. Also blieb sie mit ihren quälenden Fragen auch weiterhin allein.
Von da an war Berta auf der Hut. Die seltenen Briefe fischte sie aus dem Briefkasten und ließ sie schnell verschwinden. Kerstin befand sich schon mitten im Backfischalter, als die Mutter eines schönen Tages zum Arzt musste, weshalb sie den Briefkasten nicht rechtzeitig inspizieren konnte. In der Tiefe des Briefkastens fand die Tochter einen leicht zerknitterten und an die Mutter adressierten Brief. Als Absender war ein Heinrich Dümmel angegeben. Schreckliches Herzklopfen bemächtigte sich ihrer, während sie das Kuvert sogleich in der Bluse verschwinden ließ. Sie schloss sich in ihrem Zimmer ein und öffnete das Kuvert ohne auch nur den geringsten Anflug eines schlechten Gewissens. Zur größten Überraschung aber gab es darin keine einzige Zeile, sondern lediglich ein gepresstes vierblättriges Kleeblatt.
Sie betrachtete das Kuvert. Als Absender war Hamburg-Altona angegeben sowie eine für sie kaum aussprechbare Straße: Elbchaussee 88. Kerstin war damals fünfzehn Jahre alt. Am liebsten hätte sie sich sogleich in einen Zug nach Hamburg gesetzt. Aber wie in die Tat umsetzen? Sie erinnerte sich daran, dass unlängst ja auch in Deutschland eine Partnergemeinde gegründet worden war, noch dazu ausgerechnet in Hamburg. Ihr kam die Idee, Austauschbesuche mit gleichaltrigen deutschen Gemeindemitgliedern zu initiieren. Binnen weniger Wochen gelang es ihr, zusammen mit zwei Freundinnen eine mehrtägige Reise nach Hamburg zu organisieren, wo sie bei Familien der Partnergemeinde untergebracht werden sollten. Als härteste Nuss erwies sich Berta, die die Tochter auf gar keinen Fall reisen lassen wollte, und schon gar nicht nach Deutschland. Kerstin wandte sich an den Kirchenvorstand um Fürsprache. Schließlich gab die Mutter nach.
Alsbald konnte Kerstin sich mit der zwischen Oslo und Kiel verkehrenden Fähre auf die Reise begeben. Von Kiel aus fuhren die Freundinnen mit dem Zug weiter in Richtung Hamburg. Der Austauschbesuch hielt nichts Besonderes bereit. Kerstin beschäftigte etwas ganz anderes. Als sich die Gastgeberfamilie an einem Nachmittag endlich zu einem Mittagsschlaf zurückzog, nutzte sie die Gelegenheit, sich davonzustehlen. Auf dem Stadtplan hatte sie sich wieder und wieder kundig gemacht, wie sie in die Elbchaussee 88 gelangen könnte.
Schließlich stand sie also vor dem Haus ihrer Sehnsucht, an dem zu lesen stand: „Auguste-Viktoria-Stiftung – Wohn- und Pflegeheim“. An der Rezeption wurde sie nach ihrem Begehr gefragt. „Ich möchte gern“, so Kerstin, „Herrn Heinrich Dümmel besuchen.“ Beim Namen ‚Dümmel‘ überschlug sich ihre Stimme. Die Schwester nickte zustimmend, wollte aber unbedingt wissen, wen sie Herrn Dümmel melden dürfe. Mit dieser Frage hatte Kerstin nicht gerechnet. Doch sie fasste sich schnell und meinte: „Eine gute Bekannte.“
Die Schwester verschwand. Kerstin sah sich um. Das Gebäude mochte auch schon bessere Zeiten erlebt haben. Es wirkte irgendwie noch immer elegant. Hohe Fenster mit schweren Vorhängen zeugten davon. Ansonsten ringsum einfache Tische und Holzstühle mit Rückenlehnen. Im Aufenthaltsraum, der auch als Speisesaal fungierte, saßen alte Menschen. Offensichtlich war sie in ein Altersheim geraten. So etwas hatte sie noch nie zuvor gesehen.
Es dauerte nicht lange, und die Schwester schob einen im Rollstuhl sitzenden Mann vor die junge Besucherin. Der war wesentlich jünger als die anderen Heiminsassen. Bartstoppeln bedeckten das müde wirkende Gesicht. Kerstin registrierte sofort, dass Herrn Dümmel das rechte Bein fehlte.
„Herr Dümmel“, wandte sich die Schwester an den Rollstuhlfahrer, „hier ist Ihre junge Besucherin.“
Kerstin stand wie angewurzelt da, brachte kein einziges Wort hervor. Sie hatte sich einen stattlichen jungen Mann vorgestellt. Stattdessen sah sie sich einem menschlichen Wrack gegenüber.
Herr Dümmel rülpste genüsslich. Sonderliches Interesse schien die Besucherin bei ihm nicht auszulösen. Dennoch fragte er, was ihm die Ehre verschaffe.
Kerstin nahm all ihren Mut zusammen: „Ich komme aus Brunstad, bin Mitglied der dortigen Christengemeinschaft und statte im Rahmen eines Austauschprogramms meinen Hamburger Brüdern und Schwestern einen Besuch ab.“
Der Name Brunstad ließ Herrn Dümmel aufhorchen: „Tatsächlich? Aus Norwegen? Dem norwegischen Brunstad?“
Kerstin nickte.
„Ich hatte dort eine nette Bekannte, Berta Holberg“, fuhr Herr Dümmel fort. „Vielleicht kennen Sie die Dame sogar? Berta Holberg.“
Kerstin spürte, wie ihr das Blut aus den Adern wich, sodass sie kurz vor einer Ohnmacht stand. Deshalb setzte sie sich schnell hin. „Die kenne ich. Sie ist Mitglied unserer Gemeinde. Sie war es ja gerade, von der ich Ihren Namen habe. Sie meinte, wenn ich in Hamburg sei, könnte ich Sie vielleicht aufsuchen.“
„Na, sowas! Das ist wirklich sehr freundlich!“ Mit diesen Worten lud er das Mädchen in sein karg eingerichtetes Zimmer ein. Außer dem Bett gab es nur noch einen Tisch und einen Schrank sowie einen einsam dastehenden Stuhl. An der Wand hing ein vergilbtes Gemälde. Die Luft war abgestanden. Alkoholgeruch schlug ihr in die Nase.
Herr Dümmel bot der Brunstaderin einen Schluck Wein aus der Flasche an. Kerstin wehrte das Angebot leicht angewidert ab. Ohne viel Aufhebens nahm Herr Dümmel einen kräftigen Schluck aus der Pulle und bat die Besucherin, ihn beim Personal nicht anzuschwärzen: „Die quälen mich mit ihrer unausstehlichen Neugier ohnehin schon zur Genüge. Was ist denn dabei, wenn ich mir hin und wieder einen Schluck genehmige?“
Schließlich nahm Kerstin all ihren Mut zusammen, um Herrn Dümmel auszufragen: „Sie kennen Frau Berta also noch aus Norwegen?“
„Genau! Wissen Sie, mein liebes Mädchen, das waren damals andere Zeiten!“ Bevor er fortfuhr, genehmigte er sich noch einen Schluck. „Sie haben damals vermutlich noch nicht gelebt, als wir den norwegischen Brüdern zu Hilfe geeilt waren.“
„Sie meinen, im Krieg? Wenn ich Sie recht verstehe.“
„Natürlich im Krieg.“ Herr Dümmel verstand nicht, wie man so eine dumme Frage stellen konnte. „In Norwegen waren sehr viele deutsche Soldaten stationiert. So auch ich.“
Das Gespräch stockte. Beide schwiegen. Nun war Kerstin endlich am Ziel ihrer Träume, saß zweifellos ihrem Vater gegenüber. Der Mann war sichtlich bewegt. Die Erinnerung an Norwegen ließ seine Augen feucht werden. Ungezählte Male hatte Kerstin sich vorgestellt, von ihrem Vater in die Arme genommen zu werden. Jetzt aber empfand sie nichts als Mitleid und tiefe Enttäuschung. Um den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen, ging Kerstin auf seine Verwundung ein.
Der Fremde nickte, reagierte aber nicht gleich auf die neugierige Frage des Mädchens. Dann nur dies: „Kriegsgefangenschaft.“
Bedauernd sah Kerstin ihr Gegenüber an, der plötzlich gesprächig wurde: „Am Tag der Kapitulation wurden wir allesamt verhaftet. Die Offiziere wurden standrechtlich erschossen, während wir Landser auf einem mit Stacheldraht umzäunten Grundstück zusammengepfercht wurden. Einige Tage später transportierte man uns in ein Kriegsgefangenenlager nach Frankreich. Dort gingen wir durch die Hölle. Die Wehrmachtsoldaten hatten alle niedrigen Arbeiten zu verrichten. Wir hatten die Minen von den Schlachtfeldern zu räumen. Sie, mein liebes Mädchen, können sich vielleicht vorstellen, was das für eine Drecksarbeit war! Den Krieg hatten viele meiner Kameraden überlebt. Nun aber wurden sie von Minen zerfetzt. Dort habe ich mein rechtes Bein verloren.“
„Ein Glück noch“, meinte Kerstin, „dass Ihnen nichts Schlimmeres zugestoßen ist!“
„Lazarett, Amputation, Wundfieber, Koma! Ein Wunder, dass ich am Leben geblieben bin!“
„Und wie sind Sie nach Deutschland zurückgekehrt?“
„Mit den pflegebedürftigen Kriegsgefangenen wussten die Franzosen nichts anzufangen. Ich wurde nach Deutschland in die französische Zone verfrachtet, wo ich noch zwei weitere Jahre in Gefangenschaft verbrachte. Von dort hat mich die Diakonie herausgeholt und hier in dieses Seniorenheim gesteckt. Alt bin ich zwar noch nicht, aber in meiner Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt.“
Kerstin beschloss, ihre Identität nicht preiszugeben. Beim Abschied trug Herr Dümmel dem Mädchen auf, Frau Berta herzlich zu grüßen. Was Kerstin natürlich versprach, obwohl sie sehr wohl wusste, dass sie der Mutter gegenüber den Besuch verheimlichen würde.
— —
Kerstin war noch mit ihren Erinnerungen beschäftigt, als Khaled plötzlich gutgelaunt vor ihr stand.
„Du scheinst mit Doktor Arany ein gutes Gespräch gehabt zu haben.“
„Ja“, so der Junge. „Haben über Afghanistan und meine Kindheit gereden.“
„Das ist gut!“, entgegnete Kerstin und drehte sich ein wenig zur Seite. Khaled sollte die Tränen in ihren Augen nicht sehen.