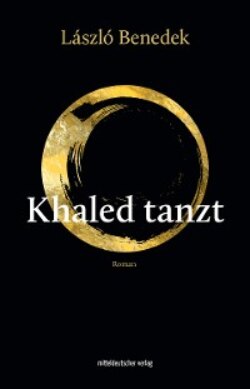Читать книгу Khaled tanzt - László Benedek - Страница 9
ОглавлениеDoktor Arany
Doktor Arany ist der vierte Akteur unserer Geschichte. Sein Fachtagebuch verrät allerdings wenig von ihm selbst. Deshalb dachte ich, das Porträt des Doktors am besten durch die mit ihm geführten Unterhaltungen zeichnen zu können.
Doktor Arany kenne ich seit mehr als zwanzig Jahren. Gelegentlich zahlreicher Kulturveranstaltungen der in Österreich lebenden Ungarn begegneten wir uns immer wieder. Im Lauf der Jahre entwickelte sich aus unserer Bekanntschaft eine Freundschaft, die durch unsere Kartenabende noch weiter vertieft wurde. Sein Arzttagebuch, das er mir eines Tages überließ, schlug in unserer Beziehung ein neues Kapitel auf.
Die Lektüre des Tagebuchs weckte in mir ähnliche Empfindungen wie die an verschiedenen Punkten der Welt aufgestellten Webkameras, durch deren Vermittlung ich meine virtuellen Reisen erlebte. Das Tagebuch vermittelte mir tiefe Einblicke in voneinander unabhängige Lebenswege und Welten. Unwillentlich begann ich nach dem Gemeinsamen und dem miteinander Zusammenhängenden in diesen Lebenswegen zu suchen. Wo befindet sich der Punkt, an dem sich diese voneinander so weit entfernten Welten begegnen könnten?
Vor unserer Kartenpartie begab ich mich einmal nach Hohe Wand zu Doktor Arany, um mich mit ihm allein zu unterhalten. Hohe Wand, etwa zwanzig Kilometer von Wiener Neustadt entfernt, ist die eine Erhebung der Wiener Alpen. Nach Verlassen des flachen Lands folgt, bevor sich unseren Blicken das imposante Kalksteinplateau von Hohe Wand darbietet, eine Schlucht. Zu erreichen ist die Gemeinde Hohe Wand über eine kurvenreiche Straße. Hohe Wand ist ein Paradies für Felsenkletterer. Vom Fuß des Berges bis zur Hochebene führen zahlreiche Pfade, Möglichkeiten für Bergsteiger und Felsenkletterer. Die Aussicht von hoch oben zu den Bergketten der Umgebung ist überwältigend.
— —
„Ein bisschen lückenhaft, das Tagebuch. Oder?“, begann der Doktor sogleich das Gespräch. Mesi, seine Frau, bot uns Tee an. Am Esstisch, an dem für gewöhnlich auch die Kartenpartien stattfanden, schlürften wir den heißen Tee.
„Lückenhaft, das würde ich nicht unbedingt sagen. Zweifellos aber bin ich neugierig, wie sich diese verschiedenen Lebenswege kreuzen werden.“
Der Doktor nickte: „Das werden sie gewiss tun. Da bin ich zuversichtlich. Wenn anders nicht, dann wird deine Fantasie nachhelfen. Ich selbst habe auch immer nach den Parallelen, dem Gemeinsamen gesucht. Khaleds Herkunft aus dem afghanischen Hochgebirge erinnerte mich immer an meine siebenbürgische Heimat. Wenn er vom Hindukusch erzählt, muss ich immer an das Kelemen-Hochgebirge denken, an den Bekas-Pass in den Ostkarpaten oder eben an das Harghita-Gebirge.“
„So funktioniert der Mensch. Willst du mir nicht etwas von deinen eigenen Anfängen berichten?“
Doktor Arany lächelte. „Dann soll ich jetzt also in die Patientenrolle schlüpfen?“
„So könnte man es auch sagen.“
„In Ordnung!“
Der Doktor verstummte für einen Moment, sah sich im Wohnzimmer um. An der Wand überall Tongut, Teller und Fotos aus Siebenbürgen. Er erhaschte meinen Blick. Spitzbübisch lächelnd meinte er: „Wir können gleich mit den Bildern anfangen. Mesi hat die ganze Kollektion hier untergebracht. Ich war eigentlich nicht dafür, dachte, man muss ja nicht gleich unser ganzes Leben hier vor der Öffentlichkeit ausbreiten. Na ja, ihr war das aber wichtig.“
„Dieses sympathische Pärchen dort, denke ich mir, sind vermutlich deine Eltern.“
„Ja, genau.“
Auf dem vergilbten Foto war ein auffallend schönes Pärchen in der Blüte seiner Jahre zu sehen. Arany d. Ä. zeigte sich stolz mit seinem gepflegten Schnurrbart und graumelierten Haar. Der Blick in die Kamera wirkte aufrichtig, der Gesichtsausdruck entschlossen.
„Als Dorfschullehrer stand er seiner Schule als Direktor vor. Und diese akkurat frisierte Frau mit der Haube auf dem Kopf ist meine Mutter, wie unschwer zu erraten sein dürfte. Das Bild mochte zu irgendeinem festlichen Anlass entstanden sein. Vielleicht zum Schulbeginn nach den Sommerferien oder zu Ostern. Meine Mutter hat übrigens als Fürsorgerin gearbeitet.“
Doktor Aranys Mutter machte einen ebenso ehrlichen Eindruck wie deren Ehemann. Auf dem nächsten Bild war ein etwa dreijähriger Junge zu sehen. Hinter ihm ein alter Mann, in der Hand die Zügel, mit deren Hilfe er den kleinen Jungen, sein Pferdchen, dirigierte.
„Ein Enkel?“, fragte ich den Doktor, der lachen musste.
„Nicht doch. Das bin ich höchstpersönlich, mit drei Jahren. Hinter mir mein Großvater mütterlicherseits.“
Ich bewunderte das Bild. Das blonde Kind trug eine kurze Hose. Die Ärmchen in die Höhe gestreckt, schien er sein Publikum willkommen zu heißen. Der Großvater in Szekler-Tracht: Strümpfe und Weste, weißes Hemd.
„Mesi mag dieses Bild besonders. Ich denke, deshalb hat sie es an die Wand gehängt. Und das hier ist der Kuckucksberg, der höchste Punkt des südlichen Harghita-Gebirges. In meiner Kindheit nannten wir diesen beliebten Ausflugsort nur den Kuckberg. Hermansdorf, mein Geburtsort, liegt am Fuß dieses Berges. Und dies hier ist das Wohnhaus meiner Eltern in Hermansdorf. Hier bin ich zur Welt gekommen. Wenn ich als Erwachsener zu viele Schwierigkeiten oder nervenaufreibende Umstände zu bewältigen hatte, stellte ich mir immer dieses Landhaus mit dem einladenden Szeklertor vor. Das beruhigte mich irgendwie.“
„Und dieser kecke Jüngling?“, erkundigte ich mich nach dem nächsten Bild, auf dem mich ein freundlicher junger Mann anlächelte. Lange Haare, gepflegte Frisur, schwarzes Sakko, Krawatte, Selbstvertrauen ausstrahlend.
„Ein Abiturfoto. Wann soll einer selbstsicher sein, wenn nicht als Achtzehnjähriger? Das Frauenzimmer an meiner Seite mit der weißen, geblümten Bluse ist Emese Benkő, meine Liebste, die wir immer nur Mesi nannten. Was für ein schönes Mädchen! Nicht wahr?“
„Tatsächlich.“
„Wir haben beide am Gymnasium von Barót das Abitur abgelegt. Damals hatten wir das Empfinden, dass uns die ganze Welt gehört. Seither kennen wir uns. Eine Jugendliebe. Aber gehalten hat sie nun schon seit sechzig Jahren.“
Plötzlich wurde seine nostalgische Stimmung von einem Blick in den Spiegel unterbrochen: „Allzu schön bist du nun wirklich nicht mehr!“, richtete er die vorwurfsvollen Worte an sein Spiegelbild. „Siehst du, was von dem einst kecken Blick geblieben ist?“
„Na ja, aber so ganz ohne ist er auch heute nicht!“, versuchte ich ihn zu trösten.
„Ach, papperlapapp! Müde Gesichtszüge, runzlige Stirn, Tränensäcke unter den Augen, Doppelkinn, kaum noch Haare auf dem Kopf. Besonders ärgert mich der kahle Schädel. Einzig mein graugewordener Schnurrbart ist in Ordnung. Alles andere kannst du vergessen. Aber daran lässt sich nichts mehr ändern. Es kann höchstens noch schlimmer werden.“
„Die Bilder sind sehr schön“, lenkte ich anerkennend ab. „Sie verströmen die Atmosphäre von Heimat.“
„Das klingt so einfach, wenn ich von zu Hause rede. In dem Wort steckt so unendlich viel. Sorglosigkeit, Glück. Heimat, das klingt so erhaben, als wäre sie die Quintessenz der Gemeinschaft. Wie Mihály Vörösmarty, der Nationaldichter von uns Ungarn, schrieb: ‚Deine Wiege ist sie, und dereinst wirst du sie beweinen, sie umhegt dich, gewährt dir Schutz.‘ Dabei verhält es sich mit deinem Zuhause, deiner Heimat, viel einfacher. Heimat, das sind Bilder deiner Kindheit, Landschaften, Farben, Düfte, Geschmack und natürlich die Menschen von damals, Eltern, Ahnen, Spielkameraden, Erlebnisse. Khaleds nostalgische Erinnerungen an sein einstiges Heimatdorf kann ich sehr gut verstehen. Dabei haben die Menschen dort vermutlich im Elend gelebt und sind unterdrückt worden. Dennoch erinnert sich Khaled nur an die schönen Dinge. Mir geht es damit ebenso.“
„Wie waren diese Hermansdorfer Menschen?“
„Die Hermansdorfer? Sie galten seit Jahrhunderten als halsstarrige Szekler, die ihrer Meinung mitunter stur Ausdruck verliehen. Auch als Siebenbürgen nach dem Ersten Weltkrieg an Rumänien fiel, ließen sie das nicht wortlos über sich ergehen. Die Unzufriedenheit war groß. Oft empörten sie sich. Hermansdorf gehört zu jenen Dörfern, die sich um nichts auf der Welt romanisieren ließen. Auch seither sind die Hermansdorfer in keiner anderen Sprache als Ungarisch bereit, sich zu verständigen. Mir selbst sind ja Gefühlsausbrüche keineswegs fremd, doch zu den aggressiven, Händel suchenden und mit dem Messer sich Gehör verschaffenden jungen Leuten habe ich nie gehört. Zu meinen Hermansdorfer Wurzeln habe ich mich allerdings immer erhobenen Hauptes bekannt. Der Hermansdorfer kennt keine Winkelzüge, ist stets aufrecht. In seinen Entscheidungen ist er kompromisslos. Damals gab es noch dazu etwas, worauf ich stolz sein konnte. Denn trotz meiner dörflichen Herkunft war ich immer ein ausgezeichneter Schüler, am Baróter Gymnasium ebenso wie an der Medizinischen Fakultät von Neumarkt. In den sechziger Jahren gab es an der Neumarkter Universität einen international bekannten Professor: Dezső Miskolczy. Mit seinem Namen verband sich eine bekannte Klinik für Neurologie und Psychiatrie. Auch ich wurde von ihm stark beeinflusst. Auch seinetwegen entschied ich mich für die Psychiatrie. Nach dem Abschluss meines Studiums verdingte ich mich an der II. Klinik für Psychiatrie in Neumarkt als Assistenzarzt.
In Rumänien wurden damals, Mitte der sechziger Jahre, als das Land einen Entwicklungsschub erlebte, neue Hoffnungen geweckt. Nicolae Ceauşescu, der neue Generalsekretär der Partei, schien eine dynamische Politik zu verfolgen. Obwohl er die nationalistischen Traditionen Rumäniens fortsetzte, hatte er sich innerhalb des Ostblocks für einen politischen Sonderweg entschieden. Das gefiel uns. Als Einziger unter den kommunistischen Führern verurteilte er 1968 die sowjetische Okkupation der Tschechoslowakei.
Ich selbst kletterte auf der Rangleiter der Klinik nach und nach immer höher. Auf meine Stelle als Assistenzarzt kam der Einsatz als Stationsarzt. Bis ich schließlich zum Oberarzt und Dozenten aufstieg. Ich wurde zum Experten für die Heilbehandlung von Alkoholikern und sonstigen Suchtkranken.
In den siebziger und achtziger Jahren aber änderte sich alles von Grund auf. Die staatlich gelenkte, nationalistisch geprägte Politik erstarkte. In Neumarkt, Marosvásárhely, der Hochburg der ungarischen Kultur Siebenbürgens, erlangten die Studenten und Dozenten rumänischer Muttersprache die Mehrheit gegenüber den ungarischen Muttersprachlern. Als Unterrichtssprache galten anfangs sowohl Rumänisch als auch Ungarisch, bis letztere aus dem Angebot verschwand und Vorlesungen und Seminare nur noch auf Rumänisch belegt werden konnten. Ich selbst wurde von einem hoffnungsvollen jungen Psychiater zu einem geduldeten Klinikarzt.
Auch mit dem allgemeinen Zustand des Landes ging es rapide abwärts. Hinter den klangvollen Losungen des Ceauşescu-Regimes zeigten sich wirtschaftlicher Niedergang, im öffentlichen Leben Verdruss, gemessen an den sozialistischen Zuständen Verarmung, in den Dienstleistungen und der Lebensmittelversorgung katastrophaler Mangel. Das vom Ceauşescu-Regime verfolgte Schleifen von Dörfern vergiftete die Atmosphäre des öffentlichen Lebens. Tag für Tag erlebten wir Enttäuschungen und Ärger. Der Staat organisierte einen Ausverkauf seiner deutschsprachigen und jüdischen Bürger. Von Westdeutschland und Israel kassierte er für die Auswanderungsgenehmigungen der nationalen Minderheiten Abstandszahlungen beziehungsweise Kopfgeld. Die nationalistisch dominierte Politik Rumäniens startete regelmäßig Angriffe gegen die ungarische Minderheit. Tagtäglich wurden die Menschen auf niederträchtigste Weise drangsaliert. Die Abwanderung der ungarischen Minderheit nahm dramatisch zu. Die meisten Menschen verließen Rumänien illegal.“
„Ich denke“, warf ich ein, „damals reifte auch in euch der Entschluss, die heimatlichen Zelte abzureißen.“
„Ja, das Leben in Rumänien fing an, unerträglich zu werden. Meine berufliche Karriere war ins Stocken geraten. Um uns herum tobten die Ceauşescu-Diktatur und die Diskriminierung der ungarischen Minderheit. In meiner Umgebung machten sich Ernüchterung und ohnmächtige Wut breit. Auch persönliche Sorgen erschwerten unser Leben. Trotz aller Bemühungen blieb Mesi, meiner Frau, eine Schwangerschaft versagt. Das belastete sie und mich ebenso. Denn wir sehnten uns nach einer Familie, nach Kindern. Ich will nicht behaupten, dass wir deshalb emigriert wären. Doch das kam zu unseren Enttäuschungen sicher hinzu. Ende der achtziger Jahre ergab sich die Möglichkeit einer legalen Auswanderung nach Ungarn. Damals beschleunigte sich somit der Exodus aus Rumänien. Auch wir reichten einen Auswanderungsantrag ein.
Als meine Frau und ich beschlossen, Siebenbürgen zu verlassen, schien alles noch so einfach zu sein. Das Ceauşescu-Regime war unannehmbar. Ein vernünftiger Mensch, wenn er die Möglichkeit dazu hatte, floh von dort.“
„Im Zenit der Diktatur konnte man bestimmt nicht einfach erklären, dass man genug habe und dem Land nun den Rücken kehren wolle. Oder?“
„Das war genau so. Doch auch später erwies es sich nicht als unproblematisch.“
„Wieso?“
„Was nach dem Einreichen unseres Auswanderungsantrags geschah, das würde ich meinem ärgsten Feind nicht wünschen. Denn der Antrag war quasi gleichbedeutend mit der Erklärung, dass wir nicht zu den Freunden des Regimes gehören würden. Und so wurden wir auch behandelt. Wie Aussätzige. Als Angestellter des Unterrichtswesens landetest du im Handumdrehen auf der Straße. Als Schriftsteller oder Person des öffentlichen Lebens wurdest du auf ein Abstellgleis befördert. Ich selbst hatte das Glück, aus der Klinik nicht entlassen zu werden. Dennoch ließ man mich auf Schritt und Tritt spüren, dass ich ein feindliches Element sei. Die Scherereien mit den Behörden dauerten zwei Jahre. Zwei lange Jahre ließ man uns nicht in Ruhe, kamen wir nicht zur Ruhe. Solange wir von Ungarn keine Aufnahmeerklärung erhielten, trafen die Rumänen in unserer Sache keine Entscheidungen, behandelten uns wie Luft. Und in Ungarn hatte man es freilich auch nicht allzu eilig, uns den Zuzug zu genehmigen. Kleinliche Verfahrensvorgaben führten zu einer langen Wartezeit, bevor wir in den Besitz der erforderlichen Papiere gelangten. Schließlich händigte man uns einen Reisepass aus, demzufolge wir als rumänische Staatsbürger einen Wohnsitz in Ungarn hätten. Man hatte uns also, so könnte ich sagen, den Laufpass gegeben. Alles in allem duften wir siebzig Kilo Gepäck und Möbel für ein Zimmer mitnehmen. Gehorsamster Diener!“
Bevor der Doktor fortfuhr, schenkte er Tee nach: „Am Tag der Ausreise erklärte Mesi, dass sie schon jetzt Heimweh habe. Dabei hatten wir die Grenze noch nicht einmal hinter uns gelassen. ‚Ich werde das Plätschern des Barótbaches hören, das dumpfe Raunen des Katzenbergs, wenn dort der Starkregen niedergeht. Werde den Kuckucksberg vermissen, von dem nur wir wissen, dass man ihn Kuckberg nennt. Mit wem werden wir unsere Erinnerungen teilen können?‘, fragte sie mich mit Tränen in den Augen. Ich versuchte, sie zu trösten. Auch dort werde es einen Bach geben und Berge. Auch dort werde es Menschen geben, die ihren eigenartigen lokalen Dialekt sprächen. ‚Ja, natürlich‘, so meinte Mesi, ‚aber das ist nicht dasselbe.‘ Was hätte ich ihr sagen können? Schließlich fragte ich sie: ‚Sollen wir bleiben? Noch können wir bleiben!‘ Daraufhin hörte meine Mesi mit dem Schniefen auf. Ihre Züge verhärteten sich: ‚Nein! Wir gehen weg. Zu Hause bleiben können wir jetzt auch nicht mehr. Das ist unmöglich!‘
Hierin besteht also das Dilemma, dem sich jeder gegenübersieht, wenn er die Heimat verlässt. Du kannst dich innerlich nicht trennen. Und ein Bleiben ist unmöglich.“
Stille griff um sich. Jeder hing seinen eigenen Gedanken nach. Schließlich unterbrach ich das Schweigen: „Noch schwieriger ist höchstens eine andere Situation.“
„Und die wäre?“
„Wenn die Heimat dich im Stich lässt.“