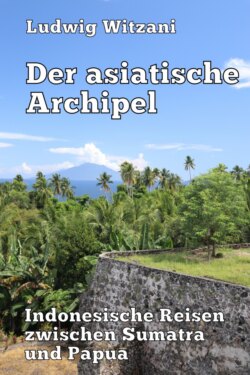Читать книгу Der asiatische Archipel - Ludwig Witzani - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Drei Dolche müssen es schon sein Lazy days in Yogjakarta
ОглавлениеIn einem Akt unbedachter Selbstkasteiung hatte ich mir ein Ticket für den Nachtzug nach Yogjakarta besorgt. Ich hätte auch fliegen oder mit einem Touristenbus fahren können, aber ich wählte den Zug, denn ich wollte möglichst „authentisch“, das heißt, volksnah, reisen, was immer das auch bedeuten mochte. Inzwischen hege ich an diesem Konzept meine Zweifel, aber damals glaubte ich noch daran, und so nahm das Unheil seinen Lauf.
Am Eingang des Hauptbahnhofs hätte ich noch umkehren können, doch ich blieb verstockt. Ganz unjavanisch nervös, hektisch, mit Tunnelblick und unwirschen Gesten liefen die Leute hin und her. Es roch nach Curry, Schweiß und Öl. Kleine Kinder lagen neben ihren Müttern auf einer Decke und schrien. Sehnsüchtig dachte ich an die Disziplin, wie ich sie einmal auf dem großen Bahnhof von Xian in China erlebt hatte. Dort hatten sich die Passagiere in Zweierreihen aufstellen müssen, ehe sie, von strengen Aufseherinnen geführt, den Bahnsteig betreten durften.
Aber Jakarta war nicht Xian, und so brach, kaum dass der Zug hielt, ein mittleres Chaos aus. Alle malaiische Höflichkeit war verschwunden, als sich die Massen durch die Eingänge quetschten. Mein Rucksack war Hindernis und Hilfe zugleich – mit ihm kam ich zwar nur mit Mühe durch den Eingang, konnte aber durch geschicktes Schwenken den Zugang zu dem Platz abwehren, den ich schließlich besetzte. Am Ende fand ich einen Platz in einem offenen Abteil neben einem halben Dutzend Javaner von Gottseidank schlanker Statur.
Dann setzte sich der Zug in Bewegung. Quietsch und stopp, ein krrr, krrr und ein zögerliches Taggertagtagg setzte ein. Ein intensiver Geruch nach Hühnerkäfig zog durch den Waggon, als hätte er sich in dem Moment von den Wänden gelöst, als der Zug ruckhaft gestartet war. Taggertaggertagertagg. Langsam erreichte der Zug die Geschwindigkeit einer Fahrradrikscha, dann wurde er noch schneller, und wie eine Erlösung zog ein kühlender Wind durch die geöffneten Fenster. Eine Unendlichkeit von Hinterhöfen, Müllhalden und Ausfallstraßen zog am Fenster vorüber, schließlich wurde es dunkel, und die Aussichten verschwanden im gnädigen Dunkel einer javanischen Nacht. Dann ein plötzlicher Stopp, der erste von unzähligen, die mich in dieser Nacht noch quälen würden. Der Zug stand ohne ersichtlichen Grund eine halbe Stunde auf dem Gleis, dann ging es weiter. Taggertaggtagg. Die Ventilatoren an der Decke bewegten sich nicht, dafür blieb das Licht die ganze Nacht an. Es wurde von funzeligen 20 Watt Birnen an der Decke erzeugt, die wie die Augen böser Geister über uns hingen. Bei dieser Beleuchtung wirkt jeder wie sein eigener Wiedergänger, und für einen Augenblick fantasierte ich, ich befände mich mit einer Horde von Untoten auf dem Weg ins Nirgendwo. Aber es waren keine Untoten sondern hart arbeitende Menschen, die mich auf der Reise durch die Nacht begleiteten, lauter Männer und Frauen, die wahrscheinlich einen langen Tag hinter sich hatten und sich nun bemühten, ihr Ziel so kräftesparend wie möglich zu erreichen. Südlich des Äquators war Reisen keine Lust, sondern Last, und den meisten meiner Sitznachbarn wäre es widersinnig vorgekommen, sich freiwillig einer solchen Tortur auszusetzen. Ihre Kleidung zeigte Spuren von Abnutzung, war aber erkennbar um Sauberkeit bemüht. Viele der Reisenden hatten die Augen geschlossen, andere waren in einer Art Wachkoma versunken, das mir in Indonesien noch oft begegnen sollte. Das Ehepaar mir gegenüber saß mit offenem Mund und glasigen Augen auf der Bank, nur ihre Köpfe konnte ich sehen, weil das Gepäck auf ihrem Schoß sie fast völlig verdeckte. Nach einigem Hin- und Herrücken legte ich mich einfach auf den schmutzigen Boden des Abteils, streckte die Füße aus und vertraute darauf, dass die Passagiere einfach darübersteigen würden. Vorher hatte ich die Schlaufen meines Rucksacks und meiner Fototasche mit meinem Gürtel verknotet.
Kurz vor Morgengrauen wachte ich auf. Die Menschen um mich herum lagen verdreht und verknotet auf ihren Sitzen, ihre Gesichter zeigten Züge maskenhafter Erschöpfung. Ich selbst fühlte mich, als hätte ich einige Monate in einem Schützengraben verbracht. Langsam rollte der Zug in den Bahnhof von Yogjakarta ein.
***
Auf dem Bahnhof von Yogjakarta war es bei weitem nicht so hektisch wie in Jakarta. Es existierte sogar ein kleiner Kaffeeausschank in der Eingangshalle, an dem ich mich erst einmal niederließ, um einen starken javanischen Kaffee zu trinken. An diesem Kaffeeausschank lernte ich Manfred kennen, einen schlanken Mathematiker aus Bonn, der mit dem gleichen Zug wie ich aus Jakarta gekommen war. Er war bleich wie eine Kalkwand und hatte große, kugelrunde Augen, was seinem Gesichtsausdruck immer etwas Überraschtes gab. Obwohl er die Reise nach Yogjakarta in der zweiten Klasse mit Sitzreservierung verbracht hatte, standen ihm die Haare zu Berge. Wie ein Traveller sah er nicht aus, eher wie ein Kulturtourist, wie sie in Ikarus- oder Studiosusgruppen durch die Welt reisten.
Wir hatten uns noch gar nicht richtig bekanntgemacht, da standen schon zwei junge Männer vor uns und brabbelten in einem englischen Kauderwelsch auf uns los. Sie trugen Sarongs, die ihnen bis zu den Sandalen reichten und erzählten, dass es ein wunderbares Hotel in der Stadtmitte gäbe und dass sie bereit wären, uns kostenlos zu dieser Traumunterkunft zu bringen. Eigentlich gehörte es zu den Grundregeln selbstorganisierten Reisens auf solche Angeboten nicht einzugehen. Sie sind fast immer ungünstiger als die Unterkünfte, die man selber finden kann. Doch wir waren so erschöpft, dass wir uns von den beiden jungen Männern zu ihren Rikschas führen ließen, um das besagte Hotel anzusteuern. Wir fuhren durch Straßen mit flachen, bunt angestrichenen Häusern und sahen Frauen hinter Marktständen, denen ihre Kulihüte wie umgedrehte Bratpfannen auf den Köpfen saßen.
Der Name des Hotels war „Murati“. Von außen sah es gut aus, dreistöckig ohne Fassadenrisse, es besaß sogar einen Palmengarten und einen kleinen Pool. Der Rezeptionist wurde von seiner Couch geschellt und begrüßte die beiden Riksckafahrer wie alte Bekannte. Uns dagegen bot er ein fensterloses Loch in der Tiefparterre an. Erst als wir uns zum Gehen wandte, war war plötzlich ein besseres Zimmer frei, das nur unwesentlich teurer war. An den langen Gesichtern unserer Riksckafahrer sahen wir, dass ihnen unsere Zimmerwechsel die Provision beschneiden würde. Mich blickte der Rezeptionist dagegen treuherzig an, als wolle er sagen: Versuchen konnte ich es ja einmal. Schlitzohr, dein Name ist Javaner. Dass ich mit Manfred das Zimmer teilen würden, hatte sich wie von selbst ergeben. Mir war es recht, wenn er nur nicht schnarchte.
Nach zwei Stunden nachgeholtem Schlafs kam ich wieder zu Kräften und las ein wenig im „Lonely Planet Guide“. Lob und Ehre für die Verfasser der geschichtlichen Kapitel dieser Reiseführer. Sie waren fast immer kurz und knackig und vermieden überflüssiges Detailgedöns, ohne deswegen oberflächlich zu sein. So, so Yogyakarta spielte also für Java die gleiche Rolle wie Delhi für Indien. Inmitten einer Landschaft von unglaublicher Fruchtbarkeit und im Schatten des großen Murati Vulkans war genau hier in Zentraljava eine der großen mittelalterlichen Kulturen Asiens erblüht, zuerst buddhistisch, dann hinduistisch und schließlich islamisch.
Das hörte sich interessant an, und ich besorgte mir einen Kaffee in der Hotelküche, die mittlerweile geöffnet hatte. So wie es aussah, hatten wir es gar nicht so schlecht getroffen. Das „Murati“ war eine Mischung aus Hostel und Hotel, in dem sich vorwiegend ausländische Individualreisende aufhielten. Nach und nach gingen die Türen auf und die verschiedensten Figuren zeigten sich auf den Etagenbalkonen. Engländer, Holländer und zwei Kanadier kamen an den Pool, einige mit einem Becher Kaffee in der Hand, andere rauchten ihre erste Morgenzigarette. Auf der Liege neben mir ließen sich zwei junge Frauen nieder. Sie hatten bereits ihren Bikini angezogen und begannen ihr morgendliches Sonnenbad. Die eine der beiden hieß Rike, ihre Freundin stellte sich als Amanda vor. Rike war ein ektomorpher Typ, hatte ein vorwitzige Nase und einen langen Kopf mit spitzem Kinn. Ihre Freundin dagegen war runder. Rund waren ihr Kopf, ihr Gesicht und ihre Figur, sie war eine mesomorphe Erscheinung.
Rike begann sofort zu plaudern und erzählte, dass sie fast am Ende ihrer Indonesien-Reise angekommen sei und am Ende der Woche von Jakarta aus nachhause fliegen würde. Zusammen mit Amanda hatte sie fast zwei Monate in Bali und Lombok „abgehangen“ ohne sich sonderlich um Vulkane oder Tempel zu kümmern. Eine Passage aus den Reisetagebüchern von Ernst Jünger fiel mir ein. „In der Sonne liegen und das Verstreichen der Zeit als unmittelbaren Genuss erleben, ist auch eine Begabung.“
In der halb nachlässigen, halb interessierten Art, wie es zum on dit unter Alleinreisenden gehört, setzte sich ein kräftiger Mann zu uns. Auf den ersten Blick war er ein wilder Geselle mit einer Sturmfrisur, die durch sein Stirnband kaum gebändigt wurde. Sein Name war Sam, er war Kanadier und bereits einige Monate auf Java unterwegs. Jeden Tag lernte er etwa ein halbes Dutzend Phrasen aus einem Bahasa Indonesia- Lehrbuch, die er am liebsten mit den Zimmermädchen einübte. Sam kam aus Manitoba in Zentralkanada und erklärte mir, wie die endlose, flache Weite seiner Heimat sein Fernweh erweckt hatte. Seine Familie sei alteingesessen und wohlhabend, der Bruder, der Geschäft und Vermögen der Familie geerbt hatte, zahle ihm eine Leibrente, mit der er die Welt bereiste. Glücklicher Sam. Sam war aber nicht nur glücklich, sondern auch ambitioniert, denn er war fest entschlossen, mit einem Kind heimzukommen. Er reise mit genau diesem Ziel durch die Welt und werde nicht ohne Kind nach Kanada zurückkehren. Sei das Kind erst einmal da, dann seien auch bald die richtigen Frauen zur Stelle. Wenn er sich da nicht mal irrte.
So verging ein fauler Tag am Pool von Yogjakarta mit allerlei halbgaren Geschichten. Gegen Mittag verschwanden Rike und Amanda, dafür gesellten sich zwei Briten zu uns, um sofort Sam ins Gebet zu nehmen. Wenn ich sie richtig verstand, beklagten sie sich darüber, wie kompliziert in Java die Beschaffung von Dope sei. Der Markt sei heikel und nicht ungefährlich. Gerade erst letzte Woche sei in einem der Nachbarhotels ein französisches Pärchen mit einem harmlosen Joint hochgenommen worden. Ich lag auf der Liege und hörte mit geschlossenen Augen zu. Die goldenen Tage der Kiffer waren offenbar vorüber, denn den Drogendealern ging es zunehmend an den Kragen. Erst vor kurzem hatte sich der neugewählte Präsident Widoko geweigert, fünfzig zum Tode verurteilte ausländische Drogendealer zu begnadigen.
Javaner sah man im Hotel nur als Kellner oder Dienstmädchen, wenn sie einen Drink zum Pool brachten oder die Zimmer säuberten. Alle Versuche, etwas mehr über das Personal oder die Hoteldirektion zu erfahren, scheiterten. Mr. Woto, der Hotelmanager, war notorisch kurz angebunden und sagte immer nur „Travel-Agency“, „Travel Agency“, wenn ich etwas fragte. Auch die Belegschaft sprach kein Wort Englisch. Ich hätte gerne gewusst, wo sie lebten, was sie verdienten und wie viele Kinder sie hatten, doch immer wenn ich etwas sagte, nickten sie nur freundlich und fuhren in ihren Verrichtungen fort.
Erheblich zugänglicher war Johnny, der spindeldürre Javaner, der wie ein Festangestellter permanent vor dem Hoteleingang herumlungerte. Er sprach ein erstaunlich flüssiges Englisch und erbot sich, jederzeit Taxen und Busse, Reiseführer und Souvenirs zu beschaffen, die natürlich teurer waren, als wenn man sie selbst organisierte. Eine seiner Standardnummern bestand darin, Neuankömmlingen, die vom Hotel aus zum Sultanspalast spazieren wollten, weißzumachen, dass der Palast vormittags geschlossen sei. Es bestände aber die Möglichkeit in der Zwischenzeit eine interessante Batikschule zu besuchen, in der man ohne Gebühr bei der Herstellung kostbarer Batiktücher zusehen könnte. Wenn man sich darauf einließ, bezahlte man nicht nur einen überhöhten Preis für die Rikscha, die einen zusammen mit Johnny zum Batikgeschäft brachte, sondern sah sich in der vermeintlichen Batikschule sofort einer massiven Verkaufsoffensive gegenüber.
***
Manfred, der stille Mathematiker aus Bonn wurde mein Reisegefährte, ein angenehmer und gebildeter Mensch, der trotz intensiver Nachfragen nur wenig von sich erzählte. Das Maximale was ich aus ihm herausbrachte, war die Mitteilung, dass er sich nach privaten und beruflichen Umbrüchen eine dreimonatige Auszeit genommen hatte, in der er einfach auf andere Gedanken kommen wollte. Eine gewisse Gehemmtheit ging von ihm aus, als gehe er mit angezogener Handbremse durch den Tag, aber er war höflich, pflegeleicht und gebildet, ohne den Schlaumeier zu spielen. Was es in seiner Umwelt an Neuem zu erleben gab, nahm er dankbar auf wie ein zurückhaltender Esser, der für jeden guten Bissen dankbar war.
Wir blieben eine gute Woche in Yogjakarta, und auch wenn ich im nachherein den Ruhm, den dieser Ort in Travellerkreisen genießt, überzogen finde, gab es jeden Tag etwas Neues zu sehen. Am schönten war es, ziellos mit geliehenen Fahrrädern durch die Stadt zu radeln. Diese Touren besaßen etwas Märchenhaftes, gerade so, als radelten zwei Gullivers durch das Reich der kleinen schlanken Zwerge. Wir durchfuhren eine überschaubare freundliche Stadt, passierten lebhafte, aber nicht überfüllte Straßen, Gemüsemärkte und die Eingänge kleiner Moscheen und Parks. Die meisten Passanten reichten mir gerade bis zum Brustbein, während wir den Einheimischen dagegen wie ungefüge Riesen erscheinen mochten. Was für hellhäutige Monster, mochten sie denken: blasse, fahle Haut, verschwitzte, fettige Haare, blöder, rastloser Blick – so würden sie uns wahrscheinlich wahrnehmen.
Die jungen Frauen, die uns auf der Straße entgegenkamen, waren teilweise verschleiert, teilweise trugen sie ihre schwarzen Haare offen zur Schau. Mit ihren feinen Gesichtszügen glichen sie kleinen Prinzessinnen, die sich wie Angehörige einer anderen Spezies durch die engen Gassen bewegten. Ihre Haut besaß einen betörenden Bronzeton, ihre Bewegungen waren so elegant, als würden ihre Füße gar nicht den Boden berühren. Viele besaßen breite, sinnliche Münder, und wenn sie lachten, wurden zwei Reihen perlweißer Zähne sichtbar. Die etwas flachen Nasen gaben ihnen etwas Vornehmes, ihre Zurückhaltung war dazu angetan, ihre Attraktivität nur noch zu steigern. Zweifellos ein Lichtblick im großen Bilderbuch der menschlichen Gattung, aber gottlob in Indonesien nicht so wohlfeil wie in Thailand.
***
Das moslemische Sultanat von Yogyakarta war im Jahre 1755 als eines von zwei Teilstaaten aus dem mohammedanischen Mataram Reich hervorgegangen (das andere war das Sultanat von Solo). Geschichtliche bedeutsam wurden die Sultane von Yogyakarta als Steigbügelhalter der holländischen Kolonialherren gewonnen, weil sie ihnen umfangreiche Konzessionen zur Etablierung von Kaffeeplantagen auf Java überlassen hatte. Alle Sultane von Yogyakartas seit 1755 trugen übrigens den bemerkenswerten Namen Hamengkubuwonbo – unterschieden wurden sie nur durch die fortlaufende Nummerierung vom allerersten bis zum derzeit zehnten Sultan, der heute noch als Hamengkubuwonbo X den rein repräsentativen Titel eines Sultans von Yogjakarta führte. Sein Palast, der Kraton, befand sich mitten in Yogjakarta und war eine der touristischen Anlaufstellen der Stadt. Sonderlich viel her machte er nicht. Mit ihrer breiten, rotgeziegelten Überdachung und ihren Säulen ohne Sichtbegrenzungen glich die Eingangshalle des Kratons einem großen Zelt. Es folgte eine ausgedehnte Anlage mit flachen Gebäuden und kleinen Höfen, in denen man sich in kunterbunter Reihenfolge Blechskulpturen, Herrscherportraits in Öl, kostbare leere Stühle auf roten Teppichen, Holzschnitzwerk und Marmorfußböden ansehen konnte. Einige javanische Dolche – sogenannte Kris – waren hinter Glas zu besichtigen. Unter Kris verstand man eine kostbare und aufwändig hergestellte Schmuckwaffe, auf die der Javaner außerordentlichen Wert legt, weil der Kris nach allgemeiner Überzeugung die Ehre der Familie und die Integrität der Person repräsentiert. Manfred erwies sich als kulturgeschichtlich gut vorbereittet und erklärte, dass es bei dem Javaner, der etwas auf sich hielt, immer drei Kris sein mussten, die er sein Eigen nannte. Zunächst besaß er seinen eigenen Kris, auf den er nichts kommen ließ. Den zweiten Kris erhielt er von seinem Vater, und wenn es ganz gut lief, dann konnte er auf einen dritten Kris zählen, den er von dem Vater seiner Frau bekam.
Während unseres Rundgangs durch den Kraton von Yogjakarta waren kaum Touristen unterwegs. Dafür saßen erstaunlich viele männliche Javaner im traditionellen Sarong mit Schnurbart und Kopftuch in den Räumen herum. Sie trugen zwar keinen Kris, glichen aber mit ihrem strengen Blick den Sultanen auf den Gemälden auf eine so frappante Art, dass ich einen Moment fantasierte, die Herrscher seien aus ihren Rahmen herabgestiegen, um sich leibhaftig die Besucher anzuschauen, die es in ihren Palast verschlagen hatte. In Wahrheit handelte es sich um die Tempelwächter, von denen es in ganz Yogjakarta über fünfzehnhundert geben soll und deren herausragendes Berufsmerkmal darin bestand, praktisch nichts zu tun zu haben. Trotzdem war ihrem Mienenspiel deutlich zu entnehmen, dass sie nicht belästigt werden wollten, was auch ganz sinnlos gewesen wäre, weil sie kein Wort Englisch verstanden.
Erheblich interessanter als der Besuch des Kratons war der anschließende Spaziergang durch die engen Gassen der umgebenden Viertel. Solche Stadtviertel oder Dörfer, in denen jeder jeden kannte, wurden als Kampungs bezeichnet. Innerhalb dieser Kampungs gab es Ortsvorsteher, die auf Recht und Ordnung achteten und auf alle Unbekannten ein wachsames Auge hatten. Früher soll es üblich gewesen sein, dass jeder Fremde, der einen Kampung betrat, laut seinen Namen, seine Herkunft und seine Begehr ausrief, damit jeder wusste, woran er war. Davon war während unserer Spaziergänge durch die Kampungs von Yogjakarta allerdings nichts zu bemerken. Die einzigen, die herumbrüllten, waren die Rikschafahrer und die Batikverkäufer. Etwas ruhiger war es in den Warungs, den indonesischen Garküchen, in denen für erstaunlich wenig Geld schmackhaftes und ausreichendes Essen serviert wurde. Die einheimischen Kunden waren kleine, flinke Personen, die ganz im Unterschied zum Ruf der asiatischer Ruhe ihr Essen verputzten, als säßen ihnen die Dämonen im Nacken. Manche hielten dabei die Reisschale vor den geöffneten Mund wie vor eine Garageneinfahrt und schaufelten den Reis mit dem Essstäbchen klumpenweise in den Schlund. Aufnehmen, reinschieben, schlucken, dann war der Reis verputzt, und die Verdauung begann. Lange herumzusitzen, die Beine unter den Tischen ausgestreckt, den Rücken halb auf der Stuhllehne abgestützt und lässig in der Gegend herumglotzen, war dagegen das Privileg der Backpacker. Hätten sie nicht ohnehin anders ausgesehen, hätte man sie an ihrer Haltung erkennen können.
***
Über neunzig Prozent der Einwohner von Yogjakarta waren Moslems, doch im Unterschied zu anderen moslemischen Ländern war dieser Umstand keineswegs augenfällig. War er deswegen weniger wichtig? Keineswegs. Es handelte sich nur um einen anderen Islam, als man ihn im Westen kannte. Wollte man seine Besonderheit in einer Allegorie beschreiben, so glich die javanische Kultur einer Person, die im Laufe ihrer Biografie ihre Religion gewechselt hatte, es aber nicht übers Herz brachte, ihre farbenfrohe Erscheinung den strengeren Vorschriften des neuen Glaubens vollständig anzupassen. Man trug zwar nun ein anderes Kleid, aber das Unterfutter der alten Religion war erhalten geblieben. Bei aller Unterschiedlichkeit im Einzelnen erinnerten mich die Javaner in dieser Hinsicht an die Brasilianer. Hier wie dort hatten sich alte Riten und Glaubenssätze in die Lehren des offiziellen Monotheismus hineingeschmuggelt. In Salavdor de Bahia verehren die Brasilianer den heiligen Antonius und den westafrikanischen Gott Ogun in Personalunion. In Java hatten Ahnenverehrung und Totenkulte als Bestandteile des Volksislams überlebt. Abgesehen vom streng islamischen Banda Aceh in Nordsumatra war der indonesische Islam ein religiöses System, das seinen Ursprung in der indischen Kultur nicht verleugnen konnte.
Was aber bedeutet das im Einzelnen? Beim Kris, dem Schmuckdolch, der als soziales Symbol den Wechsel vom Hinduismus zum Islam überdauert hatte, waren der Dolch und seine Scheide in den althinduistischen Zeiten gerne mit Tierköpfen und fantastischen Figuren verziert worden. Im Islam aber war die figürliche Darstellung verboten. Der fromme Moslem, der auf seinen Kris nicht verzichten wollte, reagierte flexibel. Er behielt den Dolch, achtete aber darauf, dass auf Knauf und Scheide nur noch abstrakte Motive zu sehen waren. Die animistische Bedeutung aber war gleichgeblieben.
Ein ähnliches Problem ergab sich beim Wayang, dem uralten indonesischen Puppenspiel. Eigentlich war die Darstellung des Menschen, und sei es auch nur durch Puppen, Allah alleine vorbehalten, weswegen im Prinzip das Puppenspiel verboten werden müsste. Pragmatisch wie der Javaner ist, fand er im Wayang Kulit die Lösung: Der Puppenspieler, der Dalang, hantiert mit seinen Puppen vor einer Lichtquelle, und die Zuschauer sehen nur, wie die Schatten der Puppen an einer weißen Wand sich bewegen.
Ein weiteres Beispiel für die Symbiose von Hinduismus und Volksislam stellte das Ramayana dar. Seit über anderthalbtausend Jahren gehörte das indische Ramayana-Epos zum indonesischen Kulturbestand. Die Geschichte vom Prinzen Rama und seiner Gattin Sita, der Raub der Sita durch den bösen Ravana und die Befreiung Sitas durch Rama, der dazu nach Sri Lanka, auf die Insel der Lotosblüte, übersetzte, verbreitete sich im ersten Jahrtausend der Zeitrechnung von Indien aus über ganz Südostasien. Inzwischen hatte sich das Ramayana als das Epos Asiens sich längst über die Grenzen der Religionen erhoben. Es wurde im buddhistischen Thailand ebenso gespielt wie im muslimischen Indonesien – und dass trotz aller Verbote der Figurendarstellung.
Unweit vom Hotel war die Aufführung eines Ramayana-Ballets abgekündigt. Schon seit zwei Tagen konnte kein Gast mehr unbehindert am Pool sitzen, ohne dass ihm Herr Woto nicht eine Karte angeboten hätte. Die Vorführung fand im Garten eines Nachbarhotels statt. Es war stockdunkel, als das Gamelan Orchester erklang. Es wurde mit Glöckchen gebimmelt, mit Hämmerchen geschlagen, getrommelt und getutet, was das Ohr ertrug, dann erschienen die Hauptdarsteller, prachtvoll aufgeputzt, mit ihren Sarongs, Umhängen und Goldkronen. Der größte und bunteste der Darsteller musste Rama sein. Er schwang seinen Dolch, den Kris, hin und her, und wer sich ihm in den Weg stellte, wurde verstümmelt, abgemurkst, erstochen oder enthauptet. Immer mehr Gestalten füllten die Bühne, sie bewegten sich wie Marionetten, eckig, mit abrupten Bewegungen, als seien ihnen die Knochen eingerostet nach einem streng reglementierten Drehbuch. Zum Finale starb der Bösewicht, Rama riss die Arme in die Luft, während seine Sita streng rituell mit winzigen Tippelschritten von dannen schwebte.
***
Manfred war Tierliebhaber und konnte keinen Zoo passieren, ohne nicht hineinzugehen. Auch ich mochte Tiere, kannte mich mit ihnen aber nicht so gut aus, so dass ich froh war, Manfred dabeizuhaben, als wir den Vogelmarkt besuchten. In kleinen Holzkäfigen saß ein ganzer Querschnitt der indonesischen Vogelwelt und blickte uns trübsinnig an. Ich ließe einen Uhu tanzen, indem ich ihn durch die kleine Öffnung unter dem Käfig an seinen Krallen kitzelte. Ein Vogel mit einem Federkleid in Pink und einer Frisur wie ein Irokese fixierte mich feindselig, dann sprang er mit seinen Krallen an das Käfiggitter und stieß spitze Schreie aus. Ein Adler saß mit geschlossenen Augen still und unglücklich auf einem Holzstab, durch zwei kleine Ketten seiner Freiheit beraubt.
Einmal im Reich der Tiere angekommen, zog es Manfred gleich weiter in den Zoo von Yogjakarta. Der Zoo von Yogjakarta war berühmt dafür war, dass er Tiere aus zwei zoologischen Großregionen der Welt beherbergte: aus Sumatra, Java und Borneo, sprich: aus Südostasien – und aus den Inseln östlich von Bali, die schon zur australischen Fauna gezählt wurden. Tatsächlich begegneten mir im Zoo von Yogjakarta Lebewesen, die ich noch nie vorher gesehen hatte. Ein so genanntes Emu mit kräftigen Beinen stand unbeweglich in seinem Gehege, als wäre er ausgestopft. Wer diesem Vogel zu nahe kommt, erhält einen Tritt, der sich gewaschen hat, erklärte Manfred. Gleich nebenan trottete ein unglaublich hässliches, schweinsartiges Wesen durch den Käfig. Es handelte sich um einen Barbirusa, auch Hirsch-Eber genannt, den man daran erkannte, dass er tatsächlich anstelle der normalen Hauer ein Art Geweih auf dem Kopf trug. Das Kuriose an diesem Geweih war sein gebogenes Rückwärtswachstum, so dass es vorkommen konnte, dass die auswachsenden Geweihspitzen dem Tier in den Kopf drangen und es töteten. Große Schlangen, von den nicht erkennbar war ob sie aus dem asiatischen oder der australischen Tierwelt stammten, lagen müde in ihren Gehegen, neben ihnen gefesselte todgeweihte Vögel, die ihnen als Lebendnahrung dienen würden, sobald sie Hunger bekommen würden. Als wüssten sie um ihr Schicksal, gaben die kleinen Vögel keinen Pieps von sich und hielten still, so gut sie konnten. Nur der Komodo Waran, den wir zu sehen gehofft hatten, war gerade unterwegs. Vielleicht war er an den Mini Indonesia Park in Jakarta verliehen worden, wo der fest angestellte Komodo Waran kürzlich verstorben war.
***
Weniger als dreißig Kilometer von Yogjakarta entfernt, befand sich Parangritis, der heilige Ort der Meeresgöttin Loro Kidul. Wie dem Osterhasen im Christentum war es auch der Meeresgöttin Loro Kidul mühelos gelungen, sich in den Nischen einer fremden Hochreligion auszubreiten. Den meisten Backpackern war das egal, sie schätzten die Loro Kidul, weil ihr Tempel an einem der schönsten Strände Südjavas lag.
Zusammen mit Sam und Rike, aber ohne Amada (die sich mit Rike verzankt hatte), unternahmen wir einen Ausflug zum Strand von Parangritis. Wir bestiegen in Yogjakarta ein Bemo, in dem es herrlich geräumig war, ohne vorauszusehen, dass sich dieser Minibus bis zu unserem Ziel mit immer mehr Passagieren füllen würde. So klein und geschmeidig die Javaner auch waren, so geschickt sie sich in den engsten Lücken einzurichten wussten, am Ende quietschten die Achsen bedrohlich, und kurz vor dem Ziel mussten alle Fahrgäste aussteigen und die letzte Anhöhe zum Strand zu Fuß überqueren.
Und dieser Strand konnte sich sehen lassen. Im wolkenfreien Sonnenlicht eines ganz und gar untypischen Tropentages lag das schwarzsandige Ufer von Parangritis vor uns. Sanft geschwungene Berge umrahmten die Bucht. Zwischen Land und Meer erstreckte sich ein prachtvoller Palmenhain, in dessen Mitte sich der beflaggte Tempel der Loro Kidrul erhob. Vom Indischen Ozean her wehte ein frischer Wind über den Strand und ließ die Papierdrachen am Himmel tanzen. Aber niemand badete. Nicht nur, weil der Javaner ohnehin keine Wasserratte ist sondern weil die tückischen Strömungen im Süden Javas selbst geübten Schwimmern gefährlich werden können. Wer hier versank, wurde nie mehr gefunden, denn südlich von Java stürzte der Meeresboden im Sundagraben bis zu 7500 Metern tief ab.
Deswegen blieben auch wir auf dem Trockenen. Sam legte sich in den Schatten einer Palme und memorierte seine Tagesration an Bahasa Indonesia-Phrasen. Heute waren die Notfälle dran. „Talang Saya!“ hieß: „Helfen Sie mir“. „Panggi Doktor“ bedeutete: „Bitte rufen Sie einen Arzt“, und wenn man jemanden mitteilen wollte, dass ein Unfall stattgefunden hatte, dann sagte man „Ada kecelakaan.“ Rike erzählte Manfred, warum sie sich mit Amanda verzankt hatte, was sich dieser geduldig anhörte. Ich legte mich auf mein Handtuch in den Sand und schloss die Augen. Das Rauschen der Brandung deckte alle Geräusche wie eine dicke Decke zu, und ich schlief ein.