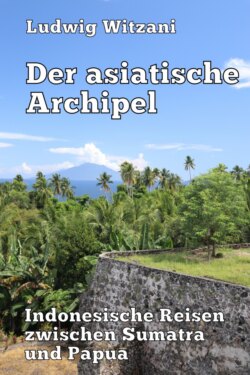Читать книгу Der asiatische Archipel - Ludwig Witzani - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Shiva und Buddha
im Schatten der Vulkane Eine Reise zum Dieng Plateau, zum Borobodur und zu der Tempelanlage von Prambanan
ОглавлениеDer Taxifahrer hieß Sashan, er war ein junger Javaner mit einem spärlichen Oberlippenbart und grotesk dünnen Armen. Während der ganzen Fahrt gab er keinen Mucks von sich, kaute aber unablässig Betelnüsse, deren Süd er in hohem Bogen aus dem Fenster spuckte. Sein Wagen war äußerlich in vertretbarem Zustand, glich aber im Inneren einer Müllkippe, war also genau das Gegenteil eines javanischen Kampunghauses. Zusammen mit Sam, Rike und Manfred befand ich mich auf einer Tagestour zum Dieng Plateau, das gute einhundertzwanzig Kilometer nordwestlich von Yogjakarta in den Tenanggungbergen lag. Eine lange Tagestour, deren Fahrtpreis durch drei geteilt wurde. Da Rike pleite war, durfte sie umsonst mitfahren.
Kaum hatten wir Yogjakarta verlassen, empfing uns die Landschaft Javas wie ein Schock. Eine Endlosigkeit von Feldern, Palmen und sanft geschwungenen Bergen erstreckte sich links und rechts der Straße. Sie war durchsprenkelt mit kleinen Dörfern und bevölkert von unzähligen Menschen, die in den Reisfeldern standen oder mit ihren Wasserbüffeln die Felder bearbeiteten. Der homo javanensis und sein Freund, der Boden Javas, ein unschlagbares Team auf dem vielleicht fruchtbarsten Boden der Welt. Dieser Boden war der Wohltäter der Insel, eine unendlich langsam explodierende Granate des Lebendigen, die die Pflanzen nur so aus sich herausschleuderte. Was wir sahen, war eins Symphonie des Lebens in grün: giftgrün war das feuchte Moos an den Rinden der Bäume, hellgrün waren die Farne an den Straßenrändern und sattgrün die Palmenblätter, die die Felder begrenzten. Dieser Boden existierte in einem Übermaß von Regen und Sonne und nährte sich von den Mineralien, die die javanischen Vulkane bei ihren Ausbrüchen über das Land verteilten. Einer der Väter dieser Fruchtbarkeit befand sich übrigens nur 36 Kilometer von Yogjakarta entfernt: Sein Name war Merapi, er war groß und schön, pyramidal und brandgefährlich. Seit Anbeginn der menschlichen Geschichte glomm er vor sich hin, um gelegentlich wie eine Apokalypse über das Land zu kommen. Es hieß, dass er dann Glutwolken ausspieh, fast tausend Grad heiß und so schnell, dass es vor ihnen keine Rettung gab.
Doch von dieser Bedrohlichkeit war an diesem Tag nichts zu erkennen. „Der Merapi schläft“, hatte es in Yogjakarta geheißen, und tatsächlich zog der Vulkan wie ein Ausbund an Friedlichkeit am Horizont vorüber. Oder war es ein anderer Vulkan? Wer wollte bei so viel Magma unter der Erde die Übersicht behalten? Oberhalb der Erde aber prangten die Geschenke der unberechenbaren Erde, veredelt durch den Fleiß der Menschen.
Auf sanft ansteigenden Bergschrägen waren Reisterrassen angelegt worden. Reisterrassen schmückten die Landschaft um den Preis unfassbarer Mühe, nicht nur, was ihre Anlage, sondern auch, was ihre Erhaltung betraf. Die Bewässerung der Reisterrassen war wegen des reichlichen Regens zwar kein Problem, aber die Gefällewinkel der Terrassen mussten genau die richtige Schräge finden, um sowohl eine Verschlammung wie ein zu schnelles Abfließen des Wassers zu verhindern. Ihre Begrenzungen glichen den Brüstungen kleiner Burgen, in ihrem Wasser verdoppelte sich der Zug der Wolken.
Als wir in einem indonesischen Dorf, eine kurze Rast einlegten, waren wir sofort von Kindern umringt. Ich konnte mich kaum sattsehen an ihrer filigranen Vollkommenheit, dem Bronzeton ihrer Haut, dem blauschwarzen, dichten Haaren und ihren großen, neugierigen Augen. Alle waren barfuß unterwegs, die meisten trugen kurze Hosen und halb zerrissene Leibchen über ihren schmalen Oberkörpern. Sie bettelten nicht, sie störten nicht, sondern starrten uns aus ihren großen Augen an wie Aliens aus einem anderen Universum. Vor allem der massige Sam hatte es ihnen angetan, am liebsten hätten sie seine helle Haut und seinen Bart berührt. Schließlich wurden sie mutiger und begannen auf Sam einzubrabbeln, was Sam Gelegenheit gab, Kostproben seiner Bahasa Indonesia Kenntnisse zum Besten zu geben. „Saya seorang lelaki kulit putih” (Ich bin ein Weißer) sagte er, was die Kinder zu kreischendem Lachen veranlasste. Dann machte Sam plötzlich „Buh!“, und erschrocken stieben die Kinder auseinander.
Nach der Rast führte die Straße in stetigen Windungen langsam höher. Endlich wurde es etwas kühler. Rike kurbelte das Seitenfenster herunter und zündete sich eine Zigarette an. Im Grunde war sie ein hübsches Mädchen, sie besaß ausdrucksstarke Augen und niedliche Pausbäckchen, die auch die Entbehrungen einer monatelangen Indonesienreise überstanden hatten. „Was hat es eigentlich mit diesem Dieng Plateau auf sich?“ fragte sie.
„Auf dem Dieng Plateau befinden sich die Überreste hinduistischer Tempel mitten in einem Vulkankegel“, antwortete Sam. Er saß gleich neben ihr und wirkte in seiner Massigkeit wie eine Vatergestalt. Frag mich, und ich sage dir, was du wissen willst.
„Und wie kommen diese Hindutempel nach Java?“
„Indische Händler und Priester erschienen vor anderthalbtausend Jahren in Java und brachten ihre Kultur mit“, erwiderte Sam.
„Cool“, sagte Rike.
Sashan rotzte einen roten Betelklumpen in hohem Bogen aus dem Seitenfenster. Manfred bat darum kurz anzuhalten, um sich zu erleichtern. Er war blass und schweigsam, eine Magenverstimmung wollte nicht weichen.
In der kurzen Pause erkletterte ich eine Anhöhe, um einen Überblick zu gewinnen. Die Gegend war nun bergiger geworden, ohne dass die Vegetationsdichte abgenommen hätte. Bäume und Felder erstreckten sich bis zu den Bergen am Horizont. Der Himmel hatte sich zugezogen, schwarze Wolken lagen über dem Temanggung.
Eine Stunde später begann es in Wonosobo zu regnen. Die Straße wurde schlechter und rutschig, als wir nach Norden abbogen. Nach einer weiteren halben Stunde hatten wir unser Ziel erreicht: das Dieng Plateau auf etwa zweitausend Metern Meereshöhe, eine der interessantesten Sehenswürdigkeiten Javas – aber nur, wenn die Sonne schien. Leider goss es wie aus Kübeln, und es war praktisch nichts zu sehen. Nasser Nebel umwaberte unser Fahrzeug. Von den Rändern des riesigen Vulkankegels, in dem wir uns befanden, war überhaupt nichts zu erkennen.
Auf den ersten Blick war es erstaunlich, dass die hinduistischen Javaner im achten und neunten Jahrhundert gerade hier ihre erste große Tempelstadt errichtet hatten. Weitab von den landwirtschaftlichen Zentren der Insel in der Nähe eines Himmels, aus dem es in Java im Laufe eines Jahres noch mehr regnen kann als in Indien. Doch es war ein magischer Ort, denn ein Teil des Nebels, der uns umgab, entstand durch die heißen Dämpfe, die aus dem Kraterboden stiegen wie der Dampf aus kochenden Töpfen.
„Muss ich da raus?“ fragte Rike. Niemand antwortete.
Als wir endlich in einer kurzen Regenpause die sorgsam gekennzeichneten Wege durch den Vulkankessel liefen, passierten wir zahlreiche Löcher und Erdspalten, aus denen es zischte, gurgelte und dampfte, als befände sich der Schlund der Hölle direkt unter uns. Ich überprüfte mit der Hand die Temperatur der Böden. Immerhin, sonderlich warm war er nicht. War das ein gutes Zeichen?
Dann erschienen die ersten Tempelruinen im Dunst. In der Blütezeit des javanischen Hinduismus sollen auf dem Dieng Plateau über hundert Tempel gestanden haben. Übrig geblieben waren gerade mal acht. Sie waren aus Stein erbaut, standen auf soliden Sockeln und besaßen ein stufenförmig-pyramidal zulaufendes Dach. Hier und da waren die halb verwitterten Reste von Steinmetzarbeiten an den Außenwänden zu erkennen. Ein durch den Regen der Jahrhunderte eingeweichter Shiva aus Stein blickte mich an. Keiner der Tempel machte als Bauwerk etwas Besonderes her, aber vor der Kulisse von Nebel, Dampf und Regenwolken wirkten sie wie die Überreste eines versunkenen Imperiums.
Ich erinnerte mich an Mahaballipuram im Südosten Indiens, einen heute recht verschlafenen Ort, von dem aus im indischen Mittelalter die Handelsflotten nach Südosten aufgebrochen waren. Der Kailasa-Tempel am Strand von Mahaballipuram war vielleicht die Blaupause dieser viereckigen kleinen Tempel gewesen, wer wollte das wissen? Dieser indische Kulturtransfer seit der Mitte des ersten Jahrtausends muss ein überwiegend friedlicher Import gewesen sein, bei dem die Neuankömmlinge aus Mahaballipuram, Madurai oder Cochin nicht nur begehrte Waren sondern auch die Errungenschaften einer überlegenen Kultur mitgebracht hatten. Mit ihnen waren die indischen Epen wie Ramayana und Mahabharata ebenso nach Java gelangt wie das Sanskrit, aus dem zahlreiche Lehnworte in die javanische Sprache übergegangen waren.
Der Regen nahm zu, der Untergrund wurde matschig und Sashan drängte zur Rückkehr. Ich wäre gerne noch etwas länger geblieben, doch inzwischen hatte es sich wieder eingeregnet, und es war nichts mehr zu sehen. Was würde ich mitnehmen von diesem Platz? Eine Stimmung, eine Farbe der Welt, die mit anderen Farben Asiens zu einer Erinnerung werden würde, ein Gefühl, das eine Zeitlang in mir nachhallen würde, ehe es verschwand.
Auf der Rückfahrt wurde die Sicht auf den abschüssigen Straßen immer schlechter. Doch Sashan kaute unverdrossen seine Betelnüsse, rotzte den Sud in den Regen und lenkte den Wagen stets schon in die richtige Richtung, ehe die Kurve überhaupt sichtbar wurde. Allerdings fuhr er zu schnell, und mehr als einmal geriet das Taxi ins Schleudern. Der einzige Trost war, dass wir die möglichen Abgründe, auf die wir zurutschten, wenigstens nicht sehen mussten.
Dann wieder der gleiche abrupte Wechsel wie auf der Hinreise. Kaum hatten wir das Bergland verlassen, verschwanden Wolken und Regen wie abgeschnitten. Eine gleißende Sonne beschien die gleiche Szenerie aus Vulkanen, Reisterrassen, Feldern und Palmen, die wir schon am Vormittag gesehen hatten. Alles, was in den Tropen geschah, geschah plötzlich: eine Infektion, ein Stimmungsumschwung, der Einbruch der Nacht und auch der Wetterwechsel.
Es war schon dunkel, als wir das Merapi Hotel in Yogjakarta wieder erreichten. Manfred verzog sich sofort auf die Toilette. Rike verschwand in Sams Zimmer. Ich las ein wenig in der Biografie von Max Dauthendey.
***
So vielfältig wie die buddhistische Lehre ist auch ihre Tempelarchitektur. In Sri Lanka gleichen die „Dagobas“ halb in der Erde versenkten weißen Atommeilern. In Burma und Thailand, wo man sie „Chedis“ nennt, erinnern sie an spitz zulaufende goldene Weihnachtsbäume. In Japan und China wirken die buddhistischen Tempel wie große, bunt bemalte Riesenscheunen. Der Borobodur, der größte buddhistische Tempel der Welt, glich keiner dieser Formen. Er war ein Unikat ganz für sich, und es war fraglich, ob man ihn überhaupt als Tempel ansprechen konnte.
Schon als ich ihn das erste Mal aus der Ferne süberraschten mich die Form und die Größe des Bauwerkes. Wäre der Vergleich nicht so despektierlich, könnte man das Gebäude mit einer riesigen fliegenden Untertasse vergleichen. Mit seinen einhundertzwanzig Metern Seitenlänge und einer Höhe von etwa vierunddreißig Metern wuchs der Borobodur inmitten eines weiten, von Bergen begrenztem Tals wie eine Frucht menschlicher Kreativität aus der Erde Javas heraus. Es hieß, dass über 10.000 Arbeiter generationenlang an seiner Erbauung beteiligt gewesen waren. Hatten sie es freiwillig getan, als eine Art Gottesdienst wie bei den ägyptischen Pyramiden, oder waren sie Sklaven gewesen? Zwei Millionen Steinblöcke waren aufgetürmt worden, ehe an den kilometerlangen Wandelgängen über fünfhundert Buddhaskulpturen eingemeißelt worden waren. Die ungeheuren Anstrengungen, die die javanische Sailendra Dynastie zur Errichtung dieses Bauwerkes mobilisieren musste, hatten möglicherweise zu ihrem Untergang beigetragen. Nur wenige Generationen nach der Fertigstellung des Borobodur um das Jahr 800 war das Reich der Sailendra zusammengebrochen.
Geblieben war ein steinernes Riesenmandala, das seine Besucher zu einer kilometerlangen Prozession zwischen den drei buddhistischen Welten einlud. In den altjavanischen Zeiten hatte der Rundgang durch den Borobodur auf ebener Erde im „Kamadathu“, auf der Stufe des irdischen Daseins, begonnen. Er setzte sich fort über die sechs Terrassen des „Rupadathus“, der Ebene der vergeistigten Formen, und erreichte schließlich „Arupadathu“, die Ebene der absoluten Abstraktion auf dem flachen Dach des Borobodur. Während die unterste Ebene nicht mehr zugänglich war, weil das Gebäude im Laufe der Jahrhunderte eingesunken war, konnte der Besucher auf den sechs mittleren Terrassen des Rupadathus hunderte stilisierter Buddhastatuen und über 1200 Steinmerzarbeiten betrachten. Ein gläubiger Buddhist, der diese Galerien entlangwanderte, tauchte ein in den Mythenschatz seiner Religion, identifizierte den Buddha in seinen frühen Lebensformen, den Jakatas, und erkannte all die Dämonen, Geister und mythischen Tiere wieder, die in den heiligen Schriften beschrieben wurden.
Oben angekommen, auf der Ebene der vollständigen Abstraktion, erblickten wir eine monumentale, acht Meter hohe Stupa, die ihrerseits von 72 kleineren Stupen umgeben war. In diesen kleineren Stupen befanden sich wiederum steinerne Buddhas, deren Umrisse man durch die perforierten Stupenwände erkennen konnte.
Allerdings war Buddhismus des Borobodur, der im Borobodur dargestellt wurde, nicht der ursprüngliche Buddhismus, den der historische Buddha im sechsten und fünften Jahrhundert vor der Zeitrechnung in Indien gelehrt hatte. Denn dieser ursprüngliche, „ältere“ Buddhismus war alles andere als eine „frohen Botschaft“ gewesen. Die ursprüngliche Lehre des Buddha war als eine knochenharte Erlösungslehre ohne Gott in der Welt erschienen, als eine religiöse Praxis für geistliche Asketen, die den einfachen Menschen weit überforderte. Kein Geist und kein Gott, keine Wunder und keine Gnade standen dem Gläubigen auf seinem Weg ins Nirwana zur Seite. Seine Seele war allein im Universum, und es war allein ihre Kraft, die über ihre Höherentwicklung und ihre Annäherung an das Nirwana entschied.
Niemals wäre der Buddhismus zur Weltreligion Asiens geworden, hätte er sich nicht ein gutes halbes Jahrtausend nach seiner Entstehung tiefgreifend verändert. Ein neuer, reformierter Buddhismus entstand, der im Verlauf mehrerer großer buddhistischer Konzile in den ersten Jahrhunderten der Zeitrechnung seine definitiven Formen erhielt. Dieser neue Buddhismus basierte auf einer Neubestimmung der erhabenen Seele. Ihre Erhabenheit zeichnete sich nicht mehr durch das Streben nach der eigenen Erlösung aus, sondern dadurch, dass sie am Rande des Nirwanas auf ihr eigenes Verlöschen freiwillig verzichtete, um als hilfreicher und gnädiger Geist, als „Bodhisattwa“, die einfachen Menschen in ihrem tätigen Leben zu unterstützen. Es dauerte nicht lange bis diese "Bodhisattwas", verstanden als gottähnliche, mitleidende und gnadenreiche Wesen, in großer Zahl den ursprünglich völlig gott-losen buddhistischen Kosmos bevölkerten. Wo im älteren Buddhismus nichts gewesen war als die Sehnsucht der müden Seelen nach dem Nichts, entstanden nun Myriaden hilfreicher Geister, deren Existenz nach Darstellung und Verherrlichung in allen Bereichen der Kunst verlangte.
Diesen neuen, „jüngeren“ Buddhismus, der die Erlösung von viel mehr Menschen als früher verhieß, bezeichnete man als „Mahayana“, als das „große Fahrzeug“, im Unterschied zum „Hinayana“, dem „kleinen Fahrzeug“ des ursprünglichen Buddhismus. Dass dieser neue Buddhismus Millionen guter Götter und Geister alle älteren Ahnenkulte frisch missionierter Völker mühelos in sich aufnehmen konnte, verstand sich von selbst.
Der Borobodur ist das steingewordene Mandala des javanischen Mahayana-Buddhismus. Er wurde als eine Prozessionsstraße konzipiert, auf der der Gläubige den zahllosen Buddhas und Bodhisattwas begegnen konnte, die ihn auf dem Weg zur Ebene der formlosen Erkenntnis begleiteten. Diese Prozessionsstraße versinnbildlichte die schrittweise Höherentwicklung des Menschen vom Stofflichen über das Geistige zum absoluten Nichts. Wenigstens diese allgemeine Richtung hatte der Mahayana- Buddhismus mit dem Hinayana-Buddhismus gemeinsam.
Inzwischen war der späte Nachmittag angebrochen. Die Anlage wurde immer voller, und es war kaum noch möglich, irgendeine Statue ohne vorbeigehende Touristen in Ruhe zu betrachten. Die meisten Besucher waren moslemische Javaner, sie wurden begleitet von ihren verschleierten Frauen, die gerne vor der einen oder anderen Buddha-Skulptur posierten. Das mochte zunächst überraschen, denn streng genommen verkörperte der Buddhismus, gleich ob in der älteren oder der jüngeren Form, für einen Moslem den Inbegriff des Heidentums. Tatsächlich hatte der Islam, wo immer er in den Jahrhunderten seiner Expansion Fuß gefasst hatte, den Buddhismus mit Stumpf und Stiel ausgerottet. In Nordpakistan, in Bengalen und in Kaschmir war nach dem Sieg des Islam nichts vom Buddhismus übriggeblieben, und noch vor kurzem hatten islamistische Terroristen die große Buddha-Statue von Bamyan in Afghanistan in die Luft gesprengt.
In Indonesien war der offizielle Umgang mit den vorislamischen Überresten ein anderer. Seitdem der Borobodur zum Anschlagsziel für islamistische Terroristen geworden war, hatte man militärische Kontrollposten rund um das Bauwerk eingerichtet, von denen aus der Besucherstrom genau beobachtet werden konnte. Als sich Rike eine Zigarette anstecken wollte, wurde sie von den Wachtposten scharf zurechtgewiesen. War der Buddhismus auf Java auch untergegangen, schuldete man ihm doch noch Respekt.
***
Im Ursprung war der indische Tempel nichts weiter als ein fensterloser Raum gewesen. In seinem Innern hatte sich die Götterstatue befunden, die nur von den Brahmanen gesehen werden durfte. Die Gläubigen mussten draußen bleiben. Die weitere Entwicklung führte zu quadratischen Steingebäuden, wie wir sie auf dem Dieng Plateau gesehen hatten. Im nächsten Schritt entstand ein überdachter Vorraum, in dem sich die Gläubigen versammeln konnten. Dann begann der eigentliche Tempelkorpus, der Raum, in dem das Götterbildnis aufgestellt war, zu wachsen. Aus einem quadratischen Raum entwickelte sich ein sich parabelförmig nach oben verengender Turm, die sogenannte Sikhara. Sie repräsentierte im Glauben der Hindus den Weltberg Meru, den Sitz der Götter im Himalaja. Auch die Basis dieses Turms, die Cella, veränderte sich. Aus ihr entstand die „Grabhagriha“, die Kammer des Allerheiligsten, zu dem außer den Brahmanen noch immer niemand Zutritt hatte. Als schließlich Vorhalle und Sikhara auf ein Podest gestellt und zu einer baulichen Einheit zusammengefasst wurden, war die architektonische Genese abgeschlossen.
Es spricht für die Enge der kulturellen Verbindung von Indien und Java, dass dieser gerade erst im indischen Orissa vollendete Tempeltyp schon im zehnten Jahrhundert auch in Java Platz griff – und zwar in einer geradezu monumentalen Form, die die meisten zeitgenössischen Tempelbauten im Mutterland in den Schatten stellte. Die Rede ist vom Prambanan, einem der größten Tempel der hinduistischen Welt knapp zwanzig Kilometer östlich von Yogjakarta.
Unwillkürlich blieben wir stehen, als wir den Prambanan zum ersten Mal erblickten. Vor uns erstreckte sich eine riesenhafte Tempelanlage von einhundertfünfzig Metern Seitenläge, auf deren Basis sich drei Sikharas, drei gewaltige Tempeltürme, erhoben. Die Natur, die alles um uns herum zum Blühen brachte, schien ihre Vollendung in den drei steinernen Riesengewächsen zu finden, die vor uns in den Himmel ragten. Über vier Eingänge, die entsprechend der Himmelsrichtungen angeordnet waren, passierten wir die Ringmauern und stießen auf die Überreste von weit über hundert kleinen Tempelbauten, von denen man annahm, dass es sich um Mönchsgräber gehandelt hatte. Über Ihnen, auf einer erhöhten Terrasse, erhoben sich die drei Haupttempel von Brahma, Shiva und Vishnu, von denen der mittlere, der Shivatempel, der Größte war. Folgte man der Schulbuchweisheit der Religionsbücher, dann repräsentierten diese drei Göttergestalten die oberste hinduistischen Dreieinigkeit, die Prinzipien der Schöpfung (Brahma), der Erhaltung (Vishnu) und der Zerstörung (Shiva). Schaute man etwas genauer hin, erkannte man im Hinduismus eine bipolare Hochreligion mit Vishnu und Shiva als herausragenden Götterfiguren, während Brahma eigentlich nur ein abstraktes und selbst in Indien kaum verehrtes Prinzip darstellte. In dieser Doppelreligion repräsentierte Vishnu die etwas vornehmere Göttergestalt, die in ihren unterschiedlichen Inkarnationen die Welt bereits neunmal gerettet hatte, ehe sie in der noch bevorstehenden zehnten Inkarnation die Welt für alle Zeiten erlösen würde. Shiva, der in Indien als Tänzer, Ganj-Raucher, Zerschmetterter und Schöpfer verehrt wird, ist demgegenüber die wildere, menschennähere Figur, die vielleicht gerade deswegen eine noch höhere Verehrung als Vishnu genießt. Dementsprechend war auch in der Tempelanlage vom Prambanan Shiva der mit 46 Metern Höhe größte und herausragendste Tempel gewidmet.
Ebenso wie der Borobodur waren die Ringmauern und Außenwände der Bauwerke mit zahllosen Skulpturen geschmückt – man erkannte Szenen aus dem Ramayana, thronende Götter, Tänzerinnen, Blumenmotive und immer wieder Löwenköpfe, die den Betrachtern aus winzigen Nischen anzublicken schienen. Den drei großen Tempeln des Shiva, Brahma und Vishnu standen drei kleinere gegenüber, die ihren Reittieren gewidmet waren, doch nur der Tempel des Nandis, Shivas Stier, war erhalten geblieben. Rechts und links der Treppe, die zum Eingang des Shivatempels emporführte, befanden sich glockenförmige Gebilde, die buddhistischen Stupen ähnelten, ohne dass man genau wusste, ob sich hier eine Vermischung von Hinduismus und Buddhismus andeutete.
Der Prambanan, benannt nach einem benachbarten Dorf, war nur wenige Jahre nach der Vollendung des Borobodur am Anfang des 10. Jahrhunderts von der hinduistischen Mataram Dynastie errichtet worden. Shivas Schatten lag damals über Java, und er sollte sich als so umfassend erweisen, dass er selbst den Mahayana Buddhismus in sich aufnehmen konnte. Die hinduistische Gegenreformation, der es im 8. und 9. Jahrhundert im indischen Mutterland gelungen war, den Mahayana-Buddhismus fast vollständig in sich aufzusaugen, hatte auch in Java über den Buddhismus obsiegt.
Mit der Vermischung der Religionen ist es ein merkwürdiges Ding. Meist vollzieht sich die Verdrängung der einen durch die andere als ein brachialer, gewalttätiger Prozess. So haben die Christen, als sie das muslimische Cordoba eroberten, ihre Kathedrale mitten in die Mesquita hineingebaut. Die Moslems ihrerseits haben die Kathedrale von Nikosia mit Minaretten für alle sichtbar in eine Moschee verwandelt. In Java war der Übergang gleitend gewesen. Die unzähligen Buddhas und Bodhisattwas des Mahayana Buddhismus und die farbenfrohe Vielfalt des hinduistischen Pantheons waren an den Wänden von Borobodur und Prambanan kaum unterscheidbar. Einen größeren Gegensatz zum Islam konnte man sich kaum vorstellen.
Am Ende blieb dem Prambanan das Schicksal aller javanischen Tempel nicht erspart. Im Laufe der Jahrhunderte wurde er überwuchert und durch Vulkanausbrüche beschädigt. Nach dem Sieg des Islams in Java diente die verfallene Anlage zeitweise als Steinbruch. Erst im 19. Jahrhundert, als überall in der Welt die vormodernen Tempel dem Vergessen entrissen wurden, hatte man damit begonnen, den Prambanan ebenso wie den Borobodur mit enormem Arbeitsaufwand wiederzustellen. Seit 1953, dem Abschluss der Renovierungsarbeiten, erhob sich die prachtvolle Anlage wieder im alten Glanz – in ihrer Harmonie von Natur und Kunst auch in dieser Hinsicht dem Borobodur vergleichbar.