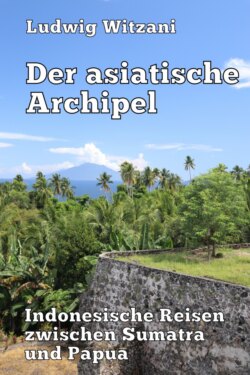Читать книгу Der asiatische Archipel - Ludwig Witzani - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Tod auf Java Kleiner Versuch über das Heimweh
ОглавлениеAm Nachmittag kam Rike ins Guesthouse zurück und heulte. Der Flug nach Jakarta war gecancelt worden, was bedeutete, dass sie auch ihren Langflug von Jakarta nach Frankfurt verpassen würde. Die mit Freude im Herzen erwartete Heimkehr nach Europa würde sich auf unbestimmte Zeit verschieben. Dabei hatte sie sich doch so gefreut, ihren kleinen Bruder wiederzusehen. Den ganzen Nachmittag weinte sie in ihrem Zimmer, dann rief sie über ihr Handy zuhause an und jammerte weiter, bis ihr Guthaben aufgebraucht war. Sie hatte einen regelrechten Heimwehkoller und beruhigte sich erst wieder, als ihr Sam aus seinen Whiskeyvorräten einen kräftigen Schluck einschenkte.
Heimweh unter Travellern ist nichts, worüber man spricht, auch wenn es jeder kennt. Während man mit seinem Fernweh hausieren geht, kehrt man seine Heimwehanfälle gerne unter den Teppich. Heimweh ist etwas für Looser, Luschen, Weicheier, jedenfalls nichts, mit dem man durch Asien reisen sollte. Und wenn es einen denn erwischt, dann soll man die Klappe halten und weiterreisen. Ortsveränderung ist gut gegen Heimweh, wer wüsste das nicht.
Heimwehkranke habe ich auf Reisen schon oft getroffen, auch wenn die Äußerungsformen unterschiedlich waren. Bei einem jungen Inder, den ich an den Quellen des Ganges kennenlernte, zeigte sich das Heimweh in extremen Einsamkeitsgefühlen. Er lief mir den ganzen Tag hinterher, weil er es nicht ertragen konnte, alleine zu sein. Auf den Reisfeldern in Nordluzzon war mir ein Schwede begegnet, der mir stundenlang von seiner Freundin erzählte. Sein Heimweh besaß die Gestalt des Liebeskummers und äußerte sich in aufdringlichem Mitteilungsdrang.
Allen Erscheinungsformen des Heimwehs gemeinsam ist die Sehnsucht nach Rückkehr in die vertraute Umgebung, nach den Menschen, Orten, Speisen und den Gewohnheiten, mit denen man aufgewachsen ist – kurz: nach der „Heimat“ Diese Befindlichkeit macht sich ähnlich wie Angst bemerkbar: sie ist beklemmend und quälend und hat wie jeder Schmerz die Eigenschaft, die Zeit ins Unendliche zu dehnen.
Heimweh als Begriff ist übrigens gar nicht so alt, wie man meinen könnte. Im 17. Jahrhundert wurde der Sachverhalt zum ersten Mal erwähnt und als „Schweizer Krankheit“ beschrieben“, weil man an den schweizer Landsknechten, die über Jahre hinweg im Dienst des Papstes in Rom standen, ein Übermaß an Melancholie und Traurigkeit festgestellt hatte. Diese Beschwerden verschwanden, sobald die Landsknechte in ihre Heimat zurückkehrten. Der Schweizer Arzt Johannes Hofer prägte für diese Sehnsucht nach Heimat im Jahre 1688 den Begriff „Nostalgie“ („Rückkehrschmerz“). Später wurde der Begriff wortgleich ins Italienische und Spanische übernommen beziehungsweise übersetzt: als „Heimweh“ im Deutschen, „homesickness“ im Englischen oder „mal du pays“ im Französischen“.
Nach meiner Erfahrung ist das Heimweh jedoch auch eine hochgradig variable Empfindung, das heißt, Menschen unterscheiden sich ganz erheblich darin, wie anfällig sie für Heimweh sind. Ob die Heimwehanfälligkeit als Persönlichkeitsvariable die Form einer Gaus´schen Normalverteilung hat, weiß ich nicht, mir erscheint es eher so, als gäbe es im Hinblick auf das Heimweh drei deutlich unterscheidbare Gruppen: die Heimweh-Resistenten, die Heimweh-Normalos und die Heimweh-Anfälligen. Ein typischer Heimweh-Resistenter, jedenfalls soweit man das erkennen konnte, war Sam. Er war schon seit Jahren in Asien auf Achse, und nichts deutete darauf hin, dass ihm irgendetwas fehlen würde. Von seiner Sorte hatte ich Dutzende in Indien getroffen, selbstgenügsame menschliche Monaden, die wie Fettaugen auf der Suppe des Lebens schwammen und meist zufrieden damit waren, wohin sie der Zufall trieb. Ehrlich gesagt, waren mir diese Gestalten immer ein Rätsel geblieben. Vielleicht fehlte ihnen ein Gen, vergleichbar einem Farbenblinden, der auch bestimmte Farbnuancen nicht erkennen kann.
Ich selbst betrachte mich eher als „Heiweh-Normalo“. Mein Bedürfnis nach Fremdheit ist groß, aber nicht unendlich, und wenn es gestillt ist, entsteht in mir eine zunächst kaum wahrnehmbare, dann immer deutlichere Sehnsucht nach Zuhause. Wahrscheinlich wirkt das Neue und das Fremde bei den meisten Menschen zunächst mitreißend, dann interessant und schließlich, wenn man nur lange genug unterwegs gewesen war, nur noch anästhesierend gegenüber einem immer drängender hervortretenden Wunsch nach Heimkehr – bis auch diese Wirkung nachlässt und man sich um das Rückflugticket bemüht.
Rike war zweifellos eine typische „Heimweh-Anfällige“. Man konnte an ihr einen paradoxen Zug beobachten, der mir an Heimweh-Anfälligen schon oft aufgefallen war: ein demonstrativ vor sich hergetragenes Fernweh, das wie eine Beweis dafür benutzt wurde, dass man in Wahrheit mit Heimweh überhaupt nichts am Hut hat. Die Reisen dieser Heimweh-Anfälligen besitzen also eine kompensatorische Motivation, sie gleichen der Weltexplorierung von Kleinkindern, die mit klopfenden Herzen Wohnung und Garten erkunden, ohne die Mutter jemals aus den Augen zu verlieren. Wenn solche Personen dann aber wirklich einmal in Situationen geraten, in denen ihnen die Erlösung vom Heimweh, die Heimkehr, verwehrt wird, reagieren sie hilflos. Wie Max Dauthendey, der bekannteste Heimweh-Anfällige der weltweiten Reiseliteratur, der in Java an Heimweh elend zugrunde ging.
***
Max Dauthendey (1867-1918) war ein extravertierter naturalistisch-impressionistisch veranlagter Autor der Belle Epoche, der kurz nach der Jahrhundertwende Theaterstücke, Novellen und Romane mit einem gewissen Erfolg veröffentlichte. Seine Gedichte wurden von Stefan George gelobt, seine Novellensammlungen „Lingam“ und “Die acht Gesichter vom Biwasee“ werden noch heute gelesen. Trotzdem kämpfte er Zeit seines Lebens mit finanziellen Schwierigkeiten, vor allem, nachdem er das väterliche Erbe durchgebracht hatte (unter anderem durch den Plan einer Kommunegründung in Mexiko, der sofort nach der Ankunft fallengelassen worden war). Wie viele Künstler seiner Zeit war er der Meinung, dass es die vornehmste Pflicht seiner Mitbürger sei, ihn und seinesgleichen materiell so hinreichend zu versorgen, dass sie, die Künstler, ihren Dienst an der Menschheit unbeeinträchtigt weiterführen konnten.
Das ungefähr war der Hintergrund von Max Dauthendeys zweiter Südseereise, von der er sich neue Anregungen für seine literarische Produktion versprach. Für die Kosten dieser Weltreise kamen sein Verlag und die Reederei auf, eine bescheidene frei verfügbare Reisekasse hatte sich Dauthendey vorher zusammengeliehen.
Ende April 1914 reiste Dauthendey von Würzburg zum Mittelmeer und schiffte sich in Genua auf dem Dampfer „Goeben“ ein. Erfreut lauschte Dauthendey dem Kapitän, der enthusiastisch die Schönheiten der Südsee lobte. „Man sei abwechselnd in die Steinzeit, gerade in die Urwelt versetzt und dann wieder in der Kultur. Es ist gerade das, was ich so sehnsüchtig suche, ein wenig paradiesische Urwelt ohne Kultur“ berichtete Dauthendey am 30.4.1914 in einem Brief an seine Frau Annie Dauthendey.
Schon am Ende der ersten Maiwoche durchquerte die „Goeben“ den Suezkanal, am 14. Mai beschrieb Dauthendey seiner Frau die Reiseeindrücke aus Colombo („schwüle, dunstige , schwere Luft aus den laubreichen großen Bäumen.“). Dann erreichte die Goeben in der letzten Maiwoche die große Insel Java, das Herz von „Niederländisch-Ostindien“. Dauthendey gab sich weiter wie ein Feinschmecker, der die Reize der Tropen kostete, er schilderte die Schönheiten der Reisfelder, die Klarheit der Luft nach dem Regen und die pittoreske Absonderlichkeit der Menschen.
Doch schon kurz nach der Ankunft in Java bedrängen ihn böse Vorahnungen. “Mein Boy in Bavaria im Hotel hatte die Nummer 13“, schrieb Dauthendey an seine Frau. „Mein Touristenbillet hat Nummer 13. Auf der Herreise im Schiff war auch alles 13.“
Man sieht: Dauthendey war leicht entflammbar und ebenso enttäuschungsbereit. Im Grunde war er ängstlich, zögerlich und sprunghaft. Deswegen kamen ihm schon bald Zweifel an der Sinnhaftigkeit seiner Reise, die er in seinen Briefen immer deutlicher zur Sprache brachte. Die Finanzen bereiteten ihm Kopfschmerzen, dann ereignete sich ein Erdbeben, „bei dem mein Eisenbett mit mir oben im Gebirge rasselnd durchs Zimmer tanzte.“ (11.6.1914). Schließlich verkündet er brieflich seine vorzeitige Rückkehr, nur um sich über Nacht dann doch wieder eines anderen zu besinnen. In einem kurzen Zusatz vermerkt er am 12. Juni: “Ich reise nun doch nach Neu-Guinea weiter und komme erst im Herbst (September) nach Europa.“
In der zweiten Junihäfte und im Juli hält sich Dauthendey in Papua-Neuguinea auf und ist nicht begeistert, über das, was er sieht. „Außer Menschenfresserdörfern gibt es hier nichts“, bemerkt er trocken in einem Brief am 30.6.1914.
Zwei Tage vorher hatten serbische Terroristen den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau in Sarajewo ermordet. Davon wusste zu dieser Zeit noch niemand etwas im fernen Osten.
Dann aber drangen die Weltnachrichten doch durch und zeigten drastische Folgen. „Ich war auf dem Rückweg von Neuguinea nach Java begriffen, als der Krieg uns am 6. August überraschte“, schrieb Dauthendey am 23. August 1914 an Jenny und Arnold Villinger. Obwohl die Reisegesellschaft zeitweise auf den Molukken festgesetzt wurde, gab sich Dauthendey in seinen Briefen souverän und tat so, als ginge das normale Leben weiter. „Ambonia liegt sehr schön auf einer hügeligen Insel“, schrieb er am 23. Augst 1914. „Wir ankern in einer großen Bucht. Es sind schöne Spazierwege an Land. Der Ort ist nur klein, wie eine liebenswürdige Gartenstadt unter Palmen sieht er aus. Es sind zwei Moscheen und zwei Holzkirchen da, und alle Häuser sind hell und haben nur Erdgeschoss und eine Veranda rundum und liegen in Gärten, die mit gelben und purpurnen Blätterbüschen lebhaft in der Sonne leuchten.“ (ebenda)
Solche beschreibenden Passagen, in denen sich der Weltreisende Max Dauthendey demonstrativ über sein zagendes Herz erhebt und ganz Geist, ganz Auge wird, sollten bald seltener werden. Sie repräsentieren die erste Phase des Heimwehs, eine sich selbst betrügende Verdrängung, die sich darin gefiel, die Details der Exotik scheinbar wie ein Geist zu notieren, der über den Dingen schwebte.
Nach einigen Wochen musste Dauthendey die Molukken verlassen. Zu seinem Verdruss wurde er auf der Überfahrt nach Sumatra im September 1914 von holländischen Offizieren schwer angegiftet. Auch das Wetter ging ihm auf die Nerven. „Es ist Regenzeit jetzt auf Sumatra. Und es regnet täglich jetzt grauer und schwerer als es in den Regensommern im Gutenberger Wald geregnet hat. Die Luft ist dabei beengend heiß und feucht,“ notierte Dauthendey am 30.9.2014.
Dauthendey wartete weiter, besuchte das „Tobameer“ (den Tobasee in der Nähe von Medan in Nordsumatra), delektierte sich an den schönen Javanerinnen und versuchte sich abzulenken, so gut es ging. „Ich kann mit den Schwalben reden und mit den Vögeln und allen Dingen. Ich gehe in die Dörfer zu den Battakern, die noch vor zehn Jahren Menschenfresser waren, und spiele mit ihnen Schach“, berichtete Dauthendey seiner Frau im Herbst 1914.
Wie es ihm wirklich ging, erfährt man in seinem Tagebuch. „Die gefährlichsten Stunden sind die, wenn die Sterne heranrücken. Die großen, blauen Sterne, die aus dem warmen Himmel herabsteigen, in die Menschenaugen, ins Menschenblut. Dann reden die Sterne alles, was man sich selbst verschweigen möchte. Sie sehen einen tiefer an als Menschenaugen. Man muss unter ihrem ewigen Licht zittern, mit allem Ewigen, was am Tag versteckt vor der Vernunft geruht hat, zittert man und wird erregt, und wer nicht vom Malariaschüttelfrost im Aderwerk eiskalt getroffen wird, wird noch fiebriger, vom Heimweh heiß und kalt durchschauert.“ Dann, nur wenige Zeilen später wird er noch deutlicher: „Oh, in diesen Abendstunden, untätig ins Dunkle gerichtet, voll Willenlosigkeit, voll vom Erwachen des Unbekannten im heranwachsenden Finstern in diesen weiten, unendlich weit ausholenden Stunden bin ich machtlos mich zu beherrschen und mein Heimweh zu verstecken. Die Brust weint mir. Die Zeitung zittert in meinen Fingern.“ Dauthendey spürte erschrocken, wie sich seine Befindlichkeit verändert und fügt hinzu „Es ist ein gefährlicher Überschwang ins Gefühl gekommen. Ungesund, verzehrend wie Malaria, singend fein und blutsaugend wie das Meer der Moskitos, die im Dunkeln schwärmen.“ (15.1.1915).
Dabei war das Schicksal, dass Dauthenday ereilte ja beileibe nichts Ungewöhnliches. Zehntausende wurden in den Kriegen des Zwanzigsten Jahrhunderts an der Heimreise gehindert und unter oft erheblich härteren Bedingungen als die Dauthendey interniert. Fast vier Jahre saß Heinrich Harrer in einem indischen Gefangenenlager, ehe ihm die Flucht nach Tibet gelang. Fünf Jahre wurde der Orientalist Hans Overbeck während des Ersten Weltkrieges in Australien gefangen gehalten (Im Zweiten Weltkrieg sollte er auf einem holländischen Gefangenentransport vor Sumatra umkommen). Doch in Dauthendeys Fall hatte das Heimweh einen extrem Heimweh-Anfälligen erwischt, dessen Abwehrverhalten langsam zusammenbrach. Denn alle Versuche, selbst hochgestellter Persönlichkeiten bei der holländischen Regierung, Dauthendeys Ausreise zu ermöglichen, waren fehlgeschlagen.
Im Februar 1915 verlässt Dauthendey Sumatra und siedelt nach Java über. Er lebt nun in Goroet nahe Bandung auf halber Stecke zwischen Jakarta und Yogyakarta. Sein körperliches Befinden beginnt sich zu verschlechtern. Dauthendey bekommt Malaria, schwitzt, friert leidet, kommt wieder zu Kräften und bekommt erneut Malaria. Er nimmt so stark ab, dass Bekannte aus der deutschen Gesellschaft in Sumatra erschrecken, als sie ihm nach einer gewissen Zeit wieder begegnen. „Nun muss ich alle meine Anzüge enger machen lassen“, schreibt Dauthendey am 12.2.15. „Sie hängen an mir wie leere Säcke.“
Doch Dauthendey wehrt sich und begegnet der aufkeimenden Anomie mit Artifizierung, das heißt, er versucht, seinen Kummer sprachlich zu gestalten. Dabei gelingen ihm bemerkenswerte, nicht unwitzige Passagen, aus denen er Trost schöpft. „Gäbe es ein Kreuz erster Klasse für Liebe und Treue“, schreibt er am 21. März 1915 an seine Frau, „müssten du und ich es doch sicher zuerst bekommen. Ich bin so keusch wie ein reiner Mönch. Mein Gesicht im Spiegel sieht mich ganz vergeistigt an. Ich habe asketische Schatten unter den Augen. Schatten der Gedanken an dich, Schatten der Sehnsucht, die mich täglich mit übersinnlichem Licht durchleuchtet. Ich glaube, bald leuchte ich im Dunkeln wie der sehnsüchtige Mond.“ Jeder, der einmal mit Kummer im Herzen versucht hat, sich selbst durch die sprachliche Darstellung dieses Kummers Linderung zu verschaffen, spürt in diesen Zeilen Dauthendeys Kampf gegen den Schmerz mit den Mitteln der Literarisierung. Und er setzt gleich noch einen drauf, in dem er fortfährt: „Ich bin aber doch stolz auf diese Ausdauer, die mir ganz selbstverständlich vorkommt, die ich gar nicht erzwinge, weil ich dich liebe. Man sagt, dass Leichnahme von Heiligen wohlriechend sind. Wenn ich jetzt sterben würde, müsste ich einen solchen Blumenduft verbreiten, dass du es über den Äquator bis hin zur Eiszone in Stockholm riechen müsstest.“ Das hat was und macht noch aus dem Abstand von einhundert Jahren schmunzeln, selbst wenn man den Schmerz ahnt, der hinter diesen Worten steckt. Ganz ähnlich ergeht es dem Leser mit Dauthendeys humoristischen Betrachtungen über die „Menschenfresser“. Am 20.4.1915 schreibt Dauthendey in einem Brief an Wilhelm Panzerbieter: „Die Menschenfresser erzählen sich auch, dass die Handfläche der Menschen, wenn diese älter sind, am besten schmeckt. Am besten schmeckt die linke Handfläche, weil der Battakermann damit zeitlebens das Gemüse isst. Mit der rechten isst er den Reis. Vom Gemüseangreifen wird nun die linke Handfläche mit der Zeit würzig und schmeckt besser als die fade rechte Hand.“ Ein Leidender als sprachlicher Impressario seiner selbst.
Bald aber werden diese Artifizierungen seltener, Dauthendeys Klagen verlieren das Dichterische und erhalten etwas Jammerndes. Die Krankheiten in der Ausländerkolonie verängstigen ihn, ein schreiendes Kind nervt ihn. Dauthendey spürt, wie der Boden unter seinen Füßen wankt, und er versucht, durch eine strenge Tageseinteilung seine persönliche Stabilität wiederzugewinnen. In einem Brief an seine Frau vom April 1915 schildert er seinen typischen Tagesablauf. Der Tag beginnt um sechs Uhr mit einem heißen Bad, danach wird kalt geduscht. Um sieben Uhr wird Frühstück gereicht, dann spaziert Dauthendey über die Hauptstraße von Garoet und versucht sich durch das Beobachten von Chinesen und Javanern abzulenken. Nach dem Mittagessen legt er sich zum Mittagsschlaf nieder, ohne allerdings schlafen zu können. Ab vier Uhr beginnt die Besucherzeit, ehe am frühen Abend das Briefeschreiben an der Reihe ist. Um halb acht zieht sich Dauthendey zum Abendessen um, das um acht Uhr gereicht wird. Spätestens um zehn geht er zu Bett.
Aber diese Selbstdisziplinierung funktioniert immer nur eine begrenzte Zeit, dann bricht sich sein Schmerz Bahn. Immer eruptiver, immer unliterarischer lässt er seine Frau brieflich an seinem Leiden teilhaben. Als Annie Dauthendey ihren Gatten ermahnt, sich zu fassen, antwortet er am 13.7.1915 mit Sentenzen, die an die Gefühle eines verlassenen Kindes erinnern: „Was bin ich denn überhaupt ohne dich? Es fehlt mir doch mein ganzer Lebensinhalt, wenn ich ohne dich hinleben muss. Ich bin dann schwächlich, zittrig, ärmlich, unklar und unsicher in meinen Gedanken und möchte mich scheintot auf ein Bett legen und erst wieder bei dir aufwachen.“ Dann noch direkter:“ Du redest mir in deinem Brief so zu, als wäre es eine göttliche Sünde, wenn ich schwach bin und vor Liebessehnsucht leide.“ Diese Schwäche benötigt eine Erklärung, und so fährt Dauthendey fort. “Der eine Mensch ist nur warm stark, der andere ist kalt stark. Jetzt ist es Mode, kalt stark zu sein, und darum kann mich heute kein Mensch verstehen, und meine Sehnsucht ist in dieser kalten Zeit beinahe eine Beleidigung der kalten Göttin Lebensernst.“ Es folgen unverblümte Beschreibungen seines seelischen und körperlichen Verfalls: “Ich bin mager und verhärmt. Wenn ich meine Hände wasche, ist mir, als fühlte ich die Finger eines Kindes in meiner Hand, so winzig und glattschlank sind die Hände geworden. (…) Nachts lehne ich im Dunkeln fast in jeder Stunde einige Zeit am Geländer meiner Veranda und gehe mit dem Auge um den indischen Sternenhimmel herum. Ich kann so wenig schlafen. Und nachmittags schlafe ich auch nicht mehr.“ Das Reiten habe er auch aufgegeben, „weil alles, was man allein tut, nicht schmeckt“
Im nächsten Brief heißt es: „Ich gehe eines Tages an einem Herz- oder Hirnschlag hier zugrunde vor ewiger innerer Aufregung. Ich ertrage es keinen Winter mehr, glaube ich.“ Wenige Zeilen später: „Ich halte den Druck nicht mehr aus. Es ist zu lange Zeit. Ich bin nicht nur von dir, sondern auch von meinem Klima, meiner Sprache, von meiner Heimat, von allen Erinnerungen, die ein Dichter braucht, und auch von meinen Gräbern getrennt.“
Im September 1915 erreicht die Klage ihren Höhepunkt: „Herz, ein Hund darf schreien, wenn es dunkel wird, siehst du, und ich, ich darf es nicht“, jammert Dauthendey „Meine Brust ist so gepresst vor Heimweh. Es ist jetzt abends halb zehn Uhr, und ich bin wie immer, wie jeden Abend, auf meiner Veranda so allein, so allein.(…) Annie, alle Glieder schmerzen mir in dieser Abendstunde vor Sehnsucht. Es ist ein richtiger Blutschmerz im ganzen Oberkörper. Ich fühle meine Brust so gespannt, als ob sie zerreißen wollte.“
Es folgen Briefe, in denen er sich an seiner eigenen Treue berauscht „Ich will, dass du meine Treue zu dir auch im klaren Licht sehen sollst“, schreibt er seiner Frau am 28.2. 1916. Eigentlich aber sei es ja keine richtige Treue, weil Annie sein „Apfel“ sei, dem demgegenüber die kümmerlichen weiblichen „Kirschen“ vor Ort keinerlei Reiz ausübten. Im Dezember 1915 schildert er seiner Frau in allen Einzelheiten wie er den Avancen einer in ihn verliebten „Frau K.“ widersteht.
Inzwischen scheiterten weiterhin alle Versuche, Java zu verlassen. Einmal befand sich Dauthendey bereits zehn Stunden an Bord eines Dampfers, der ihn nach Amerika bringen sollte, doch dann musste er doch wieder herunter, am 23.12.16 misslingt ein weiterer Versuch. Die Malaria-Anfälle nehmen zu, die Entkräftung schreitet fort, ebenso die seelische Verwüstung. Als im Frühjahr 1917 die USA in den Krieg eintreten und somit eine Flucht über den Pazifik unmöglich wird, erreicht seine Stimmung einen neuen Tiefpunkt. „Ich habe ein Brett vor der Brust, ein Brett im Magen, ein Brett im Kopf vor Einsamkeit, vor Qual, vor Sehnsucht.“ Auch seine intellektuelle Urteilsfähigkeit wankt. Er gibt sich ganz dem Jammern hin und verliert den kritischen Blick für das, was er schreibt. Er verfasst in einer Art „Schaffensrausch“ „Das Lied vom inneren Auge“ und urteilt: „Es ist glaube ich, das größte Lied, das seit langer Zeit für die Menschheit geschrieben wurde (8.4.17).
Mittlerweile ist sein körperlicher Zustand besorgniserregend. An seine Frau schreibt er am 8.4. 1917: „Der Arzt sagte mir, bei jeder leichten Erkältung und jeder Überanstrengung, bei jeder seelischen Aufregung bricht die Malaria aus, wenn sie einmal einen Bazillenherd im Körper gebildet hat. Die Herde sind Entzündungen der Milz, die sich dann durchs Blut fortpflanzen und Fieber erzeugen.“ Fast mit einem letzten Schuss Galgenhumor fügt er hinzu. „Aber mach dir keine Sorge, es ist ganz gleich, ich leide nicht mehr, ob ich krank bin oder gesund bin, ich leide immer gleichmäßig an Heimweh. Das ist ein viel stärkeres Leid als die stärkste Malaria.“
Liest man diesen Briefwechsel nicht ohne Bewegung, wundert man sich, dass es nicht schon früher geschah, aber dann ist es soweit. Am 30.6.1917 überkommt den Freigeist Max Dauthendey im Zenit seiner Heimwehagonie ein persönliches Gotteserlebnis. „Es ist ein großes Wunder geschehen“ notiert er am 30.6.1917. „Ich habe erkannt, dass es einen persönlichen Gott gibt. Die Erkenntnis kam mir, nachdem ich in den letzten Tagen öfter die Psalmen gelesen. Heute las ich den fünfzigsten und den sechzigsten Psalm in meiner Bibel. Und auf einmal stand die Erkenntnis des persönlichen Gottes stark und greifbar vor mir. Wohl dreißig Jahre habe ich hin und her erwogen, nachgegrübelt, die Natur und mich selbst beobachtet und den persönlichen Gott erkennen wollen. Konnte ihn aber nicht glauben. Wie wunderbar überzeugt bin ich nun. In wenigen Wochen bin ich fünfzig Jahre alt. Dies ist mein schönstes Festgeschenk.“ Unwillkürlich fühlt man sich an Gotteserlebnisse wie bei Saulus oder Augustinus erinnert, doch dieser Vergleich zieht nicht. Denn das sogenannte Gotteserlebnis gibt Dauthendey keinerlei Kraft, es ist eine hysterische Einbildung ohne Substanz. Sein körperlicher Verfall schreitet fort, so dass er noch nicht einmal die Kraft besitzt, an seiner eigenen Geburtstagsfeier teilzunehmen.
Im August 1918 wird der Gelenkrheumatismus so schlimm, dass Dauthendey vor Schmerzen schreit. Die Tropen und das seelische Darben haben seine Knochen morsch gemacht. Die Malaria hat seinen Körper vergiftet. Ein Öffnen der Gallenblase bringt keine Linderung. Am 29.8 1918, zwei Monate vor dem Ende des Weltkrieges stirbt Max Dauthendey. Seine Frau Annie Dauthendey sollte ihn um 28 Jahre überleben. Sie fand ihren Tod im Dresdener Feuersturm im Februar 1945.