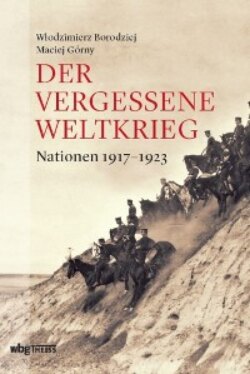Читать книгу Der vergessene Weltkrieg - Maciej Górny - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Eidkrise
ОглавлениеDie plötzliche Verwandlung von Freunden in Feinde war mitunter weniger dramatisch als die Fronterlebnisse der an der Seite der demokratisierten russischen Armee kämpfenden Polen, Tschechen, Slowaken und Rumänen. In dem eher auf Papier denn in Wirklichkeit vorhandenen Königreich Polen riet Józef Piłsudski den ihm ergebenen Soldaten und Offizieren der Polnischen Legionen genau eine Woche nach der Schlacht von Zborów, den Eid und damit den Eintritt in die polnische Wehrmacht zu verweigern. Diese Entscheidung war politisch motiviert, die Eidesformel selbst verletzte die patriotischen Gefühle der Polen nicht. Sie lautete:
Ich schwöre zu Gott dem Allmächtigen, daß ich meinem Vaterlande, dem Königreich Polen, und meinem künftigen König zu Wasser und zu Lande und an welchem Orte immer es sei, getreu und redlich dienen, im gegenwärtigen Kriege treue Waffenbrüderschaft mit den Heeren Deutschlands und Ö.-U.’s und der ihnen verbündeten Staaten halten, allen meinen Führern und Vorgesetzten gehorchen, die mir gegebenen Befehle und Vorschriften befolgen und mich so betragen will, daß ich als tapferer und rechtschaffener polnischer Soldat leben und sterben kann. So wahr mir Gott helfe. Amen.71
Angesichts dessen, dass die Legionäre schon eine ähnliche Zeremonie hinter sich hatten, bei der sie – ohne große Begeisterung – geschworen hatten, ihr Leben zu Lande, zu Wasser und in der Luft für Franz Joseph I. hinzugeben, ist nicht leicht verständlich, wo das Problem lag. Piłsudskis Anhänger betonten drei Punkte: den unklaren Adressaten des Eides, die Verpflichtung zur Waffenbrüderschaft mit den Verbündeten sowie die Tatsache, dass der Eid nur die ehemals dem Zaren untertänigen Polen betraf. Keiner dieser Einwände hielt einer sachlichen Kritik stand. Die Logik gebot es, anzunehmen, dass das Königreich Polen einst einen König haben würde und dass seine Streitkräfte diesem Herrscher zur Treue verpflichtet sein würden. Die Verpflichtung auf das de facto bestehende Bündnis mit den Zentralmächten für die Dauer des Krieges wirkte wie ein eher verzweifelter Versuch, einen Rest von Kontrolle über die künftige polnische Armee zu behalten. Die Forderung, der Eid müsse auch die polnischen Untertanen des Deutschen Reichs und der k. u. k. Monarchie einschließen, war schlicht verfrüht, weil erst nach Festlegung der endgültigen territorialen Gestalt des künftigen polnischen Staates erfüllbar.
Die Eidkrise resultierte also nicht aus einem wirklichen Konflikt um den Inhalt des Schwurs, sondern – wie sich zeigen sollte – aus der wohlkalkulierten Entscheidung Piłsudskis, der die bis dahin bestehenden Bindungen zu den Zentralmächten lockern und dann ganz kappen wollte. Diesen Schritt war nicht für jeden verständlich. Iza Moszczeńska, die Gründerin der piłsudskifreundlichen Frauenliga des Kriegsnotdienstes (Liga Kobiet Pogotowia Wojennego), unterstellte Piłsudski übertriebenen persönlichen Ehrgeiz und Desinteresse am Schicksal der Menschen, die ihm vertrauten:
Postkarte, deren Verkaufserlös für die Unterstützung internierter Legionäre bestimmt war.
All diesen Opfern Ihrer rätselhaften Politik, deren Geheimnis in Ihrem Gehirn und Gewissen verborgen liegen, schulden Sie eine öffentliche unzweideutige Erklärung.72
Als Folge des Boykotts wurden die Soldaten der 1. und 3. Brigade der Legionen (die meisten Angehörigen der 2. Brigade leisteten den Eid) in verschiedenen Lagern auf dem Gebiet des Königreichs interniert, Piłsudski selbst kam in Magdeburg in Festungshaft. Zuvor tauchten aber zahlreiche Legionäre auf dem Gebiet des Königreichs unter und entgingen so der Festnahme. Letztlich wurden etwa 3000 Personen interniert.
Die Bedingungen in den Lagern in Szczypiorno (für einfache Soldaten) und Beniaminów (für Offiziere) waren schlecht, wenngleich weniger schlecht als die der anderen Gefangenen, die mit ihnen die Baracken teilten. Kazimierz Kierkowski erinnert sich an das Abendessen an Heiligabend 1917: fünf Pellkartoffeln und ein halber Hering.73 Die Polen profitierten von der Hilfe der Frauenliga, zudem blieben die meisten von ihnen in der Nähe ihrer Familien. Das führte dazu, dass trotz vermehrter Diebstähle durch die deutschen Wächter viele Internierte doppelte Rationen erhielten: eine aus der Lagerküche, die zweite aus Paketen. Dass es ihnen vergleichsweise gut ging, merkten sie insbesondere dann, wenn sie mit anderen Gefangenen in Kontakt kamen. Kierkowski fielen vor allem die Russen auf:
Die russischen Gefangenen, junge Männer zwischen 20 und 25 Jahren, sahen wie Greise aus: fahler Teint, eingefallene Augen, die Haut im Gesicht hängt schlaff herunter … Ich habe sie gesehen. Die Ärmsten rissen alles Gras unter dem Draht heraus, in Wasser aufgebrüht und verzehrt! Während Frankreich und England sich an ihre Gefangenen erinnern, sterben die Moskalen vor Hunger wie die Fliegen; niemand kümmert sich um sie, niemand in der Welt weiß, wie der Hungertyphus sie dahinrafft.74
Ein weiterer internierter Legionär, Piotr Górecki, schildert eine ähnliche Szene mit anderen Personen:
Als wir Szczypiorno verließen, wurden wir zufällig Zeugen, wie ausgemergelte rumänische Soldaten, die unseren Platz einnehmen sollten, sich auf den zertrampelten Rasen stürzten und mit den Händen das Gras ausrissen, um damit ihren Hunger zu stillen.75
Etwas anders erging es den österreichischen Untertanen unter den protestierenden Legionären. Ein Teil von ihnen beantragte die Verlegung zu anderen Einheiten, einige Dutzend wurden in Przemyśl inhaftiert, wo sie ihren Prozess erwarteten. Ihre Verteidigung übernahm Herman Lieberman, ein bekannter sozialistischer Politiker. Er machte seine Arbeit so gut, dass alle freigesprochen wurden. Den Rest des Ersten Weltkriegs verbrachten sie in österreichisch-ungarischen Einheiten an der italienischen Front, wo sie von der Teilnahme an größeren Operationen verschont blieben.
Die Krise flaute allmählich ab, als die polnische Politik sich änderte. Nach Brest-Litowsk begannen auf einen informellen Befehl von Edward Rydz-Śmigły ehemalige Legionäre der polnischen Wehrmacht beizutreten. Als sich im November 1918 die Niederlage der Mittelmächte immer deutlicher abzeichnete, erlebte die Formation einen massenhaften Zustrom von Freiwilligen, vor allem von internierten Legionären.
Die symbolische Bedeutung der Eidkrise erwies sich als weitaus wichtiger als ihre messbaren Folgen. Zwar verloren manche Beobachter – wie etwa Moszczeńska – dauerhaft das Vertrauen in Piłsudski, doch insgesamt wuchs seine Popularität. Das neue Gemeinschaftserlebnis stärkte den Zusammenhalt der Legionen und den Glauben an die Unfehlbarkeit ihres Führers. Die Krise war ein wichtiger Abschnitt auf dem Weg vom Legionär zum Piłsudski-Anhänger. Konkrete Resultate erbrachte unterdessen der Dienst der Legionäre, die den Eid ablegten. Obwohl die Soldaten über den sinnlosen Drill und den Mangel an praktischen Übungen klagten, nahmen Offiziere wie Marian Januszajtis und Franciszek Kleeberg an deutschen Spezialisierungskursen teil. Die ehemaligen Legionäre aus dem habsburgischen Galizien wiederum durchliefen als Offiziere und Soldaten des Polnischen Hilfskorps innerhalb der k. u. k. Armee die Ausbildung der Sturmtruppen. Die dort erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten sollten sie bald ganz anders einsetzen, als ihre Ausbilder es wünschten.
Die Kerenski-Offensive endete mit einer Niederlage, deren Konsequenzen weit über das militärische Scheitern hinausreichten. Die pazifistische Revolution war zu tiefgreifend, als dass die russische Armee noch zu größeren Offensivaktionen imstande gewesen wäre. Bald sollte sich zeigen, dass es um ihre Verteidigungsbereitschaft nicht besser bestellt war. Anfang September eroberten die Deutschen in einer Blitzoperation Riga, eine wichtige Industrie- und Hafenstadt, die 1914 fast eine halbe Million Einwohner zählte. Darüber hinaus war die Stadt das letzte ernsthafte Hindernis auf dem Weg nach Petrograd. Statt dort anzugreifen, wo man es erwartete, überquerten die Deutschen die Düna ein gutes Stück oberhalb der Stadt und attackierten die russischen Stellungen von Osten, womit sie auch die meisten Fluchtwege abschnitten. Trotz verzweifeltem Widerstand konnten die lettischen und russischen Verteidiger den Angriff nicht zurückschlagen. Schon am 6. September nahm Wilhelm II. persönlich die Siegesparade ab. Ein gerührter deutscher Bürger erinnert sich:
Zusammenführung deutscher Truppen vor der Besetzung Rigas.
Die alte, urdeutsche Hansastadt wurde wieder deutsch. Der Tag, an dem Kaiser Wilhelm II. in das befreite Riga einzog und die Kaiserparade auf der Esplanade abhielt (6. September 1917), ist allen Bewohnern Rigas und denen, die das erleben durften, unvergeßlich geblieben.76
In den darauffolgenden Wochen führten die Deutschen noch einige lokale Operationen in diesem Abschnitt der Front durch. Danach endeten die Kriegshandlungen. Die Bitten und Petitionen der Baltendeutschen, die die „Befreiung“ der übrigen Teile Lettlands und Estlands verlangten, blieben ungehört. Die Vorbereitungen auf eine neue Offensive im Westen hatten Vorrang.
Zerstörte Brücke über die Düna.
Unterdessen spielten sich in den unter russischer Herrschaft verbliebenen Teilen Lettlands interessante Dinge ab. Unmittelbar nach der Einnahme Rigas durch die Deutschen herrschte Chaos im Land, Flüchtlinge verstopften die Straßen und die zurückweichenden russischen Soldaten plünderten entweder die Bauern oder verübten gemeinsam mit ihnen Akte der „Klassenrache“ an deutschen Grundbesitzern. Die Situation konnte beruhigt werden, als das von den lettischen Bolschewiki kontrollierte Ausführende Komitee der Arbeiter-, Soldaten- und Landlosen-Räte in Lettland (Iskolat) die Macht übernahm. Von der Politik des ersten faktisch unabhängigen lettischen Staates in der Land- und Arbeiterfrage wird an anderer Stelle noch die Rede sein. Hier sei auf die Streitkräfte des Komitees hingewiesen: die lettischen Schützen. Die kampferprobten Soldaten wurden später bekanntlich zur Elite der Roten Armee. Weil die Bolschewiki ihre Macht in Lettland früher als in Russland festigen konnten, leistete das Komitee den Petrograder Genossen im Herbst 1917 militärischen Beistand. Die Legenden um die lettischen Schützen verschleierten die Tatsache, dass die Formation ein Musterbeispiel der Demokratisierung der Armee darstellte. Wie in den russischen Einheiten entschieden die Soldaten in einer Abstimmung über die Teilnahme an einer Schlacht sowie über die Fortsetzung bereits begonnener Operationen. Wie das System in der Praxis funktionierte, zeigt eine Episode aus den Kämpfen zwischen den Bolschewiki und dem I. Polnischen Korps von General Józef Dowbor-Muśnicki Anfang 1918 in der Nähe von Bobruisk. Den zur Unterstützung der Roten Armee eingetroffenen Letten gelang es, durch geschickte Manöver die überlegenen Polen, die den Eisenbahnknoten Rohaczew verteidigten, einzukreisen. Während eines nächtlichen Angriffs mit Beschuss von mehreren Seiten brach die polnische Verteidigung zusammen. Die Schützen machten zahlreiche polnische Gefangene. Am nächsten Tag beriefen die Regimentskommissare eine Versammlung ein, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Die Letten betrachteten ihre Aufgabe mit der Befreiung des Eisenbahnknotens als abgeschlossen. Weitere Kämpfe gegen die Polen hielten sie für unnötig und unerwünscht, denn „die Polen müssen sich, ebenso wie die Letten, organisieren, um für ihre Freiheit zu kämpfen“.77
Bald sollte sich das Schicksal von Polen und Letten erneut verflechten. Während die Kämpfe um Bobruisk noch andauerten, liefen in Brest-Litowsk bereits diplomatische Gespräche zwischen den Mittelmächten und Sowjetrussland. Als die eigenwillige Verhandlungsstrategie der bolschewistischen Delegation zum Abbruch der Gespräche führte, rückten die Deutschen vor. Erstes Opfer der erneuerten Offensive wurde das lettische Iskolat. Angesichts der erdrückenden Übermacht des Feindes entschieden sich die Schützen zum Rückzug nach Russland. Ein Teil von ihnen blieb vor Ort, versteckte sich in den Häusern oder ergab sich den Deutschen. Der Rückzug der anderen wurde zu einer wahren Anabasis, einem Erlebnis, das viele lettische Kommunisten prägte. Ein Teilnehmer erinnert sich:
Als die Offensive der deutschen Besatzer begann, zog sich das 7. Regiment nach dem Fall von Cēsis nach Valka zurück. In Valka forderten manche Schützen Dokumente, die sie vom Dienst befreiten, und machten sich, nachdem sie sie erhalten hatten, auf den Weg nach Hause. Die übrigen waren gegen eine Demobilisierung und beschlossen, sich aus der Einkreisung zu befreien und nach Russland zu gehen. […] Grisko, der Regimentskommandant, sammelte eine Gruppe Schützen um sich, eroberte einige Waggons und eine Lokomotive und brach nach Russland auf. Den Rest des Regiments überließ er seinem Schicksal. Es verschwanden auch fast alle Offiziere, im Hauptquartier blieben nur fünf oder sechs zurück. Mangulis führte das Regiment. Er munterte die Schützen auf, indem er ihnen versicherte, er werde sie aus dem deutschen Angriff herausführen. Alle Einheiten waren bereits auf dem Rückzug, also musste das Regiment trotz schneidender Kälte von 25–28 Grad unter null ohne Pause marschieren. Wir erreichten Pskow, doch in der Zwischenzeit hatten die Deutschen schon die Front durchbrochen und den Bahnhof besetzt. Um durchzuschlüpfen, musste das Regiment den Einbruch der Nacht abwarten. Als es dunkel wurde, wurden Patrouillen ausgesandt, die den Übergang über die Eisenbrücke sicherten und die umliegenden Straßen bewachten, damit das Regiment die Stadt durchqueren konnte. Noch in derselben Nacht legten wir weitere 13 Werst zurück, erst dann machten wir für ein paar Stunden Rast in einem Dorf. Bis dahin waren wir ohne Atempause einige Tage lang marschiert. Von den Bauern erfuhren wir, dass die Deutschen schon den nächsten Bahnhof besetzt hatten und einen Panzerzug besaßen […]. Wir mussten die Gleise vor Tagesanbruch überqueren […]. Nach einigen weiteren Tagen kam wir in Luga an, wo es sicher war. Im Nachbardorf machten wir halt, um uns zu erholen und neu zu organisieren, wozu wir mit dem Oberkommando Kontakt aufnahmen. Aus Leningrad kam der Befehl, wir sollten nach Nowgorod aufbrechen. […] Anfang März traf das Regiment in Nowgorod ein. Es war nicht mehr besonders stark – je 20 bis 30 Männer pro Kompanie.78
Während im Süden der Ostfront die Rumänen vom Verbündeten Russlands zum Besatzer einer seiner Provinzen wurde, vollzog sich im Norden ein ähnlich gravierender Wandel. Die lettischen Schützen, die noch im September Teil der Armee des neuen, demokratischen Russlands waren, spalteten sich auf: Ein Teil der Soldaten verließ die Formation, um wenig später die nationale Armee Lettlands zu verstärken, ein anderer Teil – darunter der Verfasser der oben zitierten Erinnerungen – entschied sich dazu, für den Sieg der Revolution und das kommunistische Paradies in Russland, Lettland und dem Rest der Welt zu kämpfen, während eine dritte Gruppe kriegsmüde war und die Waffen endgültig niederlegen wollte. Wenngleich dieser letzte Wunsch am wenigsten ehrgeizig wirkt, so war doch gerade er am schwersten zu erfüllen.
Fassen wir zusammen: Nach der Kerenski-Offensive beschleunigte sich die Ethnisierung. Unter ihrem Einfluss löste sich die russische Armee praktisch auf; sie war allenfalls noch ein Konglomerat mehr oder weniger starker Einheiten von nationalem oder parteiischem – meist, aber nicht immer, kommunistischem – Charakter. Schon bald sollte dasselbe in anderen Armeen geschehen, wodurch ein großer Teil Ostmitteleuropas zum Schauplatz chaotischer Kämpfe aller gegen alle wurde. Anfang 1918 näherte sich der Krieg der Imperien seinem Ende. Eines von ihnen hörte auf zu existieren, die übrigen richteten ihre Aufmerksamkeit auf andere Fronten, die Deutschen in Frankreich und Belgien, Österreich-Ungarn in Italien. Aus Sicht der deutschen Stabsoffiziere und selbst ihrer pessimistischeren österreichischen Kameraden hätte die Situation im Osten kaum besser sein können. Der Feind war besiegt, die ihn verzehrende „rote Seuche“ war noch nicht auf eigene Armeen übergesprungen. In Brest-Litowsk brachte eine harte Verhandlungsführung den ersehnten Frieden mit dem bolschewistischen Russland, vor allem aber ein Abkommen mit der Ukraine und die Zusage von – dringend benötigten – Nahrungsmittellieferungen.
Gefallene Soldaten in Lettland.
In genau diesem Moment zeigte sich, dass der ethnisch motivierte Zerfall nicht nur die russische Armee betraf. Die Kunde von den Bedingungen des Friedens mit der Ukraine, die das auch von den Polen beanspruchte Cholmer Land erhalten sollte, rief unter den in der Bukowina stationierten Soldaten der 2. Brigade der Legionen wütende Empörung hervor. Der Seelsorger der Einheit erinnert sich:
Der Aschermittwoch brachte uns eine schreckliche Nachricht, die uns traf wie ein Blitz aus einem dicht bewölkten Himmel. Das verräterisch lächelnde Österreich und das brutale Preußen hatten für ukrainisches Getreide den Hajdamaken [d.h. den Ukrainern] unser heldenhaftes Podlachien verkauft und die Wunde am Leib des Königreichs Polen drohte allein durch ihr Vorhandensein an, dass eine weitere Aufteilung der polnischen Gebiete erfolgen könnte, durch die Ostgalizien und Lemberg sich jenseits der polnischen Grenzen befänden. Ha, sei’s drum! Wenn es wirklich so ist, dann ist es die nackte Tatsache eines von den verbündeten Mächten an uns begangenen gemeinen Verrats, der Niedertracht und Gewalt, doch diese Tatsache wird der letzte Verrat sein, den man an uns begeht.79
Während einer Beratung beschlossen die Offiziere der Brigade, aus Protest gegen die Vereinbarungen von Brest-Litowsk auf die russische Seite der Front überzulaufen und sich dann mit dem in Weißrussland stationierten polnischen Korps (das kurz zuvor gegen die lettischen Schützen gekämpft hatte) zusammenzuschließen. Die Legionäre plünderten die Armeelager in Kolomea. Der Übertritt erfolgte im Schutz der Nacht vom 15. auf den 16. Februar 1918. Die vorsichtig marschierenden Polen trafen zunächst auf eine Autopatrouille, die sie gefangen nahmen. Kurz darauf traten ihnen Soldaten des 53. Infanterieregiments entgegen, die von einem Panzerzug unterstützt wurden. Es entspann sich ein Kampf, in dem beide Seiten deutliche Verluste erlitten. Ein Teilnehmer, Marian Kantor-Mirski, schildert das Scharmützel in für die Legionäre typischem Stil:
Jemand schrie einmal und noch einmal:
– Halt!
Als Antwort feuerte Boruta-Spiechowicz seinen Browning ab und der österreichische Offizier fiel tot zu Boden. Orlik-Łukowski eilte ihm zu Hilfe, er schoss dem zweiten österreichischen Offizier mitten ins Maul, den dritten erledigte Unterleutnant Mierzejewski. […] Als Antwort bellten beiderseits der Straße die österreichischen MGs los, wie auf eine Trommel hämmerten sie auf die dichten Reihen ein. Es gab viele Tote. […] Dann ratterten unsere Gewehre und MGs los, und zwar so verbissen, dass sie zwei Bataillone des 53. österreichischen Regiments zerschlugen. Dem dritten, von Rarancze her anrückenden Bataillon erging es noch schlechter – es wurde von den MGs des III. Bataillons des 2. Infanterieregiments niedergemäht.
Letztlich gelang es rund 1600 Legionären, sich durch die Stacheldrahtverhaue in die verlassenen russischen Schützengräben durchzuschlagen. Der verbissene Kampf dauerte mehrere Stunden. Führt man sich die Ursache vor Augen – die Verbitterung über die Entscheidungen Wiens –, so erkennt man unschwer die Tragik der Ereignisse. Gegner der Legionäre bei Rarancze waren nämlich weder die Wiener Entscheidungsträger noch die Deutsch-Österreicher, sondern Kroaten, für die der Anlass dieses Konflikts völlig unverständlich war. Diese Tatsache wird in vielen Berichten über die Kämpfe bei Rarancze übergangen. Kantor-Mirski hingegen schildert eine Episode, die möglicherweise auf Fakten beruht, in den Details aber wenig wahrscheinlich wirkt. Vielleicht fiel die endgültige Aufkündigung der Loyalität gegenüber der k. u. k. Armee nicht allen Legionären so leicht, wie sie behaupteten …
In einem bestimmten Moment, als die Österreicher [sic] die Chaussee mit Kugeln überfluteten, warfen wir uns in die Straßengräben, in denen viele verwundete Kroaten [sic] lagen. Die Kugeln pfiffen auch durch die Gräben. Ich warf mich zu Boden und verbarg den Kopf hinter einer Leiche. Da bewegte sich diese Leiche, ich sah, wie er die Augen aufriss und sagte:
– Nem muska … keine Moskalen!
Obwohl es nicht der rechte Ort für Konversation war, forschte ich den Verwundeten auf Deutsch aus und erfuhr, dass die österreichischen Offiziere ihren Kroaten gesagt hatten, sie zögen ins Feld, um größere Einheiten russischer Gefangener aufzuhalten und festzunehmen, die den Kordon durchstoßen wollten. Mit letzter Kraft sagte der schwerverwundete arme Kerl:
– Hätten wir gewusst, dass es Legionäre sind, hätten wir nicht geschossen.
Das waren seine letzten Worte. Kurz darauf starb er.80
Die Einheit der multiethnischen Armeen war bereits viele Monate zuvor verloren gegangen.