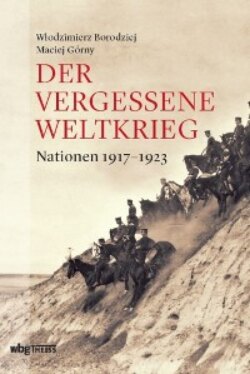Читать книгу Der vergessene Weltkrieg - Maciej Górny - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Estland
ОглавлениеIn Reval, das bald zu Tallinn werden sollte, wurde der Ausbruch der Februarrevolution wie andernorts auch freudig begrüßt.10 Die estnische Postbeamtin Marta Sillaots erinnert sich an die Begeisterung:
All die Umzüge, Demonstrationen und roten Banner, die Tallinn im Winter und Frühjahr 1917 sah! Diese improvisierten Meetings, die es an jeder Straßenecke gab! […] All die Dispute, die ständig organisiert wurden! […] Die Russen mit ihrem Redevirus steckten die Esten an, die Redebeiträge hatten kein Ende. Wenn […] ein Matrose und ein Soldat, oder ein Soldat und ein estnischer Arbeiter Meinungsverschiedenheiten hatten, dann stieg derjenige der Streitenden, der besser mit Worten umgehen konnte, auf eine Treppenstufe, hob sich auf einen Laternenposten oder sprang auf einen Lastwagen – und schon war das Meeting im Gange, die Zuhörer sammelten sich in Trauben um den Redner, man rief „richtig“ und „hurra!“, manchmal auch „nieder damit!“ und genoss die „Freiheit“ bis zur Besinnungslosigkeit.
Die russischen Beamten, so Sillaots, die „byzantinische Bürokratie“, waren gegen den Sowjet, weil sie die Stimme des Pöbels hörten. Die Ablehnung der estnischen Beamten hatte tiefere Gründe, denn der „tiefrote“ Tallinner Sowjet vertrat in der nationalen Frage denselben Standpunkt wie der Gouverneur und in dieser Frage waren auch die russischen Beamten in Tallinn mit dem Sowjet einer Meinung, deren Gesinnung auch durch das an der Brust getragene rote Band nicht verändert wurde. Wenn es um das Estentum ging, arbeiteten die russischen Beamten mit dem Sowjet Hand in Hand.
Erste verachteten die Esten, für Letztere waren sie Reaktionäre.
[…] das Wort ‚Estland‘ versetzte den Herzen beider einen Stich – keiner wollte etwas vom Recht der Esten hören, im eigenen Heim über die lebenswichtigen Fragen selbst zu entscheiden. Ich werde nie vergessen, mit welchen Blicken mich meine russischen Kolleginnen anschauten, als ich aus Anlass der ersten Sitzung des Maapäev [des estnischen Parlaments] am 1. Juli ein Bändchen in den estnischen Nationalfarben auf der Brust trug; man wagte aber kaum, etwas zu sagen und begnügte sich mit einem Schmunzeln; ‚all dies‘ war ja nach Sicht der Russen nur vorübergehend, diese ‚Unordnung‘ konnte nicht lange dauern – so gab man mir indirekt zu verstehen.11
Marta Sillaots‘ Eindrücke aus dem Jahr 1917 spiegeln die vorrevolutionäre Euphorie und die wachsenden estnisch-russischen Spannungen. Die hungernde, von Flüchtlingen und Soldaten überlaufende Stadt erwartete den Anbruch neuer Zeiten. Die alten Herren hatten nicht mehr viel zu sagen, im Bürgermeisteramt gewann die Stimme der Esten an Gewicht, im Sowjet dominierten Russen und lettische Flüchtlinge. Aber nicht nur sie, es gab auch genug estnische Bolschewiki. Die Bolschewiki versprachen Frieden – und dieses Schlagwort wirkte sowohl auf die estnischen wie auch auf die lokalen russischen Arbeiter. Bei den freien Wahlen zur russischen Konstituante erreichten sie 40 Prozent der Stimmen, fast doppelt so viel wie im Landesdurchschnitt. Der soziale Konflikt und die Hoffnung auf ein besseres Morgen waren untrennbar mit der der nationalen Frage verbunden, nur stand für die eine Seite die soziale, für die andere die nationale Komponente im Vordergrund, wobei sich die Prioritäten je nach Situation auch verschieben konnten.
An der Jahreswende 1917/18 brachen Versorgung und öffentliche Sicherheit endgültig zusammen. Es gab kein Brot mehr, die Überfälle auf Geschäfte häuften sich. Auf dem Land konfiszierten die Bolschewiki den Grundbesitz. Die Bauern waren prinzipiell dafür, doch statt das Land unter ihnen zu verteilen, wollten die Roten hier und jetzt den Sozialismus verwirklichen und gründeten Kolchosen. Sie erklärten die deutschen Grundbesitzer für rechtlos und verhafteten 500 Personen – darunter auch Esten – unter dem Vorwurf der Verschwörung mit dem deutschen Generalstab gegen die Sowjets. Die Auszählung der Wahl zur Konstituante brachen sie ab, als klar wurde, dass sie nicht gewinnen würden.
Ganz andere neue Zeiten brachen mit der deutschen Offensive im Februar an. Die Bolschewiki flohen. Eine Handvoll estnischer Aktivisten – das sogenannte Rettungskomitee, das Konstantin Päts zum Ministerpräsidenten bestimmte – nutzte die Übergangszeit, um die Republik Estland auszurufen. Zwei Tage später marschierten die Deutschen in Tallinn ein. Von einer Republik Estland hatten sie nie gehört und sie wollten auch nichts hören. Ein estnisches Regiment, das der russischen Führung den Gehorsam aufgekündigt und sich – zum öffentlich bekundeten Gefallen Wilhelms II. – auf die deutsche Seite der Front durchgeschlagen hatte, wurde kurz nach dem warmen Empfang aufgelöst.12 Für die neuen Besatzer hieß die Stadt seit je „Reval“ und war Hauptstadt einer der Ostseeprovinzen, in denen seit dem 16. Jahrhundert deutsche Grundbesitzer und Bürger herrschten. Die Rückkehr zu diesem Zustand – der Dominanz von vier Prozent der Bevölkerung über den Rest – war erklärtes Ziel der Besatzungspolitik.
Der Historiker Arved Baron von Taube, in Reval geborener Sohn eines deutschen Junkers, umriss 1959 in einem intelligenten Aufsatz die Perspektiven Estlands unter deutscher Besatzung: Ständestaat, Sozialismus oder demokratischer Nationalstaat.13 Ersteres meinte die Rückkehr zur vormodernen Ordnung mit der Hegemonie einer kleinen deutschen Elite über das sie umgebende Meer ethnisch, sprachlich und kulturell fremder Untertanen. Die zweite Option war der Sieg der Bolschewiki und der Beitritt zum neuen, sozialistischen Russland. Die dritte Variante bestand in der Anerkenntnis der Mehrheit der Esten.
Während der Besatzung 1918 taten die Deutschen alles, um die ohnehin anachronistische erste Option endgültig zu diskreditieren. Sie schafften alles aus dem Land, was sich nur essen ließ. In den Schulen wurde Deutsch zur Pflichtsprache – zwanzig Jahre, nachdem die Russen den Esten mit einer ähnlichen Maßnahme das Russische aufgezwungen hatten. Auch Briefe durften nur noch auf Deutsch geschrieben werden, damit der Zensor sie lesen konnte. Die neuen Herrscher übernahmen alle wichtigeren Ämter, einen Teil übertrugen sie an estnische Deutschbalten. Sie schlossen Zeitungen und verhafteten nationale Politiker. Sie machten keinen Hehl aus ihrem Plan, einen neuen deutschen Fürsten in Reval zu installieren, der – mithilfe der lokalen Junker und der Bourgeoisie – den komplett vom Deutschen Reich abhängigen Puffer- und Marionettenstaat regieren sollte. Er sollte Baltisches Herzogtum heißen und am liebsten einen Hohenzoller als Herrscher bekommen. Die Esten sollten später sagen, diese nicht ganz neun Monate hätten sie mehr gegen die Deutschen aufgebracht als die vorangegangenen sieben Jahrhunderte deutscher Vorherrschaft. Die Tageszeitung Päevaleht schrieb 1919: „Was sie innerhalb von 700 Jahren veranstaltet haben, das können wir vergessen, aber das, was sie innerhalb von sieben Monaten getan haben, das zu vergessen ist unmöglich“14
Angesichts der feststehenden Niederlage an der Westfront ließen die Deutschen die internierten nationalen Politiker lieber frei. Fast in denselben Tagen, in denen sie Piłsudski aus der Festung in Magdeburg nach Warschau brachten, beförderten sie auch Päts von Grodno (Hrodna) nach Tallinn. Am 12. November wurde er Ministerpräsident der wiederbelebten Republik, die vorerst so gut wie nichts besaß. Den einzigen Schutz boten fremde Truppen: Die deutsche Besatzungsgarnison – deren Soldaten wirklich nicht wussten, wofür sie nach Kriegsende ihr Leben riskieren sollten – und die gerade von den Roten geschlagenen russischen Weißen. Die lokalen Einheiten der Selbstverteidigung und Trupps in der Art der polnischen „Falken“ hatten paramilitärischen Charakter und reichten hinsichtlich ihrer Kampffähigkeit bei Weitem nicht an ihre Pendants in den Balkanstaaten heran, die Auseinandersetzungen mit der Gendarmerie oder sogar der regulären Armee nicht fürchteten und in derlei Kämpfen keineswegs ohne Chance waren. Im Vergleich zu den Komitadschi erwiesen sich die estnischen Freiwilligen als blutige Amateure.
Dennoch verfügte Estland mit seiner knappen Million Einwohner noch immer über ein beträchtliches Reservoir potenzieller Rekruten. Während des Ersten Weltkriegs waren rund 100.000 Männer in die zaristische Armee eingezogen worden. Zum Vergleich: Die Armee der Zweiten Polnischen Republik (35 Millionen Einwohner) zählte im Herbst 1939 eine Million Köpfe, nicht dreieinhalb Millionen. Die grundlegende Frage der Gründer der Estnischen Republik musste deshalb lauten: Wie wären die Landsleute dazu zu bewegen, noch einmal zu den Waffen zu greifen – diesmal für das entstehende Vaterland und die Demokratie?
Die Rote Armee griff am 22. November an und eroberte nach einer Woche Narwa. Sofort entstand die Estnische Arbeiterkommune, das heißt die Keimzelle der bolschewistischen Republik. Bald erfüllte sich die zweite hypothetische Variante der Zukunft des Landes. Lenin, der überzeugt war, dass die Rote Armee als Befreierin begrüßt würde, verkündete am 7. Dezember die Anerkennung der Estnischen Sowjetrepublik – „Kommune“ klang doch allzu absurd. Zugleich wunderten sich die russischen Arbeiter in Narwa, warum sie sich nicht mehr – wie früher – in Russland befanden.
Der Widerstand gegen die auf die Hauptstadt vorrückenden Bolschewiki formierte sich nur langsam. Dem Aufruf zur allgemeinen Mobilmachung folgte nur die Hälfte der Betroffenen, Desertionen waren an der Tagesordnung. Die Bauern, so Päts bittere Feststellung, wollten nicht für die Stadtbewohner kämpfen. Schließlich entschied sich die Regierung dazu, die Vaterlandsliebe durch die Lösung der Agrarfrage zu befeuern: Am 20. Dezember versprach sie eine Bodenreform, also Land für die Bauern. Vielleicht war dies der letzte Sargnagel für die Version eines sozialistischen, das heißt bolschewistischen Estlands, auch wenn die Bauern nicht gleich massenhaft in die Armee drängten. Schließlich stand Weihnachten vor der Tür.
Das wusste ein ehemaliger russischer Berufsoffizier, der 30-jährige Oberst Johan Laidoner, der zwei Tage vor der offiziellen Ankündigung der Bodenreform zum Oberbefehlshaber ernannt worden war. Er versuchte, das Gewissen der Landsleute auf andere Weise wachzurütteln: Wenn die Interessen der Städter bedroht seien, müssten die Städter sie an der Front verteidigen. Von außen sei keine Hilfe zu erwarten. Laidoner irrte sich. Die abgebauten deutschen Besatzungstruppen waren nicht mehr im Land, dafür aber die deutschen Einwohner. Die Regierung einigte sich mit ihnen auf die Gründung eines deutschbaltischen Regiments. Auch die russischen Weißen wollten gegen die Bolschewiki kämpfen. Es meldeten sich finnische Freiwillige. Ein Geschwader leichter britischer Kreuzer traf an der estnischen Küste ein. Es brachte eine ordentliche Lieferung neuer Waffen und eroberte zwei russische Zerstörer, die sie den Esten übergaben. Vor allem aber nahm es Objekte unter Beschuss, die für die Roten strategisch wichtig waren. Die Zerstörung einer Brücke über die Narwa erschwerte etwa die Versorgung der vordersten Einheiten der Roten Armee und verhinderte, dass Panzerzüge den Fluss überquerten. Von der Bedeutung dieser Züge wird an anderer Stelle noch die Rede sein.
Ende Dezember rückten die Bolschewiki trotz enormer Schwierigkeiten bis auf 35 Kilometer an Tallinn heran. Der Gegenangriff der Esten – genau genommen waren es Weiße, Deutsche, Finnen und Esten – begann am 6. Januar. Sie verfügten über gepanzerte Züge, die Gegner nicht.15 Außerdem brachten Söldner und Freiwillige Erfahrungen und Gewohnheiten aus früheren Kämpfen gegen die Bolschewiki in den estnischen Unabhängigkeitskampf ein – allen voran die finnischen Veteranen des erst kurz zuvor zu Ende gegangenen Bürgerkriegs:
Die Kriegspropaganda stellte den verhassten Feind – die Roten – als militärisch unfähig und verweichlicht dar, was schroff mit der großen Moral und heroischen Haltung der finnischen Freiwilligen kontrastierte. […] Manchmal ging ihre Strategie auf. Während des estnischen Feldzugs drang eine Kompanie des 1. Regiments finnischer Freiwilliger weit auf feindliches Territorium in die Vororte der strategisch wichtigen Stadt Narwa vor. Ohne zu zögern, stürmte die Kompanie die von bolschewistischen Truppen besetzte Stadt, besetzte den Marktplatz, was in den feindlichen Reihen Panik und Chaos hervorrief, und hätte fast den Oberkommandierenden Leo Trotzki gefangen genommen.16
Die finnischen Freiwilligen ließen sich nicht nur von der Begeisterung hinreißen. Während ihres Gastspiels an der südlichen Ostseeküste ließen sie auch der Grausamkeit freien Lauf, für die sie kurz zuvor bekannt geworden waren. Während der Kämpfe um Narwa gerieten 30 finnische Rotarmisten in ihre Hände. Sie erschossen sie bis auf den letzten Mann.17 Das war nicht der einzige Exzess der zackigen „Jungs aus dem Norden“ (Pohjan Pojat), wie sie sich selbst nannten. Kein Wunder also, dass die estnische Regierung sich ihrer schnellstmöglich entledigte.
Dank, manchmal auch trotz solcher Hilfe gewannen die Esten. Die Republik erhielt ihren Gründungsmythos. Die Idee des Nationalstaats wurde von den Parteien der nicht- und antikommunistischen Linken, die bei den Aprilwahlen zur Konstituante insgesamt zwei Drittel der Stimmen erhielten, mit sozialem Inhalt gefüllt. Über die Bedeutung der Bodenreform für die Konsolidierung der neuen baltischen Staaten schreiben wir an anderer Stelle.
Noch bevor die Verfassunggebende Versammlung zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammenkam, um im Eiltempo die Bodenreform zu beschließen, ereignete sich ein Vorfall, der sich am besten aus lettischer Perspektive schildern lässt.