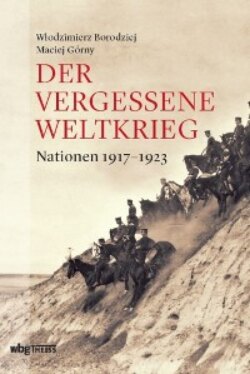Читать книгу Der vergessene Weltkrieg - Maciej Górny - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Ethnisierung der Armee vor der Februarrevolution
ОглавлениеBeginnen wir damit, dass schon lange vor der Revolution die imperialen Armeen längst nicht so monolithisch waren, wie es Brussilow und Lobanow-Rostowski wollten. Zwar gibt es keinen Grund, ihre Einschätzung der Moral und der Versorgung vor dem für die zaristischen Truppen katastrophalen Frühjahr und Sommer 1917 anzuzweifeln, doch sowohl auf ihrer Seite der Front als auch in der k. u. k. Armee gewannen die zentrifugalen Tendenzen an Stärke. Anfangs weckten sie keine größeren Sorgen, doch während der zwei großen Feldzüge 1916 entwickelten sie plötzlich eine für die Imperien gefährliche Dynamik. Im passenden Moment sollten sie ihre volle Kraft entfalten.
Die Geschichten der nationalen Einheiten innerhalb der russischen und österreichisch-ungarischen Armee ähneln sich meist sehr. Die erste Begegnung der polnischen Legionäre mit den Landsleuten aus dem russischen Teilungsgebiet war für die jungen Idealisten eine große Enttäuschung. Der Volksaufstand, den sie auslösen wollten, brach nicht aus und die Kämpfe gegen die Russen, so heroisch sie waren, waren überwiegend Rückzugsgefechte. Die Geschichte der zur gleichen Zeit formierten Legion der ukrainischen Sitscher Schützen wirkt, wenngleich in etwas kleinerem Ausmaß, bis in die Details (wie etwa der demonstrative Unwille, Franz Joseph I. die Treue zu schwören) wie eine exakte Kopie der polnischen Erfahrungen.7 Wie die polnischen Legionäre empörten sich die ukrainischen Soldaten über die Grausamkeiten der österreichisch-ungarischen Militärs gegen ihre Landsleute im Zarenreich, sie gerieten in Konflikt mit den besser ausgestatteten regulären Einheiten, denen sie die Ausrüstung stahlen, und sie versuchten in ihren Reihen demokratischen Grundsätzen zu folgen. Mit den Polen teilten sie auch die für junge, unerfahrene Soldaten typische Enttäuschung und Frustration angesichts des wirklichen Kriegserlebnisses. Eines der ersten Abenteuer der ukrainischen Legionäre war die schlecht vorbereitete und dilettantisch durchgeführte Aufklärungsexpedition eines kleinen Trupps hinter den russischen Linien in der Nähe von Stryj:
Die Schützen marschieren ohne Karten und Kompasse durch die verschneiten bewaldeten Berge […]. Während des weiteren Marschs begegnen sie weder russischen noch österreichischen Truppen. Sie wissen nicht, ob sie noch vor oder schon hinter der Frontlinie sind. Im Dorf kaufen sie Schweine, schlachten, braten und verspeisen sie. Am 19. Oktober 1914 ziehen sie ins von den Russen verlassene Stryj ein, die Bevölkerung begrüßt sie mit Blumen und Zigaretten, gleich darauf aber werden die Zwanzig durch eigene Unvorsicht von der russischen Nachhut gefangen genommen. Der russische Fähnrich bietet ihnen Zigaretten an und meint, es müsse schlecht um Österreich stehen, wenn man schon kaum erwachsene Jungen mobilisiere.8
Weitere Versuche, einen Aufstand der Landsleute auf der anderen, von den Russen besetzten Seite der Karpaten anzustacheln, verliefen im Nichts. Die monatelangen schweren Kämpfe in Galizien brachten den ukrainischen Legionären sowohl einen Moment des Ruhms (die blutige Schlacht um den Berg Makiwka, die in einem patriotischen Lied verewigt wurde) als auch enorme Verluste. Während der Brussilow-Offensive wurde die Legion an der Zlota Lipa praktisch ausgelöscht. Eine Werbeaktion unter russischen Ukrainern nach der Mackensen-Offensive 1915 brachte nicht den erhofften Erfolg (wiederum ähnlich wie die zeitgleichen Anstrengungen der Rekrutierungsoffiziere der Polnischen Legionen). Unterdessen wuchs unter den Legionären und ihren politischen Unterstützern die Enttäuschung über die Politik der Mittelmächte. Die Ukrainer fühlten sich sowohl in geopolitischer Hinsicht (die Proklamation vom 5. November und die Ankündigung der Errichtung eines polnischen Staates bedeutete für sie den drohenden Verlust von Gebieten, die sie als Teil der Ukraine betrachteten) als auch in weniger bedeutsamen, aber symbolischen Fragen missachtet; als die wenigen übriggebliebenen Sitscher Schützen zum Ausheben von Schützengräben und zu anderen Hilfsarbeiten an der Front abgeordnet wurden, sprach man in den ukrainischen Reihen vom „Spatenzug“.9
Die polnischen Legionäre, eine größere und erfahrenere Gruppe als die ukrainischen Waffenbrüder, empfanden ähnlich. Zwar identifizierten sie sich schon zu Beginn des Kriegs nicht ganz mit den Interessen der Donaumonarchie, doch den Wendepunkt markierte offenbar die Brussilow-Offensive. Danach hatte das Wort „unsere“ eine andere Bedeutung, es beschrieb nicht mehr die k. u. k.-Armee als Ganzes. In diesem Fall können wir sogar eine mikrohistorische Analyse des entscheidenden Moments für diesen Stimmungsumschwung wagen. Möglich wird dies durch die ungewöhnliche Zusammensetzung der Legionen, einer der literarischsten Formationen der Militärgeschichte. Dank der ausführlichen Beschreibungen des Dienstes in den Legionen können wir die Erosion des imperialen Konsenses gleichsam Bild für Bild beobachten.
Den Beginn macht eine Rückblende in die Zeit der Brussilow- Offensive, die den Hintergrund der Entstehung der Legionen veranschaulicht. Die Frontberichte österreichisch-ungarischer Soldaten von Juni und Juli 1916 gehörten einer speziellen Gattung an: der Analyse einer Niederlage, die so schmerzlich war, dass sie der Erklärung bedurfte. Verständlicherweise interessierte sich die Öffentlichkeit in der Heimat vor allem für die Einheiten, die zu Beginn der Offensive am meisten gelitten hatten, insbesondere für das 1. Wiener Infanterieregiment unter dem Kommando von Oberstleutnant Max Schönowsky-Schönwies. 1919 erschien kurz nach seiner offiziellen Rehabilitierung ein von ihm und dem Reserveoffizier und Journalisten August Angenetter verfasstes Buch über die Kämpfe seines Regiments in der Gegend von Olyka. Die Autoren schilderten die entscheidenden Tage im Juni 1916 in pathetischen Tönen. Das Regiment habe mit unvergleichlichem Mut und Todesverachtung „gegen dieses erdbraune, massige Unheil, das sich brüllend, tosend, flammend heranwälzte […] durch viele Stunden bis zur allerletzten Patrone und noch darüber hinaus“ gekämpft.10 Auf der Suche nach weiteren Gründen für die Niederlage verwiesen die Autoren auf die unzureichende Versorgung, Kommunikationsprobleme und das Entscheidungschaos, doch überraschend deutlich kritisierten sie auch die mangelnde Loyalität der eigenen Soldaten. Dieses Motiv erscheint in ihrem Buch schon in den Abschnitten über die Situation vor der Schlacht, in denen es nicht an boshaften Bemerkungen über die Ungarn mangelt, die unbarmherzig die Zivilbevölkerung ausplünderten. Anschließend beschreiben die Autoren die Reaktion der Soldaten auf das orkanartige russische Artilleriefeuer:
Etliche Tschechen und zwei Ruthenen – unsichere Kantonisten, die bei uns eingestellt worden waren – haben sich zu einem Sondergrüpplein zusammengetan. Sie zeigten in ihren Gesichtern einen Ausdruck, der ein mixtum compositum von Feigheit, Hinterhältigkeit, Verschlagenheit, Furcht, Schadenfreude und geheimer, niedriger Hoffnung war. Ekelhaft waren diese mißgestalteten Physiognomien anzuschauen. Ein paar Polen klebten in einer Nische dicht aneinander, verdrehten die Augen, daß man das Weiße hervorschimmern sah, und beteten mit grauen, bebenden Lippen.11
Wie wir bereits wissen, führte die Unterstellung, Tschechen und Ruthenen seien für die Niederlagen der k. u. k. Armee verantwortlich, in Wien zum Streit zwischen deutsch-österreichischen und tschechischen Politikern. Die Vorwürfe verschärften sich nach Berichten über die ersten Erfolge der in Russland aufgestellten tschechoslowakischen Einheiten, zumal nach der Schlacht bei Zborów 1917. Höhepunkt dieser Kampagne war die lange Anklageschrift gegen die Tschechen, die Ende 1917 von einer Gruppe deutscher Abgeordneter im Wiener Parlament verlesen wurde (die Reden der Abgeordneten unterlagen nicht der Zensur, die andernfalls den Text, der die Einheit der Monarchie untergrub, kassiert hätte).12
Die Lektüre tschechischer Kriegserinnerungen und historischer Arbeiten verkompliziert dieses Bild. Die Tschechoslowakei der Zwischenkriegszeit gründete ihre Legitimität auf die Beteiligung von Legionären im Kampf gegen die Mittelmächte in Russland, Frankreich und Italien. Vervollständigt wurde diese Erzählung durch den Mythos vom konsequenten Widerstand der tschechischen und slowakischen Soldaten der Habsburgermonarchie, die nur unwillig einer ihren Interessen zuwiderlaufenden Sache gedient und sogar den Dienst sabotiert hätten. Die Erzählungen von massenhaften Desertionen und Übertritten zum Feind finden in den Quellen freilich keine Bestätigung. Die österreichisch-ungarischen Soldaten tschechischer Nationalität beschreiben dafür den Sommer 1916 als Abfolge kräftezehrender Rückzüge und schlecht vorbereiteter Gegenangriffe. Und wichtiger noch, in ihrer Darstellung sind weder Feigheit noch Heroismus ethnisch konnotiert, sie finden sich bei Angehörigen aller Nationalitäten der k. u. k. Monarchie. Wie der Rekrut František Černý festhält, gab es in dieser Situation nichts, was eine Interpretation in ethnischen Kategorien erlaubt hätte:
Immer wieder holte ich Regimenter ein, deren Soldaten am Straßenrand rasteten, und es war klar, dass sie ihre Positionen schon vor Mitternacht verlassen haben mussten. Sobald der Weg ebener wurde, traute ich meinen Augen nicht, solche Massen von Soldaten sah ich! Eine schier endlose Menge. Alles befand sich auf dem Rückzug: Infanterie, Kavallerie, Trains. Ich dachte: „Wie viele wir sind! Wohin sollen wir fliehen?“ Aber, weil alle flohen, floh auch ich.13
Unabhängig davon, welche Rolle die ethnischen Konflikte zwischen Deutschen und Tschechen in der Erzählung vom Sommerfeldzug des Jahres 1916 spielen – für beide Seiten war es zweifellos eine Geschichte des Scheiterns. Die Erinnerungen der polnischen Legionäre verleihen denselben Ereignissen einen ganz anderen Sinn. In ihrer Darstellung und infolgedessen auch in der polnischen Militärgeschichte nehmen der Wolhynien-Feldzug und insbesondere die im Juli 1916 geschlagene Schlacht bei Kostiuchnówka einen würdigen Platz ein – als Beinahesieg im Kampf gegen einen zahlenmäßig überlegenen Feind.14 Außerdem einen geht man allgemein davon aus (unserer Meinung nach zu Unrecht), dass die Entscheidung zur Anwerbung von Rekruten für die polnische Wehrmacht im deutschen Besatzungsgebiet des Königreichs Polen unter dem Eindruck des Heldentums der Legionäre getroffen wurde.15 Zur Schlacht bei Kostiuchnówka gibt es zahlreiche Berichte aus erster Hand, was aus der erwähnten spezifischen sozialen Zusammensetzung der polnischen Freiwilligenregimenter resultiert. Überdies nahm der legendäre Anführer der Legionen, Józef Piłsudski, nicht nur an den Kämpfen in Wolhynien teil, sondern erschien auch dort an vorderster Front.16 Wirklich faszinierend ist aber, was die polnischen Teilnehmer der Schlacht über ihre nichtpolnischen Kampfgenossen schrieben.
Die Darstellung der Kämpfe gegen die Russen weist einige Ähnlichkeiten zu den österreichischen Schilderungen auf. Die übermächtigen Kräfte des Feindes werden mit einer Naturgewalt verglichen und als ebenso unaufhaltsam wie blind beschrieben. Einen Unterschied bildet die nur in den polnischen Berichten anzutreffende „ständische“ Interpretation des Konflikts als Kampf der „polnischen Herren“ gegen die Masse der „russischen Bauern“. Am weitesten ging dabei wohl der Soldat und Historiker Wacław Lipiński:
Gefallene russische Soldaten nach einem Angriff auf deutsche Stellungen in Wolhynien, 1916.
Sie warteten dumpf und passiv einige Momente, bis eine in den Haufen geworfene Handgranate sie von ihrem Platz vertrieb. […] Und es wimmelt nur so von ihnen. In den Hecken von Kostiuchnówka, unter den Drähten, im spärlichen Getreide, so weit das Auge reicht – hellgrüne Hemden und rote, verschwitzte Gesichter. Wir feuern ihnen geradewegs in die Schnauze, unfehlbar, mit kalter Grausamkeit. Sie antworten kaum, werfen stattdessen Granaten in den Schützengraben. Und sterben – sterben wortlos, abgestumpft und apathisch.17
Lipiński schildert anschließend eine Episode aus einer späteren Phase der Schlacht, die sich auf einer Brücke über einen Bach abspielte:
[…] auf der Brücke ein entsetzlicher Schrei. Dort wurden im Nu, blitzartig die Soldaten, die schon von der Seite herangekommen waren und den Weg versperrten, mit Kolben erschlagen, mit Bajonetten aufgeschlitzt. Die großen russischen Bauern wurden in den Sumpf gestoßen, man sah vor Leichen den Boden der Brücke nicht mehr. […] Als ich die Linie erreichte, fiel mir Narbutts erhabene Gestalt mit dem glänzenden blitzenden Browning aus Nickel ins Auge. Ein Kampf auf Leben und Tod. Primitive, verbissene Leidenschaft. […] Dort schlägt Oberleutnant Hajec den Bauern auf den Ruf „zdajsia“ [Hände hoch!] die Spitzrute ins Gesicht. Mit den Kolben auf die Köpfe, die Arme, Schüsse, Feuer direkt ins Gesicht. Bis wir die Menge zurückgedrängt hatten.18
Bevor wir uns vom expressionistischen Stil der Darstellungen mitreißen lassen, sollten wir uns klarmachen, dass letztlich auch die Polen mit ihren österreichischen und ungarischen Kampfgefährten zurückweichen mussten. Vor allem Letztere wurden oft für den Zusammenbruch der Verteidigung verantwortlich gemacht. Die Honvéds, die eine Stellung auf dem Polenberg besetzten (der Name erinnerte an den Beitrag der Legionen zum Wolhynien-Feldzug 1915), mussten angeblich von den Polen mehrfach an der Flucht gehindert und in die Schützengräben zurückgetrieben werden. Lipiński merkt kritisch an: „Eine verfluchte Bande gottverdammter Penner“.19 Er fügt hinzu, dass drei Wochen nach der Schlacht bei Kostiuchnówka das 93. und das 99. Regiment, die Positionen in der Gegend besetzten, in Abwesenheit der Polen „sofort zusammenbrechen“.20 Der Legionär Marian Dąbrowski schreibt:
Allgemein heißt es in Legionsreihen, dass wir immer die Panik der österreichisch- ungarischen Einheiten dämpfen, bis bayerische oder preußische Verstärkung an den bedrohten Positionen eintrifft.21
In vielen polnischen Erinnerungen an Kostiuchnówka wiederholt sich eine bestimmte Szene, die den zitierten Behauptungen einen pikanten Beigeschmack verleiht. Während des Rückzugs verfielen einige Abteilungen der k. u. k. Armee in Panik, Kavallerie, Infanterie und Trains gerieten sich gegenseitig in die Quere und hinderten andere Einheiten am Vorankommen. In diesem Augenblick erschien eine kleine Einheit von Legionären unter dem Kommando des bereits erwähnten Aleksander Narbutt-Łuczyński:
Schon ertönte Narbutts scharfer Befehl in der Kolonne: „Bajonett auf!“, schon begannen die auf österreichische und preußische Offiziere gerichteten Gewehrläufe die Flucht etwas zu hemmen. Wir errichteten eine Mauer aus Bajonetten und Kolben, um nichts in der Welt wollten wir unsere Kolonne sprengen lassen. […] Wir begannen zu singen. Die ruhige, geschlossene Kolonne, gespickt mit Bajonetten, und der kräftige, laut tönende Gesang zeigen letztlich Wirkung. Die Artilleristen, die Kavallerie heben die Köpfe, zügeln die Pferde, die Panik schwindet. Mit einem kurzen Galopp schließt ein preußischer Offizier zum voranreitenden Narbutt auf. Er sagt etwas, gratuliert, streckt schließlich die Hand aus. Doch Narbutt steckt seine Hand langsam in die Tasche.22
Andere Berichte ergänzen dieses Bild um interessante Details. Die marschierenden Polen sollen „Hej strzelcy wraz“ „Hey Schützen zusammen“ gesungen haben, ein Aufständischenlied von 1863, das an die wichtigste patriotische Traditionslinie Zwischenkriegspolens, den Januaraufstand, erinnerte. Manche Augenzeugen behaupten, wohl in leichter Überschätzung der Sangeskünste der Legionäre, schon allein der Gesang habe die Armee beruhigt.23 Angesichts der Tatsache, dass die meisten der hier zitierten Berichte unmittelbar oder nicht allzu lange nach der Schlacht entstanden, muss man sie als Aufzeichnungen wenn nicht von Fakten, so doch gewiss der in den polnischen Einheiten herrschenden Stimmung betrachten. Kostiuchnówka, die letzte große Schlacht des Ersten Weltkriegs, die von den Legionen geschlagen wurde, beschleunigte den Prozess der Bewusstseinsbildung der jungen polnischen Patrioten. Zwei bereits angesprochene Aspekte dieses Prozesses scheinen dabei besonders interessant.
Beginnen wir mit dem spezifischen Bild des Feindes, das, wie wir meinen, auf einen Wandel der Klassenidentität der Legionäre hindeutet. Obwohl viele von ihnen eher mit der Linken sympathisierten und obwohl immer wieder die demokratische Struktur der Legionen betont wurde, lebte mit der russischen Offensive ganz offensichtlich ein Stereotyp wieder auf, das im Osten das Polnische mit dem Adel und das Russische (auch das Ukrainische und Weißrussische) mit der Bauernschaft assoziierte. Während der Kriege um die Grenzen des wiedererstandenen Staates in den Jahren 1918–21 sollten sich alle Konfliktparteien auf dieses Stereotyp berufen. Nicht nur die Bolschewiki betrachteten ihre polnischen Feinde als „Herren“; auch Ukrainer und Litauer versuchten mit entsprechenden Klischees die Bauern zum Kampf gegen die Polen zu mobilisieren.
Der zweite und wichtigere Aspekt, der die polnischen Quellen von tschechischen oder österreichischen Berichten unterscheidet, ist der sukzessive Legitimationsverlust des Bündnisses, in dessen Rahmen die Legionen zum Kampf angetreten waren. Das wiederkehrende Bild der polnischen Einheit, die sich mit einem nationalpatriotischen Lied auf den Lippen durch die panische Menge schlägt, hat Symbolcharakter. In Anbetracht der späteren Ereignisse kann diese Szene als Metapher für den Bruch mit der imperialen Loyalität und den Beginn eines neuen, rein nationalen Kampfes gelten. Kämpfer, die so mutig und kaltblütig waren wie angeblich die bei Kostiuchnówka, waren zweifellos in der Lage, die Ziele der polnischen Nationalbewegung zu verwirklichen.
Ein wenig überschattet wird dieses monumentale Bild durch eine Tatsache, die in den polnischen Erinnerungen an die Schlacht, wenn überhaupt, dann nur am Rand erwähnt wird. Ein Veteran schildert auch den Moment des Ausbruchs der Panik unter österreichischen und deutschen Soldaten. Wie er schreibt, begann alles damit, dass eine polnische Kavallerieeinheit bei ihrem ungeordneten Rückzug mit österreich-ungarischen Trains zusammenstieß. Das löste eine Kettenreaktion aus, die erst durch Narbutt gestoppt wurde, einen Offizier, der in diesem Buch noch in einer weit weniger rühmlichen Rolle erscheinen wird. Polen stoppten also einen Ausbruch von Panik, den andere Polen verursacht hatten. Allerdings ist die dramatische Szene wohl weniger als präzise Rekonstruktion des tatsächlichen Verlaufs der Ereignisse von Bedeutung, sondern als Symbol. Dadurch, dass so viele Legionäre ihre Erlebnisse aufzeichneten und kommentierten, eröffneten sie Historikern den Zugang zu einer Sphäre, die ihnen sonst weitgehend verschlossen bleibt: zu den Herzen und Köpfen der Teilnehmer des Ersten Weltkriegs.
Im Herbst 1916 war in diesen Herzen kaum noch Platz für die bisherigen Verbündeten, selbst wenn der Verstand weiterhin zu loyalem Verhalten riet. Die Situation verschärfte sich Anfang des folgenden Jahres, als die in den Kämpfen in Wolhynien ausgebluteten Legionen zur Erholung ins Königreich Polen geschickt wurden. In Zegrze waren die polnischen Regimenter unmittelbar neben deutschen Einheiten stationiert. Es dauerte nicht lange, bis sie einen unerklärten Guerillakrieg gegeneinander begannen. Der letzte Auslöser für den offenen Ausbruch der Feindseligkeit gegen den Verbündeten war der Diebstahl (oder illegale Kauf, hier gehen die Berichte auseinander) von Brot durch einen Legionär. Bei der Rückkehr in die Kaserne ignorierte er die Aufforderung deutscher Wachen, stehen zu bleiben, und wurde auf der Stelle erschossen. Ein Beteiligter der Vorfälle schildert, was dann geschah:
Die wütende Gesellschaft stürzt sich auf den Wächter und verwandelt ihn binnen einer Minute in einen blutigen Fetzen. Bevor er stirbt, kann er noch um Hilfe rufen. Dreißig Deutsche mit schussbereiten Gewehren greifen uns an, doch wir erledigen sie im Nu. Schlagen ihnen mit den Kolben die Schädel ein usw. Die deutsche Garnison in den Kasernen an der Weichsel wird alarmiert. Uns fehlt Munition, also greifen wir die Waffen- und Munitionsdepots an. Bei der deutschen Kolonne erscheint zu Pferd der Kommandeur des 4. Infanterieregiments Major A. Galica. Er kommt als Vertreter des Brigadenkommandeurs Oberst Roj, der eine Besprechung einberuft. In der angespannten Situation können wir nicht in unseren Quartieren bleiben. Wir müssen mindestens 30 km von hier fort. Dasselbe gilt für die Deutschen, die sich in eine andere Richtung entfernen als wir. Diese prophylaktische Isolierung soll etwa drei Wochen dauern, bis sich die Emotionen auf beiden Seiten beruhigt haben.24
Die Wiederherstellung der Ordnung erforderte in diesem Fall radikale Schritte. Die Legionäre beruhigten sich erst, als auf einer Narew-Brücke Maschinengewehre aufgestellt wurden, die auf ihre Kasernen zielten. Es dauerte auch, bis sie die festgehaltenen und ordentlich verprügelten deutschen Wächter freiließen. Für den Mörder des Legionärs kam die Hilfe zu spät, er starb kurz nach dem Zwischenfall im Krankenhaus. Trotz der Bemühungen der Anführer entspannte sich die Lage nicht. Im Juni kam es zu einem weiteren Zwischenfall, bei dem ein Legionär mit dem Bajonett erstochen und in den Narew geworfen wurde.25
Außerhalb der Kasernen war das deutsch-polnische Verhältnis keineswegs besser. Die Legionäre klagten über die katastrophale Verpflegung und fühlten sich zurecht benachteiligt (längere Zeit erhielten sie den österreichischen Sold, der niedriger war als der deutsche, und die deutschen Lebensmittelrationen, die wiederum schlechter waren als die österreichischen). Es mehrten sich Desertionen, eigenmächtige Urlaubsverlängerungen, Diebstähle, Geschlechtskrankheiten und – natürlich – Schlägereien mit Deutschen, zumal in Kneipen und Freudenhäusern. Die Legionäre gingen sogar aktiv gegen deutsche Requirierungstrupps vor, die sie aus den polnischen Dörfern vertrieben. Manchmal geschah das sogar unter dem Mantel des Kriegsrechts, das eine schriftliche Anordnung verlangte, meist aber handelte es sich um Scharmützel ohne formale Begründung. Der Befehl von General Stanisław Szeptycki vom Januar 1917 sagt viel über die damalige Stimmungslage in den polnischen Reihen:
Seit der Ankunft der Polnischen Legionen auf dem Gebiet des Königsreichs Polen ist es bereits zu einigen Vorfällen zwischen Offizieren der Polnischen Legionen und Soldaten der deutschen Armee gekommen. Einige dieser Vorfälle nahmen einen überaus heftigen Verlauf, weil von Waffen Gebrauch gemacht wurde und, was ich besonders unterstreiche, weil sie in Einrichtungen stattfanden, deren Besuch durch Offiziere durch nichts zu rechtfertigen ist. Ohne darauf eingehen zu wollen, wer bei den einzelnen Zwischenfällen im Recht war, muss ich festhalten und nachdrücklich betonen, dass diese Vorfälle das harmonische Zusammenleben beider Armeen sehr stören und erschweren. […] Ich empfehle daher dringend, jegliche Auseinandersetzung und Streit mit deutschen Offizieren und Soldaten zu vermeiden.26
Die Verachtung der Polen für die Österreicher und ihre Abneigung gegen die Deutschen hatten natürlich sowohl rationale als auch psychologische Gründe. Allerdings beschränkte sich das Phänomen keineswegs auf die polnischen Kriegsteilnehmer. Es war schon die Rede von der Frustration, die zur selben Zeit die westukrainischen Patrioten ergriff. Auch auf der anderen Seite der Front erwies sich das „harmonische Zusammenleben der Armeen“ immer öfter als leere Phrase. Die Geschichte der russisch-rumänischen Kooperation in den Jahren 1916 und 1917 ist ein anschauliches Beispiel für den zugrunde liegenden Mechanismus.
Im Rumänien-Feldzug errangen die verbündeten Armeen Deutschlands, Österreich-Ungarns und Bulgariens einen Erfolg nach dem anderen. Die Verteidigung der letzten Teile des rumänischen Territoriums entlang der russischen Grenze erforderte nicht nur eine ungeheure Anstrengung der rumänischen Armee, sondern auch ein militärisches Eingreifen Russlands. Historiker schätzen, dass allein die Unterstützung der rumänischen Front ein Viertel bis ein Fünftel der russischen Kräfte band, das heißt mit Etappe, Versorgung, Krankenhäusern und Ähnlichem weit mehr als eine Million Menschen.27 Diese Zahlen täuschen jedoch. Die Russen engagierten sich erst im großen Maßstab, als der Ausgang des Rumänien-Feldzugs schon feststand. Statt rechtzeitig die Offensive des Verbündeten zu unterstützten, retteten sie ihn nur mühsam vor der völligen Niederlage.
Die Anfänge der rumänisch-russischen Zusammenarbeit während des Feldzugs von 1916 liefern unzählige Beispiele für die gegenseitige Abneigung und das gegenseitige Misstrauen. Auf rumänischer Seite war diese Haltung historisch begründet. Die letzte russische „Hilfe“ während des Kriegs gegen die Türkei in den Jahren 1877–79 hatte mit dem Verlust Bessarabiens geendet. Die antirussischen Stimmungen in der rumänischen Gesellschaft waren nie erloschen. Umgekehrt machten die russischen Militärs aus ihrer Geringschätzung für den Bündnispartner keinen Hehl. Das im August 1916 auf dringliche Bitten Bukarests in die Dobrudscha entsandte Expeditionskorps bestand aus so schwachen und/oder unerfahrenen Einheiten, dass kein russischer General das Kommando übernehmen wollte. Andrej Zajontschkowski, der letztlich die zweifelhafte Ehre annahm, erwies sich als absolut unfähig, zauderte und verweigerte den kämpfenden Rumänen konsequent jede Unterstützung. Er fühlte sich schlecht in der Dobrudscha, die er in Briefen als von Wilden bewohntes wildes Land beschrieb.28 Auch als der russische Ovid in Generalsuniform endlich abberufen wurde, änderte sich kaum etwas. General Henri Mathias Berthelot, der französische Verbindungsoffizier bei der rumänischen Heeresleitung, schrieb im Dezember 1916 verbittert an Joseph Joffre: „Aus Gründen, die ich nicht begreife, wollten die Russen, dass Rumänien fiel.“29
Es handelte sich um mehr als normale Missverständnisse zwischen Verbündeten. Kurz nach der Ankunft von Zajontschkowskis Korps notierte Oberst Alexandru D. Sturdza, der aus einer aristokratischen Familie stammte (sein Vater hatte mehrfach das Amt des Ministerpräsidenten ausgeübt) und als Kommandant der Bukarester Militärakademie großes Ansehen genoss: „Ich fürchte die Russen, […] sie sind jetzt in der Dobrudscha, […] aber sie führen nichts Gutes im Schilde. […] Der Weg nach Sofia und Konstantinopel führt nicht hier entlang, sondern durch Bukarest.“30 Das letzte Alarmsignal war für ihn und viele seiner Untergebenen der russische Plan, die verbliebenen rumänischen Einheiten auf russisches Territorium zu evakuieren und somit das gesamte Staatsgebiet dem Feind zu überlassen. Anfang Februar 1917 überschritt Sturdza die Frontlinie und richtete mithilfe der Deutschen einen Appell an die noch in Moldau verbliebenen rumänischen Soldaten:
Ich, Oberst Sturdza, mit dem ihr Seite an Seite gekämpft habt, wende mich heute an euch. Ich möchte eine neue Armee errichten, ausgestattet mit neuesten Waffen und angeführt von der Sache ergebenen Offizieren. Ich möchte, dass wir die verlorene Sache aufgeben, dass wir den russischen Räuber aus unserem Land vertreiben und so bald wie möglich in unsere Häuser zurückkehren. Dabei helfen werden uns 200.000 rumänische Kriegsgefangene, die ich befreie.31
Das energische und rücksichtslose Einschreiten der russischen Gegenaufklärung verhinderte Massendesertionen. Sturdzas in den Reihen der Armee verbliebene Gefolgsleute wurden enttarnt und hingerichtet. Das ehrgeizige Projekt scheiterte, weil letztlich nur einige Hundert Soldaten flohen, zu wenig, um eine konkurrenzfähige prodeutsche rumänische Armee aufzubauen.
Mit dem Rumänienfeldzug hängt ein weiterer Fall von Unstimmigkeiten zwischen Verbündeten zusammen. 1916 reiste der serbische Ministerpräsident Nikola Pašić zu einem Besuch nach Petrograd. Ein Ergebnis seiner Gespräche war die Entscheidung über den Beginn einer Anwerbungsaktion für ein serbisches Freiwilligenkorps in Odessa. Das natürliche Reservoir an Kandidaten für diese Formation waren die österreichisch-ungarischen Kriegsgefangenen serbischer Nationalität. Mehrere Tausend der so rekrutierten, meist unerfahrenen Serben nahmen an der von General Zajontschkowski befehligten Operation teil, einige weitere Tausend an den späteren Kämpfen auf rumänischem Territorium. Sie schlugen sich tapfer, erlitten freilich bedeutende Verluste. Etwa die Hälfte der weit mehr als zehntausend Soldaten kam ums Leben oder wurde verwundet. Vielleicht waren diese Verluste der Grund dafür, dass man – ob auf serbischer oder russischer Seite ist nicht eindeutig geklärt – auf die Idee kam, die stark gelichteten Reihen ließen sich am besten durch Zwang auffüllen. Unter den österreichisch-ungarischen Kriegsgefangenen in den südrussischen Gouvernements wurden regelmäßige, wenngleich absolut unrechtmäßige Rekrutierungen durchgeführt. Infolge der sehr eigenwilligen Auslegung einer Übereinkunft zwischen der serbischen Regierung und Vertretern des Jugoslawischen Komitees, das die Südslawen aus der Habsburgermonarchie repräsentierte, waren auch Kriegsgefangene kroatischer und slowenischer Nationalität von diesen Rekrutierungen betroffen. Deren Lust zur Rückkehr an die Front und zum Kampf gegen den eigenen Staat war natürlich verschwindend gering:
Ein rumänischer Polizist patrouilliert mit deutschen Soldaten durch die Straßen von Bukarest, 1917.
Die zwangsweise mobilisierten Freiwilligen, die man „Zwangsler“ nannte, reagierten auf die Gewalt, indem sie sich weigerten, ihre Namen zu nennen und die Uniform anzulegen. Wie Dr. Potočnjak berichtet, sagte man ihnen später, sie müssten im Namen und auf Befehl des Zaren kämpfen, Ungehorsam würde mit Hunger bestraft. Das erzeugte Verbitterung; die „Zwangsler“ bildeten neues, anonymes und zutiefst unzufriedenes Material, in dem sich zerstörerische Arbeit sehr leicht verbreitete und festsetzte.32
Am 23. November 1916 brach in den Kasernen auf dem Schnepfenfeld (Kulikowo Pole) ein Aufstand der „Zwangsler“ aus. Die alarmierten russischen Soldaten trafen auf eine empörte Menge, die den Kaiser eines feindlichen Staates hochleben ließ: „Živio Franjo Josip!“ Was die von der Außenwelt abgeschnittenen zwangsmobilisierten österreichisch-ungarischen Kriegsgefangen nicht wussten: Franz Joseph I. war zwei Tage zuvor gestorben.
Bei der Niederschlagung der Revolte von Kroaten und Slowenen starben 13 „Zwangsler“. Die Situation im jugoslawischen „Freiwilligen“-Korps entspannte sich erst nach der Februarrevolution. Unter den neuen, freieren Umständen verlangten Kroaten und Slowenen Auskunft darüber, nach welchen Prinzipien ihr künftiges Vaterland regiert werden sollte. Von der Antwort machten sie ihre Bereitschaft zur Kriegsteilnahme abhängig. Natürlich konnte niemand ihnen eine konkrete und umfassende Antwort geben. Als Zugeständnis wurde das Korps in Freiwilligenkorps der Serben, Kroaten und Slowenen umbenannt. Letztlich wurde nur ein Teil dieser Einheit an die Saloniki-Front gebracht und eingesetzt.
Mit Blick auf die nationalen Partikularismen, die vor der Revolution die imperialen Armeen aushöhlten, kann man leicht der teleologischen Versuchung erliegen und – wie einst die sowjetischen Historiker – überall dort Anzeichen der heraufziehenden Krise entdecken, wo sie am Ende tatsächlich eintrat. Deshalb möchten wir nicht behaupten, das Schicksal der Imperien und ihrer Armeen sei schon in der zweiten Hälfte des Jahres 1916 entschieden gewesen. Dennoch markiert für uns eben dieser Moment den Beginn eines Prozesses, an dessen Ende die bisherigen Verbündeten zu Feinden werden und Soldaten, die bis dahin Seite an Seite kämpften, die Waffen gegeneinander richten. Musste die innere, bisweilen symbolische Ethnisierung so enden? Sicher nicht. Eine kompetentere Führung hätte die zentrifugalen Tendenzen möglicherweise eindämmen und die Einheit der Armee erhalten können. Entsprechende Schritte unternahmen ungefähr zur gleichen Zeit die Deutschen, die über die hohe Anzahl von Desertionen polnischstämmiger Soldaten beunruhigt waren. Die Reaktion war entschieden und effektiv: Von 1916 an wurden die Posener (das heißt die Hauptverdächtigen; an der Loyalität der polnischsprachigen Schlesier zweifelten die deutschen Offiziere nicht) auf Einheiten mit überwiegend deutschen Rekruten verteilt. Hier hatten die Offiziere ein wachsames Auge auf sie. Gleichzeitig wurden die Repressionen gegen Deserteure verschärft. Handelte es sich um Angehörige einer Minderheit (also Polen oder Elsässer), bestrafte man auch die Familien. Diese Maßnahmen genügten, um den Hohenzollern bis Kriegsende die Loyalität ihrer polnischen Untertanen zu sichern. Den Erfolg der deutschen Antwort auf die „polnische Frage“ in der Armee belegt eine verblüffende Statistik über die von Briten und Franzosen in den letzten Kriegstagen, als die deutsche Front endgültig zusammenbrach, gefangen genommenen Wehrmachtsoldaten. Der Prozentsatz der sich ergebenden Polen war dort deutlich niedriger, als es ihr Anteil an den deutschen Truppen hätte erwarten lassen.33 Viele dieser bis zuletzt treuen Soldaten tauschten nach dem 11. November 1918 die deutsche Uniform gegen eine polnische ein oder legten zur besseren Unterscheidung von den einstigen deutschen Kameraden, die nun Gegner waren, weiß-rote Armbinden an. Das war freilich nicht mehr die Sorge ihrer ehemaligen Kommandeure.
Soldaten der Entente an der Salonikifront, 1917.
Kurz nach dem Ende der Brussilow-Offensive gelangte ein deutscher Offizier zu der Schlussfolgerung, der Krieg im Osten habe nun, im August 1916, endgültig die gleiche Gestalt angenommen wie die Kämpfe an der Westfront – hier wie dort hielten sich die Gegner entlang einer langen befestigten Frontlinie gegenseitig in Schach.34 Ein nicht allzu tiefgründiger Beobachter, der noch dazu in der Armee diente, die am besten mit der ethnischen Heterogenität in ihren Reihen zurechtkam, konnte tatsächlich diesen Eindruck bekommen. Unter der halbwegs geordneten Oberfläche schwelte schon der Konflikt, der die Verbündeten und sogar die Soldaten ein und derselben Armee in einander zunehmend feindlich gesinnte Lager teilte. Der bevorstehende politische Umsturz in Petrograd sollte diesen Konflikt noch deutlich verschärfen.