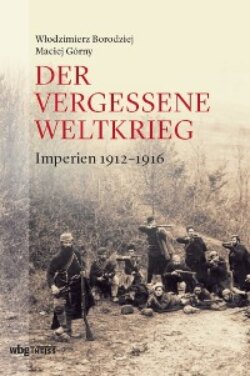Читать книгу Der vergessene Weltkrieg - Maciej Górny - Страница 12
Der Erste Balkankrieg
ОглавлениеIn diesem Krieg standen sich Armeen in verschiedenen Modernisierungsphasen gegenüber. Am rückständigsten in dieser Hinsicht war Montenegro, das sukzessive seine geringen Streitkräfte reformierte, die ein Mittelding zwischen Stammesmiliz und regulärer Armee bildeten. Das Osmanische Reich befand sich mitten in einer tiefgreifenden Armeereform, deren erste Auswirkung die Desorganisation und Zerschlagung des bisherigen Systems war. Der deutsche General und türkische Marschall Wilhelm Colmar von der Goltz, der sich um den deutschen Waffenexport wie um die Reform der türkischen Armee verdient machte, benannte noch vor dem Krieg ihre Schwachstellen:
Der Glanzpunkt der türkischen Armee sei der gemeine Mann. An Ausdauer, Leistungsfähigkeit und Genügsamkeit habe die Welt diesem prächtigen Material kaum etwas Gleichwertiges gegenüberzustellen. Ich habe Bataillone gesehen, die nach den außerordentlichen Marschleistungen trotz mangelhaftester Verpflegung pünktlich in die vorgeschriebenen Stellungen eingerückt seien. Auf diese Genügsamkeit des türkischen Soldaten scheine man aber allzu viel zu rechnen, denn der wundeste Punkt des türkischen Heeres sei die Intendanz, der Nachschub von Proviant und auch von Munition. In diesem für den Erfolg im Ernstfall so überaus wichtigen Punkte sei nahezu noch alles zu leisten.3
Trotz der Unterstützung durch deutsche Instruktoren und der Schulung türkischer Offiziere an deutschen Militärakademien kam die Erneuerung der Armee nur langsam voran. Bei Kriegsbeginn verfügte das stehende Heer – Nizam – über eine gewisse Ausbildung. Ein Krieg neuen Typs erforderte es aber, die Masse der Wehrpflichtigen in den Kampf zu schicken. Die türkische Reserve – Redif – war wesentlich schlechter bewaffnet (und zudem mit Gewehren unterschiedlichen Kalibers, was die Munitionsversorgung deutlich erschwerte), ihre Offiziere waren lokale Beamte, die teils über keinerlei militärisches Wissen verfügten. Wie sich schon bald zeigte, war die Ausstattung mit modernen Gewehren allein zu wenig, um aus der Redif eine schlagkräftige Armee zu machen. In den Kämpfen gegen die Bulgaren wurde klar, dass ein Teil der Reservisten nur mit Waffen älteren Typs zurechtkam und nicht wusste, wie man die Munitionskammer der frisch ausgehändigten Mauser öffnete. Und während sich der Nizam überwiegend aus Soldaten türkischer Nationalität und muslimischen Glaubens zusammensetzte, dienten in der Redif auch Christen und Juden. Viele türkische Militärs stellten deren Loyalität offen infrage, was die Stimmung in der Armee nicht verbesserte. Das geradezu psychotische Misstrauen gegenüber den vermeintlichen Spionen richtete mehr Schaden als mögliche Verschwörungen fremder Agenten an. Die Sorge vor undichten Stellen oder Sabotage manifestierte sich in unterschiedlichen Formen. Noch während der Operationen in Thrakien erhielten die türkischen Telegrafisten den Befehl, auf Deutsch zu telegrafieren. Damit wurden die Botschaften nicht nur für sie, sondern auch für einen Teil des türkischen Offizierskorps unverständlich. Dies wiederum führte dazu, dass zum Empfang eines Teils der Anweisungen und Befehle die wenigen in Deutschland geschulten Offiziere eingesetzt werden mussten. Noch gravierendere Folgen hatte die Entlassung aller christlichen Eisenbahner im Operationsgebiet, die zusammen mit den herbstlichen Regenfällen den Bahntransport fast vollständig lahmlegte. Zu allem Übel saß ein Teil der regulären osmanischen Streitkräfte in Nordafrika fest, wo gerade der Krieg gegen Italien zu Ende war, und das schlecht ausgebaute Schienennetz verhinderte einen schnellen Transport der asiatischen Reserven. Die Aktivitäten der griechischen Kriegsmarine erschwerten zudem den Transport auf dem Seeweg.
Der stärkste und am besten organisierte Gegner des Osmanischen Reiches war Bulgarien, das als einziges Land seine höheren Kader nicht nur im Ausland ausbilden ließ, sondern auch eine eigene Offiziersschule in Sofia unterhielt. Als einziges Land nahm es auch die militärische Schulung seiner Wehrpflichtigen ernst. Der zwei- (Infanterie) bzw. dreijährige (Kavallerie) Wehrdienst erfasste im Prinzip alle Männer, eine bezeichnende Ausnahme galt für Muslime, die sich freikaufen konnten. Auch bei den Reserveübungen gab es keine Schlupflöcher. Ein nicht unwichtiger Faktor für die Qualität der Armee war die allgemeine Bildung. Bulgarien erzielte die vergleichsweise größten Erfolge im Kampf gegen den Analphabetismus. An der Schwelle zum 20. Jahrhundert konnten 72 Prozent der Einwohner weder lesen noch schreiben (in Rumänien waren es 78 Prozent, in Serbien 80 Prozent). Doch Bulgarien investierte am meisten ins Schulwesen. In Serbien kamen auf 1000 Schüler drei Lehrer, in Bulgarien zehn. 80 Prozent der Kinder gingen zur Schule, ein in den anderen Balkanstaaten unerreichter Wert.
Die übrigen Gesellschaften des Balkans waren weder vergleichbar gebildet noch vergleichbar militarisiert. In Griechenland und in Serbien war der Wehrdienst deutlich kürzer als in Bulgarien. Das ständig am Rande des Bankrotts taumelnde Griechenland schulte nur einen Teil der Wehrpflichtigen jedes Jahrgangs, in Serbien war der Wehrdienst semioffiziell gekürzt worden. Vor diesem Hintergrund stellte Bulgarien nicht nur die zahlenmäßig größte und am besten ausgebildete Armee zum Kampf auf, sondern mobilisierte auch die meisten Reservisten, indem es sogar Soldaten im Alter von über 40 Jahren nach Thrakien und Makedonien schickte, während das Gros der dort kämpfenden Serben und Griechen das 30. Lebensjahr nicht überschritt.
Hinsichtlich der Ausrüstung gab es keine großen Unterschiede zwischen den Verbündeten. Alle Armeen verfügten im Ersten Balkankrieg über moderne Waffen: Gewehre und Kavalleriekarabiner (Mannlicher oder Mauser), Maschinengewehre (Maxim) sowie deutsche und französische Geschütze (Schneider-Creusot und Krupp). Der Konkurrenzkampf zwischen den größten Rüstungskonzernen Europas wurde von der internationalen Presse aufmerksam beobachtet. Deutsche und französische Journalisten interessierte die Frage, wessen Geschütze besser seien: die von Bulgaren und Serben eingesetzten französischen oder die vom osmanischen Heer eingesetzten deutschen. Die gesamte Ausstattung der regulären Truppen beider Seiten stand in fast nichts hinter der Ausstattung der westeuropäischen Armeen zurück. Schon zwei Jahre später sollte sie an den Fronten des Ersten Weltkriegs weitere Tests durchlaufen. Weitaus schlechter bewaffnet waren die Reserveeinheiten, die teils noch einschüssige Karabiner mit Schwarzpulver verwendeten (dessen Rauch nach dem Schuss die Position des Schützen verriet). Diese hatten aber nur einen vergleichsweise geringen Anteil am Offensivkrieg, der auf dem Territorium des Gegners geführt wurde.
Ab dem Frühjahr 1912 verdichtete sich die kämpferische Stimmung. Die bulgarische, serbische und griechische Presse stellten plötzlich die bis dahin verbreitete Kritik an den Verbündeten ein und betonten zunehmend die Einheit der Christen und – in Serbien und Bulgarien – Slawen. Der Konflikt in Makedonien wurde nun türkischen Intrigen und der Unmenschlichkeit der Albaner zugeschrieben. Die Nachricht vom Krieg gegen den „ewigen Feind“ wurde in Sofia, Belgrad und Athen begeistert aufgenommen. Der griechische König Georg I. verkündete, man verteidige die Zivilisation. Selbst in Istanbul, wo die Nachricht von einem neuen Krieg kaum Euphorie auslösen konnte, war die Stimmung nicht schlecht:
Auf den Straßen ein buntes Treiben. Fortdauernd sieht man lange Trupps von Männer vorbeiziehen, die sich zu je zweien an der Hand halten, singend durch die Straßen zur Taxim-Kaserne geführt werden, wo man sie einkleidet. In Stambul, auf dem großen Platz vor dem Kriegsministerium ist ein Heerlager eingerichtet; von dort aus marschieren dann die Truppen zum Bahnhof, wo sie verladen werden, um zur Front abzugehen.4
Der osmanische Generalstabschef Nazim Pascha war kein großer Stratege. Wie die meisten Militärs seiner Zeit glaubte er, dass der Vorteil in jeder Lage aufseiten der Angreifenden liege. Also beschlossen die Osmanen als eigentlich Überfallene selbst anzugreifen, wo immer sich die Möglichkeit bot. Doch aufgrund von Transportproblemen, schlechter Organisation und weiten Entfernungen verfügten sie in Europa über höchstens halb so viele Soldaten wie die Gegner. Zudem bestand die Bevölkerung der europäischen Welajets aus Christen, denen man misstraute und die man nicht als Mitbürger behandelte. Die in feindlich gesinnter Umgebung gegen einen überlegenen und entschlossenen Gegner kämpfende Armee sollte ein tragisches Schicksal erleiden.
In Thrakien wurde der Krieg de facto binnen zehn Tagen entschieden. Vom 22. Oktober bis zum 2. November rückten die Bulgaren, nachdem sie einen türkischen Angriffsversuch zurückgeschlagen hatten, auf Istanbul vor und schlugen das osmanische Heer in zwei großen Schlachten bei Kirk Kilisse und Bunarhissar vernichtend. Es fiel Regen, der in Schnee überging, nachts sanken die Temperaturen unter den Gefrierpunkt. Unter diesen Bedingungen erwies sich von der Goltz’ Diagnose als erschreckend richtig. Die Türken leisteten zunächst erbitterten Widerstand, zumal bei Bunarhissar, wo beide Seiten jeweils rund 20.000 Verwundete, Tote und Gefangene verzeichneten. Überall aber wiederholte sich derselbe Verlauf. Nach Tagen blutiger Kämpfe kam eine Nacht, in der die türkische Redif ausruhte und ihre Absicherung vernachlässigte. Die Bulgaren unternahmen auch in der Dunkelheit bewaffnete Ausfälle, die immer wieder Panik auslösten und dazu führten, dass die Redif-Kämpfer massenhaft vom Schlachtfeld flohen. Gemäß der Lieblingstaktik russischer Militärs, mit denen viele bulgarische Offiziere persönliche Kontakte pflegten, griffen sie oft mit dem Bajonett an. Im Kampf mit einem besser geschulten und gut eingegrabenen Gegner wäre der Ausgang höchst ungewiss gewesen. Hier aber saßen müde und demoralisierte Reservisten hinter den Stacheldrahtverhauen. Der Fanatismus der angreifenden Bulgaren machte auf sie einen enormen Eindruck. Gustav von Hochwächter, ein deutscher Offizier im Stab des Kommandierenden Generals des III. Korps, Mahmud Muhtar Pasha, der an den Schlachten bei Kirk Kilisse und Bunarhissar teilnahm, war Augenzeuge der blamablen Niederlagen. Er berichtete von einer Armee, die sich im Grunde selbst besiegte. Es fehlte an kompetenten Offizieren und Unteroffizieren, die es gewagt hätten, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Je näher der Feind war, desto weniger Initiative zeigten sie. Zudem beging man einfache, aber kostspielige Fehler. Beobachter verblüffte die Sturheit, mit der die Türken Geschütze in vorgeschobenen Stellungen positionierten. Jede gelungene bulgarische Attacke bedeutete somit den Verlust nicht nur von Menschen und Terrain, sondern auch von wertvollem Gerät. Die Reservisten hatten keine Stiefel, sie hatten nicht gelernt, Schützengräben auszuheben, es waren sogar Invaliden unter ihnen; Hochwächter begegnete Blinden, die aus Familientradition ihren Vätern in die Armee gefolgt waren. Jeder Ausbruch von kollektiver Panik ging mit einer wilden Kanonade einher. Auf diese Weise verschossen die osmanischen Soldaten sinnlos Munition, die am folgenden Tag nicht ersetzt werden konnte. Die Moral war am Boden, die Bereitschaft, für das Vaterland den Hals hinzuhalten, gering – davon zeugten die häufigsten Verwundungen: Schüsse in Hände und Arme, die die Soldaten absichtlich aus den Gräben hielten. Die Trosse versanken im Morast, die Fuhrleute spannten in Panik die Pferde aus und flohen Richtung Istanbul. Die an die vorderste Front marschierenden Einheiten sahen die zurückgelassene Ausrüstung, Munitionskisten, Geschütze. An die Verwundeten dachte man überhaupt nicht: „Auch der Anblick der verfrorenen nassen Verwundeten ist demoralisierend. Ambulanzen fehlen. Verbandplätze sind nicht da. Selbst kein Wasser, um die Wunden zu waschen.“ Der Rückzug wurde ebenfalls zur Katastrophe: „Alles ist voller Soldaten. Die Straßen sind versperrt durch Wagen und Kanonen, die Bewohner (christliche Bauern) schießen aus den Häusern auf Offiziere. Der Lärm und das Durcheinander sind unbeschreiblich.“5 Während des Rückzugs beschoss die türkische Artillerie nicht selten irrtümlich die eigenen Einheiten. Der Kommandeur des III. Korps wollte das Chaos persönlich unter Kontrolle bringen und trieb die flüchtenden Soldaten in die Schützengräben. Vergeblich. In seinen Erinnerungen konstatiert er verbittert:
Bulgarische Soldaten und Freiwillige bewachen die Überreste einer von den zurückweichenden Türken gesprengten sowie eine neue, provisorische Brücke über die Arda.
In der Kriegsgeschichte findet man zum Vergleiche keinen derartigen Rückzug ohne jeden Grund und keine derartige Flucht. Die Bulgaren hatten ohne jeden Kampf einen großen Sieg erlangt. Die Türken haben, ohne vom Feinde gedrängt zu werden, lediglich durch Regen und grundlose Wege so vom Mißgeschicke betroffen, etwa ein Drittel des Kriegsmaterials im Stiche gelassen; sie flüchteten wie nach einer Niederlage.6
Zu den Bulgaren gesellte sich bald ein weiterer Feind: die Cholera, die vermutlich von Reservisten aus Anatolien eingeschleppt wurde. Die Nässe und der Mangel an sauberem Wasser beschleunigten ihre Ausbreitung. Wie Hochwächter schreibt, sahen Mitte November nur die Fronteinheiten noch halbwegs gesund aus. Das Hinterland war voll von Kranken, um die sich niemand kümmerte:
Am Bahnhof [Hadimköy] konnte man kaum durchkommen. Tausende von hohlwangigen Menschen, mit stieren, brennenden Augen, schleppten sich zu den zwei langen Zügen, und versuchten die Wagen und Dächer zu ersteigen. Auf diesen lagen schon Tote, die dort gestorben waren, und die Glieder hingen an den Wänden herab; selbst zwischen den Wagen lagen sie. Wer noch nicht krank war, mußte es dort werden. Offiziere und Ärzte sah man kaum, sie müssen wohl auch der Seuche zum Opfer gefallen sein.7
Mit den Soldaten flüchtete die muslimische Zivilbevölkerung. Alle wollten nach Istanbul. Die türkische Schriftstellerin und Politaktivistin Halide Edib beobachtete entsetzt die ausgemergelten Ankömmlinge:
Flüchtlinge, die Makedonien in Panik verlassen hatten, füllten die Istanbuler Moscheen. Eine Cholera-Epidemie forderte viele Opfer unter den Immigranten und den Soldaten. Das Elend, das in jenem Winter in Istanbul herrschte, ist unvorstellbar.8
Unterdessen rückten die bulgarischen Truppen auf Istanbul vor. Eine Wiederherstellung des Byzantinischen Reiches unter der Herrschaft des bulgarischen Zaren Ferdinand I. schien mit einem Mal denkbar. Am 6. November wandte sich der Großwesir Kâmil Pascha an die Großmächte und bat um die Entsendung einer Flotte zur Verteidigung Istanbuls gegen die entschlossen „auf Zarigrad“ marschierenden Bulgaren. Die letzte Linie, an der die Türken sie aufhalten konnten, waren die Befestigungen von Çatalca. Sie besetzten den schmalen Streifen zwischen Schwarzem Meer und Marmarameer. Die Bewaffnung folgte den Instruktionen deutscher Experten. Zwar war kurz vor dem Krieg ein Teil der Artillerie in die Festung Edirne verlegt worden, doch auch so war Çatalca eine hervorragende Verteidigungsposition. Dieses Mal war das Schicksal den Türken wohlgesinnt. Je weiter die Bulgaren auf osmanisches Gebiet vordrangen, desto länger wurden ihre Nachschubwege. Der Transport wurde durch dieselben Faktoren behindert, die auch die türkische Armee gelähmt hatten: schlechte Wege, ungünstiges Wetter, Morast. Eine mehrere Hunderttausend Köpfe zählende Armee vor Ort zu verpflegen, war undenkbar. Schon zu Beginn des Feldzugs in Thrakien hatten die Bulgaren ihre Offensive nach jedem Sieg unterbrochen. Statt den fliehenden Türken nachzusetzen, hatten sie gerastet und für Nachschub gesorgt. Die Türken hatten somit nach jeder Niederlage Zeit, ihre zerstreuten Einheiten zu sammeln und zu ordnen. Anfangs konnten die Bulgaren auf ein recht effektives System von Feldlazaretten zurückgreifen, ihre Verwundeten brachten sie in die Krankenhäuser der nächstgelegenen Städte. Große Hilfe leisteten freiwillige Ärzte aus Böhmen und Mähren, die nach einem Appell ihres Berufsverbandes in Národní Politika ihren „slawischen Brüdern“ zu Hilfe geeilt waren. Nach einem Monat Kampf und blitzartigen Fortschritten der Offensive in Thrakien stieß freilich auch das bulgarische Gesundheitssystem an seine Grenzen. Das Fehlen von rascher ärztlicher Hilfe vor Ort war umso bedrohlicher, als die bulgarischen Soldaten kein persönliches Verbandsmaterial besaßen. Das verringerte die Überlebenschancen der Verwundeten, bevor sie ins Lazarett kamen. Den entscheidenden Schlag versetzte der bulgarischen Offensive aber die Cholera, die sich ausgerechnet in den Stellungen vor Çatalca unter den Soldaten epidemieartig ausbreitete.
Bulgarischer Sanitätszug am Bahnhof in Stara Sagora kurz vor dem Aufbruch an die Front.
Auf paradoxe Weise profitierten die Türken auch vom unerwarteten Erfolg der bulgarischen Offensive. Die leichten Siege stärkten die bulgarischen Generäle in der Überzeugung, dass ein entschlossener Bajonettangriff jede Schlacht entscheiden könne. Radko Dimitriew, der die Armee bei Çatalca angeführt hatte und vom ungeduldigen Ferdinand I. angetrieben wurde, unterschätzte die Entschlossenheit und die Vorbereitungen der Türken. Der von der französischen Regierung als Beobachter in den bulgarischen Stab entsandte polnische Ingenieur Józef Lipkowski benannte schonungslos die Fehler der Bulgaren:
Um die Stellung schnellstmöglich im Sturm zu nehmen, hatte man den Artillerieangriff nicht geplant. Die bulgarische Artillerie beschoss monoton die gesamte türkische Front vom Deskos-See bis zur Bucht von Büyükçekmece. Nicht ein einziges Mal konzentrierte man das Feuer auf ein bestimmtes Ziel. Man ließ die besten Regimenter angreifen. […] Das Ergebnis war, dass diese Regimenter, von beiden Seiten unter Beschuss, sich – nachdem sie die Hälfte der Männer verloren hatten – zurückziehen mussten, weil sie weder von der Artillerie noch von sonst einer Einheit unterstützt wurden […]. Und als die Reste des Regiments zu den Ihren zurückkehrten, hielt die bulgarische Artillerie sie für Feinde und gab ihnen den Rest. Aus dem ganzen Regiment kamen nicht mehr als ein paar Dutzend Soldaten zurück. Überhaupt kämpfte man vor Çatalca auf der Breite der gesamten Front und unternahm keinen einzigen Versuch, irgendwo die türkische Linie zu durchbrechen.9
Dimitriews Taktik hatte fatale Folgen. Bei den Frontalangriffen wurden mehr als 10.000 Soldaten getötet oder verwundet, darunter besonders viele junge, qualifizierte Offiziere. Um diesen Preis drang man lediglich einige Male kurz in die türkischen Stellungen ein. Nachdem der schnelle Sieg ausblieb, musste selbst ein so offensiv eingestellter Befehlshaber wie Dimitriew seine Niederlage einsehen. Bald überstieg die Anzahl der Cholerakranken die der Verwundeten und Gefallenen um mehr als das Doppelte. Letztlich bewog die drohende Massenepidemie im Heer die Bulgaren dazu, den von der Türkei vorgeschlagenen Waffenstillstand anzunehmen, der schon am 12. November beschlossen wurde. Die Kämpfe in Thrakien wurden Anfang Dezember eingestellt.
Während in Thrakien noch die Schlacht um Kirk Kilisse andauerte, entschied sich in Makedonien der Ausgang des Feldzugs. Auch hier versuchten die unterlegenen türkischen Kräfte die Initiative zu übernehmen und attackierten die anrückenden, klar überlegenen Serben. Bei Kumanovo kam es zur Schlacht, deren Verlauf sich kaum vom Geschehen an der Ostfront unterschied. Nach einem langen Regentag mit erbitterten Kämpfen gingen die Serben am 24. Oktober kurz vor Tagesanbruch zum Gegenangriff über und zwangen die überraschten Türken zum Rückzug. Auch hier wurde die osmanische Armee vor allem deshalb nicht vollständig zerschlagen, weil die serbische Artillerie auf den desolaten Wegen nicht schnell genug nachrücken konnte. Nach der Schlacht von Kumanovo besetzten die Invasoren sukzessive den nördlichen Teil Makedoniens. Sie drangen auch auf von Albanern bewohntes Territorium vor und besetzten Pristina, Durrës und Lezha. Außerdem unterstützten sie die vor Shkodra stecken gebliebenen montenegrinischen Truppen. In den eroberten Gebieten wurden sofort alle Moscheen geschlossen und die Muslime zwangsweise zur Orthodoxie bekehrt. Als Folge kämpften Serben bald nicht mehr nur gegen die osmanische Armee, sondern auch gegen eine wachsende Schar albanischer Freiwilliger. Im Ersten Weltkrieg sollten sich die serbischen Grausamkeiten auf tragische Weise rächen. Als 1915 die geschlagene serbische Armee sich in einem fürchterlichen Wintermarsch an die Adria durchzukämpfen versuchte, zeigten die Albaner kein Erbarmen.
Während das türkische Heer in Makedonien den serbischen und montenegrinischen Angreifern die Stirn bot, zog in deren Rücken die griechische Armee auf. Die westeuropäischen Beobachter der Kämpfe auf dem Balkan waren voller Anerkennung für die griechische Offensivstrategie. Die Griechen vermieden die Fehler der Bulgaren und der Serben, sie verteilten ihre Kräfte nicht und folgten konsequent dem zuvor entworfenen Plan. Ihr Ziel war die Eroberung von Thessaloniki, der größten Stadt der Region, und Ioannina, das sie schnell einkreisten, aber lange nicht erobern konnten. Besonders im ersten Fall war Eile geboten. Griechenland hatte keines der Abkommen zur Verteilung eventueller Eroberungen unterzeichnet, man wollte also möglichst rasch möglichst große Gebiete besetzen, um die eigene Verhandlungsposition nach Kriegsende zu verbessern. Es begann ein Wettlauf der Verbündeten. Zum Glück für Griechenland widersetzte sich der serbische Generalstabschef Radomir Putnik den Plänen einiger Politiker, die auch serbische Kräfte nach Thessaloniki schicken wollten. Allerdings gelang es ihm nicht, die Bulgaren daran zu hindern. Innerhalb der serbischen Armee in Makedonien befand sich eine bulgarische Division, die den Befehl zum unverzüglichen Marsch auf Thessaloniki erhielt. Die Griechen waren jedoch schneller. Am 26. Oktober kapitulierte Tahsin Pasha vor dem griechischen Thronfolger Konstantin. Der griechische Offizier Filippos Dragoumis notierte an diesem Tag:
Die Kapitulation Tahsin Paschas und seiner 35.000 Soldaten [in Wirklichkeit waren es rund 10.000 weniger] erfreute mich überhaupt nicht. Eine tiefere Sorge schnürt mir die Brust zusammen und lässt mich pessimistisch in die Zukunft schauen. Die Bulgaren sind anscheinend nahe und ich fürchte, wir werden Schwierigkeiten mit unseren „geliebten Alliierten“ […] bekommen.10
Die „geliebten Alliierten“ waren fest entschlossen. Sie erkannten die türkische Kapitulation vor den Griechen nicht an und setzten ihren Marsch auf Thessaloniki fort. Dort forderten sie von Tahsin Pascha die Übergabe der türkischen Garnison. Er soll geantwortet haben, er habe leider nur über ein Thessaloniki verfügt und dieses schon den Griechen übergeben.
Als der Winter heraufzog, konzentrierten sich die Kampfhandlungen an drei Punkten. Die Griechen belagerten Ioannina, Montenegriner und Serben Shkodra und die Bulgaren Edirne, die größte türkische Festung und eine der gewaltigsten Befestigungen Europas, deren besondere Bedeutung darin lag, dass die Türken von dort aus die Bahnstrecke nach Istanbul (dieselbe, auf der seinerzeit der berühmte Orient-Express verkehrte) kontrollierten. Die Belagerung dauerte – mit einer Pause für einen Waffenstillstand und erfolglose türkisch-serbische und türkisch-bulgarische Verhandlungen im Dezember und Januar – bis ins Frühjahr 1913. Trotz massiver Fluchtbewegungen waren noch viele Zivilisten in der Stadt, darunter die Konsuln der europäischen Großmächte. Der Ausfall des Transportwesens und das Tempo der bulgarischen Offensive hatten eine Evakuierung verhindert. Das hatte fatale Auswirkungen auf die Situation der Verteidiger. Es musste nicht nur das Heer verpflegt werden, sondern auch die Bevölkerung. Als Erstes ging das Salz aus. Eine Zeit lang konnten ansässige Chemiker einen Ersatz von gleichem Geschmack, wenngleich gelblicher Färbung herstellen, doch die zur Herstellung notwendigen Rohstoffe waren bald verbraucht. Schon im Februar 1913 wurden die Rationen der Soldaten auf 450 Gramm schlechten Brots reduziert. Der Schwarzmarkt blühte. Das Belagerungstagebuch des türkischen Offiziers Hafiz Rakim Ertür schildert die aussichtslose Lage der Verteidiger am Vortag der Kapitulation:
Die armen Soldaten waren zu Skeletten abgemagert. Sie waren buchstäblich zu schwach zum Laufen und hockten in kleinen Gruppen herum, von Schnee bedeckt. Ich glaube nicht, dass ein anderes Volk solche Bedingungen ertragen hätte. Natürlich schwelgten auch die Belagerer nicht im Luxus. Doch die meisten ihrer Soldaten hatten ein warmes Dach über dem Kopf und ordentliche Verpflegung. Unter dem Einfluss des eisigen Winters und der Hungerkrämpfe bekam die Haut unserer Soldaten einen ungesunden dunklen Ton. Nach Einbruch der Dämmerung gingen manche von Tür zu Tür und baten um ein Stück Brot, freilich vergebens. Die Menschen, bei denen sie anklopften, gingen selbst hungrig zu Bett.11
Erging es den Belagerern wirklich so viel besser? Sicher insofern, als sie nicht von der Außenwelt abgeschnitten waren. Doch das Terrain um Edirne war baumlos, die Dörfer waren während der Kampfhandlungen niedergebrannt worden. Aller Proviant musste aus Bulgarien und Serbien herbeigeschafft werden. Vor Ort mangelte es an Trinkwasser, im Februar wüteten Schneestürme und unter den Soldaten grassierten Typhus und Cholera. Die entschlossenen Bulgaren, wiewohl hungrig und durchgefroren, hielten die einstige Hauptstadt des Osmanischen Reiches unter Dauerbeschuss. Die Serben unterstützten ihre Verbündeten mit einigen Batterien schwerer Artillerie. Dank christlicher Informanten – Deserteuren der türkischen Armee und Flüchtlingen – waren die Belagerer gut über die Organisation der Verteidigung orientiert. Sie verfügten zudem über Lufterkennung und flogen sogar Angriffe auf die Stadt. Die von den Piloten per Hand abgeworfenen Bomben richteten keine großen Schäden an, entscheidend war die psychologische Wirkung. Die Modernität der bulgarischen Armee musste umso größeren Eindruck machen, als die Bombardierung Edirnes der erste Luftangriff in der Geschichte Europas war. Im Februar musste eines der bulgarischen Flugzeuge auf dem Stadtgebiet notlanden. Die Bevölkerung hieß den merkwürdigen Vogel begeistert willkommen, weil sie ihn für eine türkische Maschine hielt. Die Aufklärung des Irrtums wirkte sicher zutiefst demoralisierend auf die Belagerten.
Triumphaler Einzug der bulgarischen Kavallerie ins eroberte Edirne.
Für die unbarmherzig geschlagenen Türken gewann die heroische Verteidigung von Edirne große psychologische Bedeutung. Im Juni führten die Jungtürken einen weiteren erfolgreichen Staatsstreich aus. Sein einziger Programmpunkt war die Zurückweisung der bulgarischen Territorialforderungen, das heißt der Abtretung Edirnes. Nach dem Bruch des Waffenstillstands unternahm man einen Befreiungsversuch. Wieder griffen die Türken frontal an. Während des Sturms auf die bulgarischen Schützengräben bei Çatalca erlitten sie ungeheure Verluste, ohne nennenswerte Erfolge zu erringen. In derselben Zeit attackierten die Bulgaren Edirne, wobei sie über 10.000 Soldaten verloren, die Stadt aber endgültig eroberten. Am 26. März kapitulierte Edirne, das alle Lebensmittel aufgebraucht und durch einen bulgarischen Treffer ein Waffen- und Munitionslager verloren hatte. Kurz darauf kapitulierte Ioannina, einen Monat später auch Shkodra.