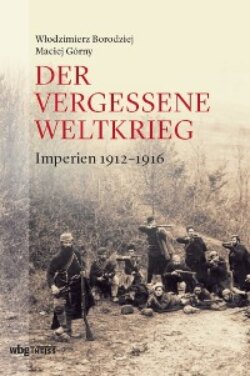Читать книгу Der vergessene Weltkrieg - Maciej Górny - Страница 6
Einleitung
ОглавлениеWer kennt den Ort Przasnysz (dt. Praschnitz)? Wohl nur wenige. 1914 lag die masowische Provinzstadt am südlichen Rand Ostpreußens an einem der Hauptverkehrswege zwischen Warschau und dem ostpreußischen Kernland.
Im November/Dezember 1914 sowie im Februar und Juli 1915 trafen hier in drei großen Schlachten Hunderttausende Russen und Deutsche aufeinander. In der Julischlacht gab es auf deutscher Seite 16.000, auf russischer Seite 40.000 Tote und Verwundete. Die Gesamtzahl der Toten, Verwundeten und Vermissten ist nicht bekannt, doch sie liegt sicher bei weit über 100.000. Warum also kennt kaum jemand Przasnysz?
Auf diese Frage gibt es drei Antworten und jede von ihnen ist ein Grund für das Entstehen dieses Buches.
Anders als es in Mittel- und Südosteuropa oder in Russland den Anschein haben mag, ist der Erste Weltkrieg nur östlich und südöstlich von Deutschland in Vergessenheit geraten. In Deutschland erinnern vielerorts Gedenktafeln an die Gefallenen und Vermissten des jeweiligen Dorfes oder Stadtteils und noch immer sind – wiewohl seltener – entsprechende Symbolwörter, Romantitel oder geografische Namen im Umlauf. Wie so oft in seiner Geschichte bildet Deutschland damit eine Übergangszone zwischen Ost und West, in diesem Fall zwischen dem Vergessen und dem Erinnern des Ersten Weltkriegs, der in Frankreich und Großbritannien als „Großer Krieg“ im kollektiven Gedächtnis bewahrt wird – bis heute ist der 11. November dort ein wichtiger Feier- und Gedenktag. Wer die Museen in Ypern oder Péronne besucht hat, weiß warum. Dort starben junge Belgier, Briten, Franzosen und Deutsche. Weit entfernt, bei Gallipoli, wurde das australisch-neuseeländische Armeekorps aufgerieben. Der Tag seiner Landung – der 25. April (ANZAC-Day) – ist in beiden ehemaligen britischen Kolonien inoffizieller Nationalfeiertag. Es handelt sich um europäische, eigentlich globale Gedächtnisorte, die nicht durch den Zweiten Weltkrieg verdrängt wurden. Ganz anders – zurück in die Übergangszone – verhält es sich mit dem kleinen Museum im slowenischen Kobarid (dt. Karfreit, it. Caporetto), das an eines der größten Gemetzel des Ersten Weltkriegs erinnert, die zwölf Schlachten am Isonzo, in denen 29 Monate lang fast ununterbrochen gekämpft wurde. Kaum jemand weiß davon, doch immerhin gibt es das Museum. 2013 wurde es von knapp 50.000 Menschen besucht (Tendenz fallend), das Museum in Ypern zählte im selben Jahr fast 300.000 Besucher (Tendenz steigend).
Von den größten Schlachten der Ostfront und von den Frontlinien des Grabenkriegs auf dem heutigen Gebiet Polens, der Ukraine, Weißrusslands, Litauens, Lettlands und der Russländischen Föderation zeugen meist nur die Soldatenfriedhöfe (sofern sie erhalten blieben). Hier zeigt sich ein grundlegender Unterschied: Für die Bewohner Ostmitteleuropas ist der Erste Weltkrieg Vorgeschichte ohne Bezug zur Gegenwart. Für Franzosen und Briten ist er Teil ihrer kollektiven Identität, sie begehen den 11. November, besuchen Museen und lesen einschlägige Bücher. Für einen Ostmitteleuropäer hingegen klingt es wie ein bizarres Missverständnis, wenn der amerikanische Historiker und Diplomat George F. Kennan den Ersten Weltkrieg als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet.
Diese Diskrepanz im kollektiven Gedächtnis spiegelt sich in der Geschichtsschreibung. Wir kommentieren unsere Lektüren am Ende des Bandes, doch schon jetzt ist festzuhalten: Man wusste zwischen 1914 und 1917 in Europa sehr wohl von der Ostfront. Auch in der Zwischenkriegszeit ging dieses Wissen nicht ganz verloren. In Österreich kannte man eine Festung mit dem unaussprechlichen Namen Przemyśl, in Deutschland kannte man den Namen Tannenberg und überall erinnerte man sich an Hunger und Lebensmittelkarten. Erst in der nachfolgenden Generation verschwand der Krieg im Osten aus dem Bewusstsein der Leser und der Historiker. Er wurde zur „unbekannten Front“ in einem entlegenen Teil des Kontinents, wo sich – außer den russischen Revolutionen – nichts Kriegsentscheidendes zugetragen hatte. In der westlichen Geschichtsschreibung spielte die russische Front – ganz zu schweigen von der serbischen, rumänischen oder griechischen – jahrzehntelang keine Rolle. Als in den 1990er Jahren eine Blütezeit der Forschung zum Ersten Weltkrieg anbrach, galt der Osten weiter als etwas Exotisches, Marginales und wurde weitestgehend ignoriert. In den letzten Jahren rückte er ins Interesse einer recht großen Gruppe hauptsächlich amerikanischer und deutscher Historiker, doch noch immer reicht die Dichte der Untersuchungen bei Weitem nicht an die Forschung zum Kriegsverlauf im Westen heran. In Polen, dem nach Russland zweitgrößten Land der Region, lassen sich – wir übertreiben kaum – die am Ersten Weltkrieg interessierten Forscher sowie die in den letzten vierzig Jahren erschienenen Bücher zum Thema jeweils an den Fingern zweier Hände abzählen. Eine signifikante Ausnahme bilden Tagebücher und Erinnerungen, die meist zwischen 1914 und 1939 entstanden, oft in der Zwischenkriegszeit erschienen und dann bis 2014 aus diversen Gründen nicht salonfähig waren.
Die Zensur als Instrument der sozialistischen Geschichtspolitik führt uns zu einem weiteren für das Entstehen dieses Buches relevanten Aspekt. Schon in der Zwischenkriegszeit tendierten die Deutungen der jüngsten Vergangenheit in eine ahistorische Richtung. Zwar wurden die Ereignisse bis Herbst 1918 unter anderem von Militärhistorikern beschrieben, doch folgten die Autoren meist der vermeintlichen Logik der Geschichte (und auch dem Glauben an die Unfehlbarkeit ihrer Akteure), die von Beginn an auf den finalen Triumph Rumäniens, auf die Gründung des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen sowie auf die Erfüllung der nationalstaatlichen Hoffnungen der Finnen, Esten, Letten, Litauer, Polen, Tschechen und Slowaken hinausgelaufen sei. Schon vor 1939 galt also der Erste Weltkrieg in Mitteleuropa als eine Art überlanger Prolog zum ersten Akt der nationalstaatlichen Geschichte. Die Kinder lernten in der Schule die Namen der Unabhängigkeitshelden, obwohl ihnen außerhalb des Klassenzimmers meist nur Veteranen der imperialen Armeen begegneten. Die tschechoslowakischen und polnischen Legionäre hatten als kleine elitäre Gruppe unverhältnismäßig großen Einfluss nicht nur auf die Politik, sondern auch auf die Darstellung der jüngsten Vergangenheit. Mitte der 1930er Jahre waren 80 Prozent der polnischen Kriegsinvaliden ehemalige russische, österreichisch-ungarische und deutsche Soldaten, nur 20 Prozent waren frühere Legionäre oder Teilnehmer des polnischsowjetischen Krieges. Hinsichtlich der Präsenz beider Gruppen im öffentlichen Raum waren die Proportionen wohl eher umgekehrt.1
Nachdem 1945 die UdSSR – unmittelbar oder mittelbar – die Herrschaft über Ostmitteleuropa und einen großen Teil Südosteuropas übernommen hatte, wurden der Erste Weltkrieg und das Jahr 1918 dem Vergessen anheimgegeben. Dies war eine Aufgabe der institutionalisierten Zensur, die an die Stelle der Selbstzensur der Zwischenkriegszeit getreten war. Der Krieg galt als Episode vor der Oktoberrevolution, das Jahr 1918 als Betriebsunfall der Geschichte, weil ja in Bukarest, Riga, Warschau oder – vor allem – Prag schon damals die Kommunisten die Macht hätten übernehmen müssen. Dass es nicht so kam, erklärte man mit dem verderblichen Einfluss nationalistischer Eliten, die das Streben nach Unabhängigkeit geweckt und genutzt hätten, um das Proletariat und dessen Forderungen an den Rand zu drängen. In dieser Sichtweise verengte sich das Bild des Ersten Weltkriegs auf die Geschichte des Verrats der nichtkommunistischen politischen Formationen – reformistischen und klerikalen, faschistischen und nationalistischen, bourgeoisen und bäuerlichen – an der Arbeiterklasse, der den Aufbau des Sozialismus westlich der Sowjetunion auf fatale Weise behindert habe.
1989 gewann das Jahr 1918 die Bedeutung zurück, die es vor dem Zweiten Weltkrieg hatte, doch der Prozess des Wiedererinnerns umfasste – noch offensichtlicher als in der Zwischenkriegszeit – nicht den ganzen Krieg. Im Gegenteil: Je stärker die postkommunistischen Demokratien ihre Identität auf die Tradition der Vorkriegseigenstaatlichkeit gründeten, desto nebensächlicher wurde alles, was nicht zu der Erzählung des heldenhaften Volkes passte, das vier Jahre lang konsequent auf die Wiedererrichtung oder Schaffung eines eigenen Nationalstaats hingearbeitet habe.
Doch das Vergessen des Ersten Weltkriegs ist nicht nur durch politische Manipulationen zu erklären. Es wäre kaum denkbar ohne einen weiteren Albtraum: den Zweiten Weltkrieg, der für die meisten Länder der Region ein noch tieferes Trauma darstellte. Angesichts des zwischen 1941 und 1945 im besetzten Jugoslawien vergossenen Bluts verblasste die Ermordung serbischer Bauern in den Jahren 1914 und 1915; der Holocaust verdrängte die Erinnerung an die Pogrome des Ersten Weltkriegs. Den Griechen müssen schon nach dem ersten Besatzungswinter (1941/42) die Erlebnisse der Jahre 1914–18 als ferne Vergangenheit erschienen sein.
Es gibt viele Orte wie Przasnysz. Weil niemand sie kennt, kann aus ihnen kein kollektives regionales Gedächtnis erwachsen. Przemyśl und Tannenberg sind heutigen österreichischen oder deutschen Abiturienten kein Begriff mehr, Franzosen und Russen waren sie es nie. Polnische Abiturienten dagegen wissen nicht, dass die wichtigsten Schlachten der Ostfront in den Jahren 1914/15 fast ausschließlich auf dem Gebiet des heutigen Polen stattfanden.
Vor diesem Hintergrund entstand die Idee zu einem Buch, das die Erinnerung an den Albtraum wachruft, den der Erste Weltkrieg von Riga bis Skopje darstellte. Russen, Deutsche, Finnen, Esten, Letten, Litauer, Juden, Polen, Belarussen und Ukrainer kämpften in Uniformen der zaristischen Armee, Deutsche und Polen in preußischen Uniformen. In den österreichisch-ungarischen Divisionen kämpften Slowenen, Kroaten, Bosnier, Serben, Österreicher, Deutschböhmen, Tschechen, Mähren, Schlesier, Polen, Juden, Ukrainer, Slowaken, Ungarn und Rumänen.
Es war unser Krieg.
Entgegen den Legenden waren die Kämpfe an der Ostfront nicht weniger blutig als im Westen. Hier wurden die meisten Gefangenen gemacht und die Sterblichkeitsrate in den Lagern war die höchste. Die Soldaten der Imperien und Nationalstaaten, die sich hier gegenseitig töteten, unterschieden sich teils nur durch die Uniform, nicht durch Sprache, Religion oder Ethnie. Wir schildern auch Fälle von Heldentum und Tapferkeit, doch vor allem beschreiben wir Situationen und Ereignisse, die in der patriotischen Sichtweise ausgeblendet werden – die Soldaten starben sinnlos, sie glaubten nicht, ihr Leben für eine gerechte Sache zu opfern. Sie zogen in den Kampf, weil Oberleutnant oder Korporal es befahlen (diese hatten übrigens, statistisch gesehen, schlechtere Überlebenschancen als ihre Untergebenen).
Unsere Darstellung des Schicksals dieser Männer ist durch Diskussionen inspiriert, die vor zwanzig Jahren insbesondere die französische Geschichtsschreibung prägten. Damals fragten Historiker und Psychologen, wie die Soldaten die Hölle ertragen konnten, in der sie sich ab Herbst 1914 befanden, wie sie den für heutige Europäer unvorstellbaren Stress bewältigten. Die Standardantwort unterstrich die Bedeutung des Nationalstaates und der nationalen Identität: Der Gemeinschaftsgedanke habe das Durchhalten in den Schützengräben ermöglicht. Das erklärte zugleich den Zerfall Russlands, wo die nationale Identität nur punktuell und oberflächlich verwurzelt war, und mehr noch das Auseinanderbrechen Österreich-Ungarns, wo letztlich die Loyalität zur eigenen ethnischen Gruppe das Gefühl der Zugehörigkeit zu einem transnationalen Imperium übertrumpfte. Dem widersprachen die Revisionisten aus dem Umkreis des Weltkriegsmuseums in Péronne: Auch die französischen Soldaten, die im Dienst eines modernen Nationalstaates standen, hätten sofort die Waffen niedergelegt, wären sie nicht zum Kämpfen gezwungen worden. Dieser Streit dauert bis heute an. Gegenwärtig dominiert die Auffassung, die Wahrheit liege – bisweilen – in der Mitte. Am ehesten trifft wohl der Begriff endurance, auf Deutsch so viel wie ‚Ertragen, Erdulden‘ oder ‚Aushalten‘, die Wirklichkeit der Schützengräben. An allen Fronten gab es begeisterte Soldaten, andere wurden von Vorgesetzten, Gendarmerie und Feldgerichten terrorisiert. Die meisten aber fanden sich einfach mit der neuen Lebenssituation ab, weil sie keine Wahl hatten. Sie taten mehr oder weniger gewissenhaft ihre Pflicht – ohne Begeisterung, aber auch ohne unmittelbaren Zwang.2
Anders als nach 1918 viele Historiker behaupteten, starben, streikten, erkrankten und hungerten auch die Zivilisten nicht für die jeweilige nationale Sache, sondern sie taten es, weil Nahrung, Brennstoffe, Hygienemittel und Medikamente fehlten. Dies war meist keine Folge einer blutsaugerischen Besatzungspolitik, Mangel und Gefahr verteilten sich verblüffend gleichmäßig auf die Bevölkerung der eroberten Gebiete und die Bürger im Hinterland der Front. Auch diese Tatsache geriet in Vergessenheit, als nach Kriegsende die nationalen Geschichtsschreibungen das besondere Ausmaß der eigenen Verluste infolge der zerstörerischen, räuberischen und rücksichtslosen Politik der Besatzer herauszustellen versuchten.
Wir operieren vorsichtig mit Zahlen. Die Statistiken sind oft widersprüchlich. Viele in der Literatur anzutreffende Daten sind eindeutig falsch, werden aber immer wieder zitiert, weil den Autoren der Wille oder – seltener – die Möglichkeit zur Überprüfung fehlt. In manchen Fällen sind wir auf Schätzungen angewiesen, weil verlässliche zeitgenössische Angaben fehlen. Andere Zahlen dienten von vornherein nicht der Information, sondern der Propaganda. Wir arbeiten mit den glaubwürdigsten – und wo möglich verifizierten – Daten, die wir in ihrem jeweiligen Kontext präsentieren, ohne den sie oft nicht verständlich wären.
Seit einiger Zeit ist es Usus geworden, den Ersten Weltkrieg als totalen Krieg zu bezeichnen. Man hat zuweilen den paradoxen Eindruck, als sollten die Jahre 1914–18 durch den Nachweis ihres „totalen“ Charakters in den Rang einer ebenso großen Katastrophe wie die Zeit von 1939–45 erhoben werden. Wir halten es nicht für nötig, unseren Untersuchungsgegenstand aufzuwerten. Deshalb beziehen wir uns nicht unmittelbar auf den Begriff des Totalen. Genauso wenig möchten wir aber dem Leser eine allgemein gefasste Definition vorenthalten: Der totale Krieg übertrifft in Intensität und geografischer Reichweite alle vorangegangenen Kriege. Die Beteiligten fühlen sich nicht an Moral, Gewohnheits- oder Völkerrecht gebunden; sie folgen ihrem Hass, der ihnen zur Legitimation von Zwangsherrschaft und Verbrechen bis dahin unvorstellbaren Ausmaßes dient. Die Grenze zwischen Kombattanten und Zivilbevölkerung verschwimmt. Die Arbeitskraft der Zivilisten wird rücksichtslos ausgebeutet, sie liefern und produzieren kriegswichtige Rohstoffe und Waren. Nicht nur in dieser Hinsicht gleicht ihr Schicksal dem der Rekruten, die ebenfalls bis aufs Letzte ausgepresst werden: Auch die Zivilbevölkerung wird Kriegsgefahren ausgesetzt, wann immer das Militär es für notwendig hält. Ihr drohen Bomben und Artilleriebeschuss, Repressionen bis hin zur Todesstrafe, Hunger und Epidemien. Es kommt zu einer weitgehenden Angleichung des Risikos – anders gesagt: der Überlebenschancen – von Soldaten und Zivilisten. Zudem soll im totalen Krieg der Gegner nicht besiegt, sondern vernichtet werden. Der Leser mag selbst beurteilen, ob dies auf unsere Geschichte der Ostfronten und ihres Hinterlandes in Ost und West zutrifft.
Vorab eine Klarstellung: Dieses Buch ist kein klassisches militärhistorisches Werk. Wir suchen einen Mittelweg zwischen – nicht unbedingt traditionell verstandener – Militär- und Sozialgeschichte und wollen gleichzeitig die Entwicklung von – in einem weiten Sinne – Kultur und Wissenschaft während der Kriegsjahre nachvollziehen. Die Geschichte der ersten Kriegsjahre erzählen wir weitgehend chronologisch, doch mehr als die Abfolge der Ereignisse interessieren uns Prozesse und Einstellungen. Von ihnen handeln die ersten beiden Kapitel, die von der Geschehenschronologie abweichen. Im Krieg töten und leiden Menschen und jedes Erlebnis verändert sowohl sie selbst als auch ihre Weltsicht. Uns interessiert, wie unsere Urgroßväter und Urgroßmütter den Krieg erlebten und wie der Krieg oder Ereignisse jenseits der Kampfzonen sie prägten. Manchmal hatten wir den Eindruck, über völlig neue – oder besser: vergessene – Dinge zu schreiben. Wo immer es möglich ist, zitieren wir Zeitzeugen und handelnde Personen; diese Stimmen stehen jeweils exemplarisch für die Erfahrung einer Generation, sozialen Gruppe, kulturellen oder nationalen Gemeinschaft. Wir wollen zeigen, dass man den Krieg jahrelang als sinnlos empfand, als Albtraum oder gar Apokalypse. Aus dieser Perspektive spielt es keine Rolle, dass 1918 eine unvorhergesehene Pointe den Leiden und Entsagungen einen Sinn verlieh. Nicht zuletzt diese Pointe führte ja auch zur Verfälschung der Erinnerung an den Krieg, gegen die sich unser Buch richtet.
Auch die Schwerpunkte und der Zeitrahmen unserer Erzählung weichen von traditionellen Darstellungen ab. Wir befassen uns nicht mit der Geschichte der internationalen Beziehungen. Warum nicht? Nehmen wir das spektakulärste Beispiel. Es gibt Hunderte Arbeiten über die Julikrise 1914. Die meisten davon führen den Leser in die Irre, indem sie ihm einreden, der Krieg sei unvermeidlich gewesen. Die Marxisten sahen die Ursache in Konflikten, die – angefacht von der Habgier, Selbstsucht und Furcht (vor der Arbeiterbewegung) der imperialen Wirtschafts- und Finanzeliten – den Imperialismus zerrissen. In einer anderen, lange maßgeblichen Deutung war das deutsche Streben nach globaler Hegemonie (dem „Platz an der Sonne“) der entscheidende Faktor. Manche Historiker suchten die Gründe – und damit die Schuld – im ewigen russischen Traum von der Eroberung Konstantinopels oder im Wiener Streben nach der Herrschaft über den Westbalkan. Andere vertraten die Auffassung, Serbien habe den Kriegsausbruch bewusst provoziert. Jede dieser Alleinschuldtheorien lässt sich mit Dutzenden, manchmal auch Tausenden Quellen belegen, darunter solche vom Juli 1914, auf die sich die historischen Darstellungen dieser Wochen stützten. Keine von ihnen hält eingehender Kritik stand. Keine von ihnen versucht auch nur, den Zusammenhang zwischen Vorgeschichte und Verlauf des Krieges zu erklären. Denn ein solcher Zusammenhang existiert nicht und aus diesem Grunde sind die Julikrise und andere diplomatische Ereignisse für unsere Darstellung des Ersten Weltkriegs wenig relevant.
Den Zeitrahmen der zwei Bände bilden die Jahre 1912–23, also die Zeit von den Balkankriegen bis zum Vertrag von Lausanne. Das Hauptaugenmerk liegt auf den Jahren 1914–18, doch der Konflikt zwischen Osmanischem Reich, Serbien, Montenegro, Griechenland, Bulgarien und Rumänien ist aus unserer Sicht als Prolog von größerer Bedeutung als das diplomatische Spiel des Jahres 1914. Und natürlich endete der Krieg in Ostmitteleuropa weder mit dem Waffenstillstand vom November 1918 noch mit dem Versailler Vertrag oder den anderen „Vorortverträgen“ der Jahre 1919–20. Unter anderem deshalb ist er in den nationalen Gedächtnissen nicht mehr präsent, weil nach 1918 für Russen, Balten, Ungarn, Ukrainer, Polen, Griechen und Türken Dinge geschahen, die für die Zwischenkriegszeit wesentlich prägender waren als Gorlice-Tarnów oder Gallipoli. Die Einteilung der Bände in die Zeit bis zum Ende des Rumänien-Feldzugs und die Jahre danach ist – wie ihre Betitelung – natürlich bis zu einem gewissen Grad willkürlich, aber keineswegs ganz unbegründet: Bis Ende 1916 erlebten die Imperien schwere Erschütterungen, bleiben aber die bestimmenden Akteure. Die Mittelmächte waren – zumindest im Osten – sogar dem Sieg nahe. 1917 zerfiel das erste östliche Imperium, neue Akteure treten auf die Bildfläche.
Einer der Verfasser hält Jaroslav Hašeks Abenteuer des guten Soldaten Švejk für das beste literarische Werk zum Ersten Weltkrieg im Osten, der andere Karl Kraus’ Die letzten Tage der Menschheit. Diese Vorlieben sind für die Konzeption des vorliegenden Bandes nicht ganz ohne Belang. Švejk und Die letzten Tage entstammen verschiedenen Nationalkulturen, gehören aber beide zum Erbe der Donaumonarchie. Wir bemühen uns, die Imperien im nördlichen Teil Ostmitteleuropas möglichst gleich zu behandeln (hinsichtlich der Hohen Pforte haben wir weder diesen Anspruch noch die Möglichkeiten), doch im Mittelpunkt unseres Interesses steht die Donaumonarchie. Dort kristallisiert sich über Jahrzehnte das Problem eines Vielvölkerstaats, der den Primat der transnationalen imperialen Idee über die wachsenden nationalen Ambitionen seiner Völker wahren will. Hašek und Kraus sind sich dieser Spannung bewusst, wenngleich ihre Werke nicht aus diesem, sondern aus einem entgegengesetzten Grund ins europäische Kulturerbe eingingen. Bei beiden Autoren tragen die Bestialitäten des Ersten Weltkriegs zwar oft ein ethnisches Gesicht, doch geht es ihnen nicht um die Darstellung von nationalen Charakteren. Beide Bücher handeln vom Albtraum unseres Krieges, des vergessenen Weltkriegs im Osten, und die gegensätzlichen Perspektiven – die deutsch-österreichische und die tschechische, die Sicht der Hauptstadt des Imperiums und die einer Provinzhauptstadt und der Front – offenbaren die ganze Bandbreite seiner vergessenen Brutalität.
Eine terminologische Anmerkung: Wenn wir von „Russen“ schreiben, ist uns natürlich bewusst, dass eine Minderheit der Soldaten in den Uniformen der zaristischen Armee anderen Nationalitäten angehörte. Aus Ermangelung besserer Begriffe und im Bewusstsein der Unzulänglichkeit dieser Lösung verwenden wir „russisch“ und „Russen“ synonym zu „zaristisch“. Mit „Monarchie“ ist durchgängig das österreichisch-ungarische Kaiser- und Königtum gemeint.
* * *
Die Idee zu diesem Buch entstand im Frühjahr 2012 in Jena, genauer gesagt im Garten des Gästehauses der Friedrich-Schiller-Universität in der Charlottenstraße 23 in Wenigenjena. Damals saßen dort drei Stipendiaten des Imre-Kertész-Kollegs beisammen – die Verfasser dieses Buches und ihr jüngerer serbischer Kollege Aleksandar Miletić.
Aleksandar, ein ausgezeichneter Kenner der Zwischenkriegszeit, konnte nicht glauben, dass sein Land im Ersten Weltkrieg derart große Verluste erlitten hatte. Maciej Górny hatte gerade die erste Fassung seiner Habilitation über die damaligen Haltungen von Intellektuellen im nichtwestlichen Europa fertiggestellt. Włodzimierz Borodziej arbeitete an einem Artikel über die Erfahrung des Ersten Weltkriegs in Mittel- und Südosteuropa. Beim abendlichen Gespräch mit dem serbischen Kollegen wurde uns klar, dass dieses Thema nicht nur in Polen auf einen Autor wartete. Und da wir gerade das Privileg eines Kollegstipendiums genossen, machten wir uns gleich an die Arbeit. Die ersten Abschnitte des Buches entstanden somit in Jena, die weiteren in Warschau.
Wir profitierten beide von Gesprächen mit anderen Stipendiaten und Mitarbeitern des Imre-Kertész-Kollegs. Besonderer Dank gebührt Viorel Achim, Jochen Böhler, Stanislav Holubec, Jurek Kochanowski, Ferenc Laczó, Elena Mannová, Lutz Niethammer, Joachim von Puttkamer, Stefan Troebst, Raphael Utz und Theodore Weeks. Während unseres Aufenthalts in Jena kümmerten sich Daniela Gruber und Diana Joseph um alle organisatorischen und technischen Belange. Die jüngsten Kollegmitarbeiter leisteten unschätzbare Dienste bei der Beschaffung von Büchern und Kopien.
Überaus hilfreich waren auch die Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen, denen wir dank des Wirkens zweier verdienstvoller Forschungsgesellschaften zum Ersten Weltkrieg begegnen konnten. Die International Society for First World War Studies und das Forum Österreich-Ungarn im Ersten Weltkrieg widmen sich ihrem Thema auch abseits runder Jahrestage.
Einen Teil des Materials, insbesondere der Illustrationen, verdanken wir der uneigennützigen Hilfe von Grzegorz Bąbiak und Mariusz Kulik, die den Ertrag ihrer Reisen nach Paris und Moskau mit uns teilten.
Die ersten Leser von Manuskriptauszügen waren Joachim von Puttkamer, Timothy Snyder und Philipp Ther. Für die Begutachtung danken wir Piotr Szlanta und Theodor Weeks.
Die deutsche Fassung des Buches verdankt ihr Dasein und Ihre Gestalt vor allem zwei Menschen, die nicht unerwähnt bleiben dürfen: Daniel Zimmermann, der uns unendlich viel Vertrauen und Geduld geschenkt hat, und Bernhard Hartmann, der uns so gut versteht.
Allen diesen danken wir für Kommentare und Anmerkungen. Für die Schwächen des Buches tragen allein wir die Verantwortung.