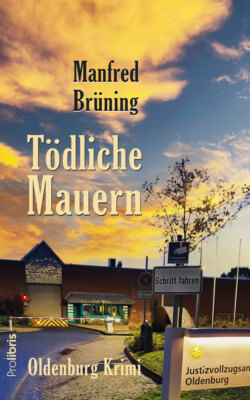Читать книгу Tödliche Mauern - Manfred Brüning - Страница 7
ОглавлениеDonnerstag, 11. Dezember
Der Garten lag im Nebel. Adi Konnert konnte aus dem Küchenfenster kaum bis zum Komposthaufen sehen. Mit beiden Händen auf die Arbeitsplatte seiner Küche abgestützt, wartete er darauf, dass der Kaffee vollständig durch den Filter gelaufen war. Musik von NDR2 rieselte aus der oberen Etage durch die Decke. Er meinte zu hören, dass Helene Fischer schon am Morgen atemlos durch die Nacht zog.
Unter der Brötchentüte lag die Nordwest-Zeitung. Malala bedankt sich für den Friedensnobelpreis, war die Überschrift zum Titelbild. Besser als die Auszeichnung vor zwei Jahren für die Europäische Union, urteilte Konnert. Milliarden für das Land sprang ihm fettgedruckt als Schlagzeile ins Auge. Ob sich die Anlieger über die Finanzierung der A20 freuten, wagte er zu bezweifeln.
Konnert pulte die Brötchentüte auf. Ein gefalteter Briefumschlag mit seinem Namen fiel auf sein Frühstücksbrettchen.
Auf dem Briefbogen stand in Zahras runder Schrift: Lieber Adi! Du kannst im neuen Jahr wieder selbst kommen und einkaufen oder hier frühstücken. Ich habe zum 1. Januar eine Arbeitsstelle in Bremen und ziehe noch vor Weihnachten zu meiner Mutter. Danke noch einmal für die schöne Zeit mit Dir. Lass es Dir gut gehen. Gott segne Dich. Zahra.
Sofort war sein Gesicht das eines alten Mannes, grau, schlaff, mit einem stumpfen Blick aus dem Fenster in den Nebel. Er presste die Lippen aufeinander.
Zahra, seine große Liebe. Monatelang hatte er bis zur Trennung in ihrem Backshop gefrühstückt. Jetzt brachte Schwiegersohn Sven auch für ihn die Brötchen mit.
Nicht jede Liebe führt zum Traualtar, hatte er sich seit dem Sommer schon so oft gesagt. Jetzt fiel ihm dieser Satz wieder ein. Und schnell, vielleicht einen Moment zu schnell, bestätigte er sich, dass die Entscheidung ihrer Trennung vernünftig und verantwortungsvoll gewesen war. Trotzdem.
Er ließ die Brötchen unberührt liegen, goss Kaffee in einen Becher, nahm Zahras Brief und stapfte zum Rauchen auf die Terrasse. Die Welt lag grau in grau um ihn.
Sein rechter Mundwinkel zuckte. Er hatte gedacht, den Abschied von Zahra verarbeitet zu haben. Jetzt nagten Zweifel an ihm. Es stimmte, Zahra war es gewesen, die Schluss gemacht hatte, aber er hatte oft mit seinen Weigerungen die entscheidenden Anlässe zu Auseinandersetzungen geliefert. Ich habe an ihr doch nicht nur ihre Jugend geliebt, dachte er bei sich. Sie war auch eine so gute Zuhörerin und konnte die passenden Fragen stellen, die mich inspiriert haben. Und wenn ich sie gefragt habe, dann waren ihre Antworten klug und weiterführend. Er erinnerte sich an tiefgehende Gespräche und so wunderbare Übereinstimmungen, wenn es um ihren gemeinsamen Glauben ging. Er vermisste diesen Gedankenaustausch.
Statt zu mir zu ziehen, wohnt sie zukünftig in Bremen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Niemals! Ihr Lachen, ihre Zuversicht, ihren Lebensschwung würde er nie vergessen. Er zwinkerte eine Träne weg. Mit einer energischen Bewegung kratzte er die Pfeife aus und steckte sie in die Jackentasche. Als er ins Haus ging, vergaß er, den Terrassenstrahler auszuschalten. Die Tür zur Küche fiel diesmal lauter ins Schloss, als es bei ihm üblich war.
***
Magen und Darm hatten sich gestern Abend etwas beruhigt, und Otten war zurück auf die Station B2 in seinen Haftraum verlegt worden. Jetzt wartete er mit anderen Schülern im Treppenhaus darauf, zu den Unterrichtsräumen geführt zu werden.
Zwei Mithäftlinge hakten sich unter seinen Armen ein. »Unser aufrichtiges Beileid, Frau Knieling«, säuselte der linke. »Ihr Begatter war ein grandioses, allseits unbeliebtes, überhebliches Schwein. Er kroch so gern jedem in den Arsch und war deshalb auch bei den Knastbullen so beliebt.«
Otten ballte die Fäuste und dachte dabei an seine Frau und die beiden Töchter.
»Und mit wem gedenkt die gnädige Frau sich in ihrer Trauerzeit zu trösten? Ich würde mir größte Mühe geben, dir den Arsch aufzureißen«, zischte der rechte Gefangene ihm ins Ohr.
»Lasst ihn los!« Ein dürrer Zweimetermann hatte sich umgedreht und funkelte die beiden Störenfriede aus weit aufgerissenen Augen an.
Sie gehorchten, mussten aber trotzdem noch einen Kommentar ablassen: »Wir überlassen ihn dir natürlich zu treuen Händen.«
***
Die kahlen Äste der Bäume und Büsche rings um das Institut für Rechtsmedizin in der Pappelallee verstärkten bei Konnert die Erwartung eines tristen Tages. Er rauchte neben dem Dienstwagen und versuchte, in Gedanken einen Tagesplan zurechtzulegen.
Alles hing vom Ergebnis der Obduktion ab. Herzversagen ohne Fremdeinwirkung, dann konnte er sich weiter um die Akten auf seinem Schreibtisch kümmern. Suizid würde bedeuten, Formulare auszufüllen, und danach könnte alles andere den vorgeschriebenen Ablauf nehmen. Mord war nach dem, was er bisher wusste, nur schwer vorstellbar. Aber er konnte sich manches nur schwer vorstellen, und dann war es doch real.
Also besser keinen Plan und abwarten.
Die Staatsanwältin kam und begrüßte ihn mit einem Lächeln. »Bevor wir reingehen, rauche ich noch eine.« Dorothee Lurtz-Brämisch holte ihr Pall Mall-Päckchen raus, suchte sorgfältig eine Zigarette aus und ließ sich Feuer geben. Er erinnerte sich an das Frühjahr, als sie bei ihm auf der Friedhofsbank gesessen und geraucht hatte. Frierend hatten sie nach der Beerdigung eines Opfers und dessen Ehemannes dagesessen und geschwiegen. Auch jetzt rauchte sie und schwieg. Er musste erneut feststellen, dass ihm das gefiel. Mit jemandem rauchen und dabei schweigen. Das hatte er mit Zahra nicht gekonnt.
Im Haus kam ihnen die Chefin vom Institut für Rechtsmedizin im hellgrünen Kittel entgegen. Ihre Hände steckten in Latexhandschuhen. Konnert kannte Dr. Landmann seit vielen Jahren, und noch immer herrschte eine leicht prickelnde Spannung zwischen ihnen. Sie hatte ihn einmal sehr gemocht und zum Seitensprung verführen wollen. Als Konnert Witwer geworden war, bedauerte er, dass sie mittlerweile verheiratet war. Sie hielt ihm den Ellenbogen zur Begrüßung hin, und er fasste zu. Die Frauen beließen es bei einem Lächeln und angedeutetem Nicken.
Knieling lag nackt auf einem Obduktionstisch, neben dem der vorgeschriebene zweite Arzt wartete. Sie begannen mit der äußeren Leichenschau bei den Füßen. Fahle Haut überzog die Schienbeine. Waden und Schenkel waren fast fleischlos. Der eingefallene Bauchraum wies keine Verletzungen auf. Nur eine Narbe auf der rechten Seite ließ auf eine frühere Blinddarmoperation schließen. Ein verblasstes Tattoo am linken Unterarm entzifferte Konnert als Till the day I die. Drei Punkte zwischen Daumen und Zeigefinger hatten Mithäftlingen signalisieren sollen: Ich sehe nichts, ich höre nichts, ich sage nichts. Der andere Arm hatte keine Tätowierung. Am Ringfinger zeugte eine leichte Einkerbung davon, dass Knieling hier einen Ring getragen hatte, der bereits entfernt worden war.
Dr. Landmann untersuchte die Halspartie. Aus einer Schublade holte sie ein Vergrößerungsglas und begutachtete aufmerksam die Hautstruktur. Um den Bereich oberhalb des Kehlkopfes noch besser untersuchen zu können, schaltete sie die Beleuchtung der Lupe ein. Konnert hätte ihr gern über die Schulter geschaut. Sie bewegte ihr Instrument an den rot-braunen, schon eingetrockneten Lippen der Leiche vorbei zu den Wangen. Dann hob sie das rechte Augenlid an und überprüfte besonders sorgfältig die Hornhaut.
»Tod durch Erdrosseln«, sagte die Ärztin durch ihren Mundschutz und zeigte auf winzige punktförmige Blutungen in der Gesichtshaut. Sie waren zwischen den verschorften Kratzstellen im Gesicht nur schwer zu erkennen. »Und hier in den Augenbindehäuten.« Sie hielt die Lupe so, dass Konnert hindurchsehen konnte.
Wieder widmete sie sich der Haut am Hals. »Strangulationsfurche.«
Konnert beugte sich gleichzeitig mit der Staatsanwältin vor, sah aber nichts Auffälliges. Er bekam das Vergrößerungsglas gereicht und erkannte nun selbst die kaum vom übrigen Gewebe zu unterscheidende, ringförmige Einschnürung.
»Fass mal bitte mit an.«
Konnert fummelte aus seiner linken Hosentasche Einmalhandschuhe heraus und streifte sie über. So sehr in seiner rechten Hosentasche das Chaos herrschte, so aufgeräumt ging es in der linken zu. Da fanden sich nur Asservatenbeutel und eben Einmalhandschuhe. Gemeinsam drehten sie die Leiche. Auch im Nacken war die Strangulationsfurche zu erkennen. Auf der linken Halsseite war sie an einer Stelle breiter. Möglicherweise zeigte sich hier eine Druckstelle, die von einer Verknotung stammen konnte.
***
Tschabo Dumitrescu stützte seinen linken Ellenbogen auf dem Mahagonistehpult am Kopfende des rötlichen Konferenztisches ab. Sein Blick wanderte ruhig von einem seiner leitenden Mitarbeiter zum nächsten. Gespannte Stille beherrschte den abhörsicheren Raum.
»Victor.«
Der Angesprochene erhob sich, knöpfte das Jackett zu und berichtete. Er nannte Zahlen, ließ eine Grafik an die Wand projizieren und schloss mit dem Fazit: »Die in diesem Jahr von Ihnen erwartete Rendite von 17,3 Prozent im Immobiliensektor liegt noch 0,2 Prozent unter der anvisierten Marge.«
»Ja?« Mehr fragte sein Boss nicht dazu.
»Die verantwortlichen Abteilungsleiter sind angewiesen worden, entsprechend förderliche Maßnahmen zu ergreifen.«
»Radu-Liviu.«
Gleichzeitig mit der letzten Silbe seines Namens sprang der zuständige Leiter des Kreditwesens auf. Wie der Vorredner berichtete er und nannte Summen im sechsstelligen Bereich. Auch er schloss den Rapport mit einer Prozentzahl.
»Gut.«
Die Rechenschaftsberichte aus den übrigen Geschäftsfeldern und dem Personalwesen folgten. Nach jeder Meldung gab es eine der beiden Bewertungen: Ja? oder Gut.
Am Ende der Sitzung suchte und fand Dumitrescu stummen Augenkontakt zu jedem Einzelnen. Der Blick wurde mit einem leichten Senken des Kopfes erwidert. Als er dem letzten Mann in die Augen geschaut und das Zeichen der Unterwerfung empfangen hatte, sprach er mit Autorität in der Stimme zu allen: »Du bist verantwortlich, nicht ihr. Du bist verantwortlich, nicht deine Untergebenen. Du und niemand anderes!«
Nach einer sich hinziehenden Pause sagte er: »Danke.«
Er blieb hinter seinem Pult stehen. Die sechs Männer verließen schweigend den Raum.
Als die Tür geschlossen worden war, griff Dumitrescu zum Telefon, wählte, wartete und ordnete an: »Achte auf Victor!« Ohne eine Antwort abzuwarten, legte er auf. Gleich nahm er den Hörer wieder ab und wählte eine weitere Nummer.
Sein Blick hing dabei an einer Ikone, auf der die Heilige Familie im byzantinischen Stil dargestellt war. Er bekreuzigte sich und senkte nun seinerseits den Kopf.
Endlich meldete sich jemand am anderen Ende der Leitung.
»Ich bin es«, flüsterte er und hörte dann eine ganze Weile schweigend zu.
***
»Ich will nun doch mit Ihnen sprechen«, nuschelte Janina Geißendörfer.
»Ja?« Stephanie war überrascht von ihrem Sinneswandel.
»Können Sie jetzt kommen?«
In Gedanken überflog die Kommissarin ihre Vormittagsplanung.
»Was hat Ihre Meinung geändert?«
»Ich bin trotz allem nach Bassum zur Geburtstagsfeier meines Vaters gefahren und habe meiner Mutter erzählt, was mir passiert ist. Sie hat gleich meinen Vater aus der Feier herausgerufen. Der hat mir zugehört und meine Entscheidung, nicht mit Ihnen zu sprechen, gutgeheißen.«
»Und deshalb wollen Sie jetzt doch mit mir reden? Erklären Sie mir das bitte.«
»Wenn mein Vater meint, ich solle die Zusammenarbeit mit der Polizei beenden, dann hat er bestimmt Gründe dafür. Dann halte ich das für hochgradig verdächtig. Er hat noch nie irgendetwas freiwillig unterstützt, was ich gewollt oder gemacht habe.«
Stephanie runzelte die Stirn und überdachte die merkwürdige Logik der jungen Frau. Dann antwortete sie: »Ich komme, sobald ich kann.«
***
»Es ist nicht so schwierig, sich selbst zu erdrosseln, wie manche meinen«, dozierte Dr. Landmann. »Man muss einen Strick oder einen Schal nur für drei, vier Sekunden stramm genug um den Hals zuziehen. Dann wird die Blutzufuhr zum Gehirn abgeschnürt, es bekommt keinen Sauerstoff mehr und kollabiert. Die Bewusstlosigkeit tritt unmittelbar ein. Das geht so schnell, dass man sich dann nicht mehr aus der Schlinge befreien kann.«
Die Ärztin suchte erneut den gesamten Körper nach Spuren von Fremdeinwirkungen ab. Sie fand keine Abwehrverletzungen, weder Blutergüsse noch kleine Wunden. Ein Mord erschien ihr darum äußerst unwahrscheinlich zu sein. Sie ging aufgrund der bisherigen Befunde von einem Suizid aus. Selbstverständlich nahm sie trotzdem Proben der unter den Fingernägeln haftenden Partikel und klebte verschiedene Körperregionen ab, um Hautschuppen sicherzustellen und möglicherweise zu unterscheiden.
»Natürlich kann ich erst nach der Leichenöffnung einen abschließenden Bericht schreiben.«
»Ich erinnere mich«, sagte Konnert und wandte sich an die Staatsanwältin, »Knieling hat gesagt, er würde sich eher selbst umbringen, als die Tortur noch einmal durchzumachen.«
»Was ist Ihrer Meinung nach als Tatwerkzeug anzunehmen«, fragte Dorothee Lurtz-Brämisch die Ärztin.
»Ein fester Schal, ein fein gewebtes Geschirrtuch. Kein Seil oder Kabel oder so etwas Ähnliches.«
»Ich kann mir trotzdem einen Suizid nicht vorstellen«, mischte sich Konnert ein. »So unwahrscheinlich es auch klingen mag, auch in Gefängnissen kommen Morde vor. Ich bleibe vorerst dabei, wir sollten sicherheitshalber ein Verbrechen nicht ausschließen.«
Die Staatsanwältin entschied: »Van Stevendaal wird aus der Kriminaltechnik zusätzliche Erkenntnisse liefern. Dann sehen wir weiter.«
Damit verabschiedete sie sich von Frau Dr. Landmann und dem Assistenzarzt. Sie wartete an der Tür auf Konnert und schaute ihn freundlich an, als er auf sie zukam.
***
Auf dem Tischchen vor dem Ecksofa waren längliche Untertassen gedeckt. Feines Gebäck lag in einer quadratischen Schale aus weißem Porzellan. Janina Geißendörfer hatte ihre braunen Haare zu einem Zopf zusammengebunden. Die Blässe ihres Gesichts hatte sie nicht überschminkt.
»Nehmen wir doch Platz«, sagte sie und schritt zum Sofa.
Stephanie wartete ab, wie sie es von Konnert gelernt hatte, und betrachtete die leeren Untertassen.
»Cappuccino oder Espresso? Was darf ich Ihnen bringen?«
»Das Erste bitte. Gern mit mehr Süße.«
Janina Geißendörfer verschwand in der Küche. Stephanie ließ ihren Blick durch das Zimmer schweifen. Ein Flachbildschirm und darunter eine kostbar aussehende Musikanlage mit Regalen voller CDs. Auf einem Sideboard im Retrodesign stand eine einsame Vase mit Tulpen. Tulpen im Dezember irritierten sie. Durch eine geöffnete Tür konnte sie in das angrenzende Zimmer sehen. Dort ein aufgeräumter Jugendstilschreibtisch und darüber Familienbilder. Sie wäre gern aufgestanden, um die Personen auf den Fotos zu betrachten. Aber ihre Gastgeberin kam schon mit zwei Cappuccinotassen zurück.
»Was soll ich Ihnen erzählen?«
»Beginnen wir mit dem Montagabend. Was haben Sie unternommen?«
Erst stockend, dann immer flüssiger berichtete Janina Geißendörfer, was passiert war. Sie erzählte von der Weihnachtsfeier, beschrieb erneut die Begegnung mit dem Mann und schilderte fast emotionslos ihre Panik auf dem Holzsteg und den darauffolgenden kurzen Kampf. Als sie von dem Griff in ihr Haar sprach, mit dem der Täter sie zu Boden geworfen hatte, brach sie ab. Sie starrte nur stumm an Stephanie vorbei auf die gegenüberliegende Wand.
Minuten verstrichen.
Als erwachte sie aus einem Traum, zuckte Janina Geißendörfer plötzlich zusammen. Sie griff ihre Tasse und nippte am Cappuccino. »Kalt«, sagte sie und stellte die Tasse zurück.
»Janina, darf ich Sie so nennen?«
Leicht nickte sie zustimmend.
»Konnte der Mann wissen, dass Sie am Montagabend dort vorbeikommen würden? War er vielleicht bei der Weihnachtsfeier dabei gewesen?«
»Unmöglich. Der war viel älter als die Jungs auf der Party. Nein, es muss Zufall gewesen sein, dass er ausgerechnet mich erwischt hat.«
»Da sind Sie sich sicher? Bisher haben Sie gesagt, dass Sie den Mann nur im Gegenlicht gesehen haben. Er wäre dann auch immer hinter ihnen hergegangen. Sie konnten sich nicht an sein Gesicht erinnern.«
»Das spürt man doch, ob einer alt oder jung ist.«
»Wie alt kam der Mann Ihnen vor?«
»Etwas älter als dreißig Jahre vielleicht.«
»Doch so jung?«
Janina zog den Kopf zwischen die Schultern.
Stephanie gab sich damit zufrieden. »Meistens kommen Vergewaltiger aus dem Umfeld des Opfers.« Sie hatte bis jetzt vermieden, die Tat so deutlich anzusprechen. Ihre Fragen sollten nun konkreter werden. »Gibt es einen Mann hier aus der Nachbarschaft, aus Ihrem Bekanntenkreis, aus einer Arbeitsgruppe der Universität, der Sie an den Vergewaltiger erinnert? Denken Sie auch an Männer, die Sie aus Bassum kennen.«
Die Studentin dachte nach, zog das Haarband ab, mit der ihr Zopf zusammengehalten worden war, und schüttelte den Kopf. »Der Mann ist mir vollkommen fremd.«
»Bitte denken Sie noch einmal genau nach. Hatte der Mann irgendwelche Eigenarten? Sprach er einen Dialekt, roch er nach etwas Bestimmtem, bewegte er sich ungewöhnlich?«
»Nichts. Ich hatte Angst. Da achtet man nicht auf die Aussprache oder wie sich einer verhält.«
Stephanie glaubte ihr.
»Ist Ihnen in den Tagen vor der Tat etwas merkwürdig vorgekommen? Hat Sie vielleicht jemand angerufen und tat so, als wäre er falsch verbunden gewesen?«
Es sah mit einem Mal so aus, als würde die Studentin nun doch wieder unwillig, zusätzliche Fragen zu beantworten. »Ich erinnere mich an nichts.« Beide Frauen schwiegen.
Dann flüsterte Janina Geißendörfer: »Das Einzige, was mir einfällt, ist, dass vorige Woche mal ein Auto ungefähr zweihundert Meter neben mir hergefahren ist. Aber das ist schon öfter passiert, dass Blödmänner an mir vorbeifahren und hupen.«
»Wann war das?«
»Am Dienstag? Ich war mit dem Rad unterwegs zur Uni.«
»Wo?«
»Bremersweg. Ich glaube, der Wagen kam aus dem Hörneweg und ist bis runter zur Softwarefirma neben mir hergefahren.«
»Um wie viel Uhr war das?«
»Um elf habe ich dienstags eine Arbeitsgruppe. Es muss ungefähr zwanzig Minuten eher gewesen sein.«
»Was für eine Marke?«
»Ich kenne mich mit Autos nicht so gut aus. Es war so ein hohes, breites Modell. Ein protziger Geländewagen für Leute, die nie im Gelände unterwegs sind, aber in der Stadt auffallen wollen.«
»Beschreiben Sie bitte das Fahrzeug.«
»Ich habe geradeaus geguckt. Die wollen doch nur, dass man sie bemerkt und zu ihnen hinsieht. Erst als er mich überholt hatte, habe ich aufgeschaut.«
»Konnten Sie den Fahrer erkennen?«
»Es war so ein Angebertyp mit auf die Stirn geschobener Sonnenbrille. Im Winter! Ich bitte Sie. Er trug ein schwarzes Hemd mit offenem Kragen und Goldkette. Ein Jackett hatte er an, keinen Pullover.«
Sie hat doch hingeschaut. Sehr gut sogar, dachte Stephanie und machte sich Notizen.
»Erinnern Sie sich vielleicht auch noch an die Haarfarbe oder an etwas anderes?«
»Helle Haare. Bestimmt gebleicht. Glatt rasiert. Mehr weiß ich nicht. Ich habe ja nur kurz hingesehen. Ich fuhr doch mit dem Rad.«
»Auf welches Alter schätzen Sie den Mann?«
»Vielleicht so um die dreißig Jahre. Aber sicher bin ich mir da nicht. Er kann auch älter gewesen sein.«
»Haben Sie auf das Kennzeichen des Wagens geachtet?«
Sie überlegte einen Moment. »M wie München? Aber auch dabei bin ich mir unsicher.«
»Konnten Sie auch das Firmenlogo der Automarke erkennen?«
»Meinen Sie etwa, der Vorfall hätte mit meiner Vergewaltigung zu tun?« Nun hatte auch die Studentin das grässliche Wort ausgesprochen.
»Janina, Sie haben doch bestimmt einen PC oder einen Laptop. Lassen Sie uns einmal etwas nachsehen.«
Janina holte ein Tablet und schaltete es ein. Nach ein paar Sekunden hatten sie Bilder mit Automarken von SUVs gegoogelt. Mit dem Finger ging Janina Geißendörfer die Reihen entlang. Bei Land Rover hielt sie an. »Das Logo war auf der Heckklappe.«
»Super. Fällt Ihnen noch etwas ein? Die Farbe des Wagens vielleicht?«
»Das Dach war dunkel. Unten herum glänzte es rot und wieder schwarz. Es hatte zwei Auspuffrohre. Das weiß ich, weil der Fahrer plötzlich Gas gab und zwei Wolken hinter sich herzog.«
***
Der Nebel hatte sich verzogen. Es nieselte. Von der Cloppenburger Straße aus telefonierte Konnert mit Venske und informierte ihn über die vorläufigen Obduktionsergebnisse und die Anweisung der Staatsanwältin.
»In der JVA wissen sie Bescheid. Sie stellen uns Räume für Befragungen zur Verfügung. Ich warte auf dich im Café gegenüber.«
Er ließ sich ein Kännchen Kaffee servieren und bekam zwei Spekulatius zusätzlich auf die Untertasse gelegt. Konnert blickte hinüber zur Haftanstalt. Eine Erinnerung stieg in ihm auf, wie ihn als Kind die Angst vor Enge vor der Fürsorgeerziehung bewahrt hatte. Auf der Station B2 arbeitete Rolf Beeken. Er musste unbedingt dafür sorgen, dass Venske dessen Befragung übernahm.
***
Der Raum war kaum größer als die vorgeschriebenen neun Quadratmeter eines Haftraumes. Bernd Venske saß dem Stationsarbeiter Rolf Beeken gegenüber. Der lehnte sich auf seinem Stuhl zurück, verschränkte die Arme vor der Brust und sah den Kommissar herausfordernd an.
»Ist Ihnen eigentlich bewusst, was für ein Laumann Ihr Chef ist? Ich könnte Ihnen da Storys erzählen.«
»Die will ich aber nicht hören. Ich will von Ihnen wissen, was am Dienstag zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr auf der Station B2 abgelaufen ist.«
»Es geht nicht um Konnert?« Beeken grinste.
»Nein.«
»Also doch wieder nur um den Knieling? Irgendwer hat dem arroganten Schwein das Gas abgedreht. Stimmt’s? Bloß weil er wusste, warum ein Eimer einen Boden hat, meinte er was Besseres zu sein. Wollte Heiland werden und die Welt retten. Kein Verlust, sage ich Ihnen. Ich jedenfalls kann auf den ...«
»Davon will ich erst recht nichts hören, Herr Beeken. Was ist abgelaufen?«
»Sie müssen vorher etwas über den Charakter des Opfers herausfinden, sonst missverstehen Sie doch den ganzen Fall.«
»Was lief ab?«
»Wenn Sie es nicht wissen wollen. Ist Ihr Bier. Also, der Knieling war krank. Hat auch sein Mittagessen stehen lassen, bekam trotzdem sein Abendbrot. Habe ich ihm hineingebracht und auf den Tisch gestellt. Die Lüttmann stand in der Tür. Ich habe ihn nicht abgefiedelt.«
»Wie verhielt sich Frau Lüttmann?«
»Die war schlecht drauf. Hatte wohl ihre Tage oder Stress mit ihrem Alten … wenn sie denn einen hat. Blaffte jeden an, der ihr über den Weg lief.«
»Wo hielt sie sich auf, als Sie das Abendessen verteilt haben?«
»Stand neben der Tür und hat den abgefuckten Bimbo angeblökt. Der dreht ständig am Rad. Was der wollte, habe ich nicht verstanden. Es war sehr unruhig auf der Station. Wie immer, wenn die Lüttmann Dienst hat.«
Konnert hätte ihm jetzt beizubringen versucht, dass er von einem farbigen Mitgefangenen sprach, dachte Venske. Ihm war egal, wie sich Beeken ausdrückte. Er wusste ja, was gemeint war.
»Wie ging es nach dem Nachteinschluss von Knieling weiter?«
Beeken blies die Backen auf und ließ die Luft langsam entweichen. »Tja, wie ging es weiter? Keine besonderen Vorkommnisse. Die Blaue ist zurück in ihr Aquarium. Gut, wenn die da hinter der Scheibe sitzt und auf den Monitor glotzt. Dann bringt sie wenigstens die Leute nicht durcheinander.«
»Wie meinen Sie das?« Nun war Venske doch am allgemeinen Verhalten der Beamtin interessiert.
»Sie ist ungerecht. Sie hat Lieblinge, die sich alles erlauben können. Andere hat sie ständig auf dem Kieker und schikaniert sie.«
»Sie sind keines ihrer persönlichen Schätzchen, nehme ich mal an.«
»Nee.« Das Grinsen breitete sich wieder auf seinem Gesicht aus. »Aber mir kann sie nichts. Ich weiß, wie der Hase hier im Knast läuft. Auf drei Beinen. Bin lange genug dabei und kenne jeden Ausfallschritt. Wenn Sie wissen, was ich meine.«
Venske lächelte unwillkürlich auch. Irgendetwas war ihm an der Art, wie Beeken mit ihm redete, sympathisch. Wahrscheinlich war die Schnodderigkeit auch einer seiner Ausfallschritte. Der Mann hatte Menschenkenntnis.
»Wie stand Frau Lüttmann zu Knieling?«
»Den hat sie kleinlich behandelt. Sie hat ihn trotz seines kriecherischen Verhaltens öfter provoziert. In seiner Zelle herrsche Unordnung, hat sie zum Beispiel beanstandet. Dabei war der immer so pingelig und akkurat. Er musste dann unter ihrer Aufsicht aufräumen. Oder sie hat seine Anträge abgelehnt. Immer wieder hatten sie Zoff miteinander. Aber wenn ich das richtig mitgekriegt habe, hat sich Knieling meistens durchgesetzt. Lüttmann blieb nichts anderes übrig, als zähneknirschend nachzugeben und ihm zu genehmigen, was er beantragt hatte.«
Er machte eine Pause und grinste, als erinnere er sich an einen Vorfall.
»Dann gab es Situationen, da hat sie ihn wie Luft behandelt. Er konnte sie ansprechen, und sie ging einfach weg, um mit einem anderen von diesen Gangstern zu reden. Sie ist eben launisch.«
»Aber Sie wissen, wie sie zu nehmen ist.«
»Auf jeden Fall. Klar.«
»Noch einmal zurück zu dem Augenblick, als Sie den Haftraum verlassen haben. Was passierte dann? Was hat Frau Lüttmann gemacht?«
»Sie hat durch die offene Tür hineingeguckt. Irgendwas ging ihr wohl gegen den Strich. Sie hat den Riegel vorgeschoben, damit niemand die Tür zuwerfen kann, ist hineingegangen und hat die Tür hinter sich fast ganz zugezogen. Es dauerte, bis sie wieder zum Vorschein kam, dann hat sie abgeschlossen. Das war’s.«
»Sie haben die Beamtin Lüttmann immer gut im Blick, was?«
»Muss man, sage ich Ihnen. Muss man. Wenn du die Wachtel aus den Augen verlierst, hast du hier gar keinen Spaß. Gar keinen.«
»Können Sie in etwa abschätzen, wie lange Frau Lüttmann allein in Knielings Haftraum war?«
»Lange genug. Das ist alles, was ich dazu sage. Ich will mir ja das Maul nicht verbrennen.«
***
Michael Otten trug einen braunmelierten Pullover, als ihn ein Justizvollzugsbeamter in den Besprechungsraum führte, abschloss und auf einem Stuhl neben der Tür Platz nahm. Konnert stand auf, ging dem Häftling zwei Schritte entgegen und stellte sich vor.
»Setzen wir uns.«
Konnert wies ihm einen Holzstuhl zu und wartete ab. Die erste Reaktion eines Befragten lieferte ihm Anhaltspunkte dafür, wie zuverlässig Aussagen waren.
Mit den Händen unter dem Tisch versteckt, rutschte Otten auf dem Stuhl hin und her. Ruhig setzte sich Konnert ihm gegenüber und schwieg.
Plötzlich platzte es aus Otten heraus. »Was wollen Sie eigentlich von mir?«
»Gleich, Herr Otten. Erst einmal die Formalitäten.« Konnert schaltete das Aufnahmegerät ein, nannte Tag und Uhrzeit, diktierte die Namen der Anwesenden und den Grund der Befragung.
»Herr Otten, ich möchte, dass Sie sich über Folgendes im Klaren sind. Dies ist kein Verhör. Ihnen wird nichts zur Last gelegt. Ich will mir nur ein Bild von dem machen, was am Dienstag zwischen circa 15 Uhr und 16 Uhr auf der Station B2 abgelaufen ist. Haben Sie das verstanden?«
Otten nickte.
»Sie hatten am Dienstag unbegleiteten Ausgang. Wo haben Sie den Tag verbracht?«
»Muss ich das sagen?«
»Es ist im Moment nicht so wichtig. Aber warum wollen Sie es verschweigen?«
»Ich war zu Hause. Bei meiner Frau war ich.«
»Trafen Sie noch jemanden? Verwandte, Freunde, ehemalige Kollegen vielleicht?«
»Nein, niemanden. Nur meine Frau und meine Töchter.«
»War es ein angenehmes Wiedersehen?«
»Was hat das mit B2 zu tun, wie es bei mir zu Hause war und was ich gemacht habe?«
Konnert spürte die Verärgerung Ottens und fragte sich, warum er so unwirsch reagierte. Er ließ es aber dabei und bohrte nicht nach. Noch nicht.
»In die Anstalt kamen Sie vor 15 Uhr zurück. Warum so früh? Sie hätten bis 16:30 Uhr draußen bleiben können.«
»Sascha, ich meine Herr Knieling, war krank. Für ihn hieß es 15:30 Uhr Nachteinschluss. Ich wollte noch mit ihm sprechen und ihm eine gute Nacht wünschen.«
»Ist Sascha Knieling Ihr Freund gewesen?«
»Im Gefängnis gibt es keine Freunde. Hier ist sich jeder selbst der Nächste.«
»Aber Sie haben auf eineinhalb Stunden draußen verzichtet, um Knieling gute Besserung wünschen zu können.«
»Sie haben keine Ahnung davon, wie es hier zugeht.«
»Erklären Sie es mir bitte.«
»Das kann ich nicht. Das muss man erlebt haben.«
Konnert schwieg, wartete geduldig und nickte dann aufmunternd.
»Allein bist du nichts im Knast. Erst recht nicht, wenn du nichts zu geben hast. Kaffee oder Tabak oder so. Die Beamten können nicht überall sein und kriegen auch nicht alles mit. Da bist du froh, wenn dir einer ab und zu den Rücken freihält, der sich besser auskennt als du. Freundschaft kann man das nicht nennen.«
»Wie würden Sie es bezeichnen?«
»Zweckbündnis.«
»Und das ist für Sie so wichtig, dass Sie auf eine Stunde mit Ihrer Frau und den Kindern verzichten?«
Jetzt schwieg Otten. Konnert geduldete sich und beobachtete den Gefangenen. In den starr geradeaus blickenden Augen meinte er, Verzweiflung zu erkennen. Der Mund des Gefangenen war leicht geöffnet. Otten atmete stoßweise, wie nach einer großen Anstrengung. Er sackte mit einem tiefen Seufzer zusammen und ließ die Schultern hängen.
»Ich habe ihm gute Besserung gewünscht und bin in meinen Haftraum gegangen. Mehr weiß ich nicht. Was außerdem auf der Station passiert ist, davon habe ich nichts mitbekommen.«
»Sie hören doch, was auf dem Flur los ist.«
»Meine Tür war zu.«
»Gab es Streit zwischen Ihnen und Knieling?«
Otten zögerte mit der Antwort.
Überlegte er, was die ihn belasten könnte? Konnert wartete ab.
Endlich hatte sich Otten entschieden. »Es kam schon mal vor. Aber nie heftig oder beleidigend. Wir haben uns gut verstanden.«
»Auch am Dienstag?«
»Ja, auch am Dienstag.«
»Sie haben eine Familie. Knieling war alleinstehend. Ihre und seine Entlassung standen in absehbarer Zeit an. Gab es Absprachen zwischen Ihnen für die Zeit nach der Inhaftierung?«
»Wie meinen Sie das?«
»Wollten Sie Ihrem Kumpel vielleicht beim Übergang in ein Leben in Freiheit behilflich sein?«
Wieder blieb Otten stumm. Er blickte auf seine Hände, die zwischen seinen Oberschenkeln klemmten. »Ich hätte ihm bestimmt geholfen. Ja, das hätte ich bestimmt getan.«
»Gut. Zurück zur Station B2 am Dienstag. Als Sie Knielings Haftraum verlassen haben, lebte er noch? War das so?«
»Sie verdächtigen mich doch. Ich habe ihn nicht umgebracht. So was kann ich nicht!« Otten schrie den letzten Satz, und gleich darauf schlug er sich mit der Hand auf den Mund.
»Frau Lüttmann hat dann Knieling eingeschlossen. Am nächsten Morgen wurde er tot aufgefunden. Können Sie sich vorstellen, dass er sich selbst getötet hat?«
»Muss er ja wohl. Als ich seine Zelle verlassen habe, lebte er. Die Lüttmann bringt keinen Häftling um. Auch nicht, wenn sie ihn auf dem Kieker hatte. Macht die nicht. Also wird er es selbst getan haben.«
»Noch einmal, Herr Otten. Trauen Sie Knieling eine Selbsttötung zu?«
»Er hat darunter gelitten, wenn die anderen ihm Schwuchtel oder Durchlauferhitzer zugeraunt haben. Dann redete er manchmal davon, dass er keine Lust mehr zu leben hätte.«
»Hat sich schon auf der Abteilung rumgesprochen, wie Knieling gestorben ist?«
»Das weiß ich nicht.«
Konnert ließ sich noch schildern, was Otten von Knieling hielt, was sie miteinander unternommen und geredet hatten. Zum Schluss fragte er ihn: »Jetzt sind Sie wieder allein auf der Station. Wer wird Ihnen den Rücken freihalten?«
»Am Wochenende habe ich Hafturlaub. Ich hoffe, dass die Sache mit Knieling meinen Entlassungstermin nicht hinauszögert. Bis dahin muss ich die Augen offen halten, und wenn es möglich ist, schließe ich mich in meinen Haftraum ein.«
Freiwillig verzichtet er auf die kleine Freiheit, die ihm hier geblieben ist. Wie groß muss seine Angst sein, dachte Konnert.
***
»Adi, ist was?« Venske spürte, dass sich Konnert nicht wohlfühlte. Wenn sie vor einer Tür warten mussten, bis der Justizvollzugsbeamte sie ihnen aufschloss und hinter ihnen wieder abschloss, wirkte sein Chef angespannt. Er selbst fand die Erfahrung, eingeschlossen zu sein, nur lästig. Er wusste ja, er würde die Haftanstalt jederzeit verlassen können.
Sie waren auf dem Weg zur Mitarbeiterkantine. Die Anstaltsleitung hatte dafür gesorgt, dass die Anstaltsküche auch ihnen ein Mittagessen bereitstellte. Mit ihren Namen versehen, standen weiße Menagen auf dem Tisch. Sie setzten sich. Die Mehrzahl der Frauen und Männer hier arbeiteten als Zivilangestellte in der Zahlstelle oder dem Schulungsbereich. Konnert öffnete den Deckel der Box. Grünkohlgeruch strömte ihm entgegen. Salzkartoffeln, ein geräuchertes Mettende, eine Pinkelwurst, ein Stück Kassler und eine gehörige Portion Grünkohl präsentierten sich. Davon wurde man garantiert satt.
Es war nicht nur für Konnert schwierig, mit einem Messer aus ungehärtetem Blech die Wurst zu schneiden. Es bog sich, und richtig scharf war die Klinge auch nicht. Doch das Essen schmeckte. Solide Hausmannskost, zubereitet mit Zwiebeln, Schmalz und Gemüsebrühe. So hatte auch seine Mutter das norddeutsche Kultgericht gekocht.
Nach dem Essen hätte er gern geraucht. Aber es gab für die Bediensteten der JVA noch keinen Raucherraum. Also musste es auch ohne Pfeife weitergehen.
***
Zurückgelehnt auf seinem mäßig gepolsterten Stuhl saß Bernd Venske gelangweilt hinter dem Holztisch. Das Notizbuch lag aufgeschlagen vor ihm. Er hatte kaum Notizen aus der Befragung von Beeken eingetragen. Sein Erinnerungsvermögen war fast so gut wie das von Kriminalhauptkommissar Hans-Gerhard Struß, dem Chef vom FK3. Nachher im Büro würden ihm schon die wichtigen Überlegungen zu Beeken wieder einfallen. Und außerdem gab es die Tonaufzeichnung.
In Gedanken legte er sich Fragen für das Gespräch mit der Justizvollzugsbeamtin Lüttmann zurecht. Nur für den Fall, dass ihm nichts spontan einfallen sollte. Aber das kam sehr selten vor.
Das Warten fiel ihm schwer.
Um 14:15 Uhr hörte er endlich ein Schlüsselklappern. Kurz darauf betrat die Bedienstete den Raum. Sie trug die blaue Dienstkleidung mit den vorgeschriebenen schwarzen Schuhen. Venske schätzte sie auf knapp über vierzig. Dunkle, graublaue Augen sahen ihn direkt an. Er meinte etwas Verschlagenes, Lauerndes in ihnen zu entdecken. Wahrnehmen, aber nicht überbewerten, ermahnte er sich.
Die kleine, mollige Frau erinnerte ihn an eine seiner Tanten, die ihm nie Süßigkeiten mitgebracht hatte. Sie zog den Stuhl, auf dem vorher Beeken gesessen hatte, ein gutes Stück vom Tisch zurück, setzte sich und verschränkte die Arme unter ihrer Brust. »Sie wollten mich sprechen.«
»Danke, dass Sie gekommen sind.«
»Worum geht es?«
»Können wir erst die Formalitäten hinter uns bringen?«
Ruhig zog Venske ein Diktiergerät aus der Tasche. »Sie sind doch einverstanden, dass wir das Gespräch aufzeichnen.«
»Wozu?«
»Es geht beim Ablauf der Ereignisse auf der B2 möglicherweise um Minuten. Da möchte ich mich nicht nur auf mein Gedächtnis verlassen müssen. Sie verstehen? Das sichert außerdem auch Sie ab.«
Er nannte ihren Namen, Tag und Uhrzeit.
»Also, was wollen Sie wissen?«
»Das können Sie sich doch denken. Wahrscheinlich haben Sie Sascha Knieling als Letzte lebend gesehen.«
»Auf jeden Fall lebte er, als ich seinen Haftraum verschlossen habe. Das ist für mich die Hauptsache.«
»Das kann man so sehen.«
»Kann man? So muss man es sehen.«
»Schildern Sie mir einfach die Zeit zwischen 15 Uhr und 16:30 Uhr, wie Sie sie in Erinnerung haben.«
»Nun denn. Für die Inhaftierten, die nicht arbeiten und nicht am Unterricht teilnehmen, ist um 15:30 Uhr Nachteinschluss. Gegen 15 Uhr hat der Stationsarbeiter das Abendessen in Knielings Haftraum gebracht.«
»Waren Sie dabei?«, unterbrach Venske.
»Natürlich.«
»Dann weiter.«
»Kurz vor 15:30 Uhr, vielleicht eine oder zwei Minuten vorher, habe ich in seinen Haftraum hineingeschaut. Eine Leselampe auf dem Tisch gab genügend Licht ab, um Knieling zu sehen. Er lag im Bett, mit dem Gesicht zur Wand, und schlief. Er war ja krankgemeldet. Ich habe ihn schlafen lassen und den Haftraum vorschriftsmäßig verschlossen.«
»Aufgefallen ist Ihnen bei Knieling nichts?«
»Was hätte mir schon auffallen sollen. Ein kranker Mann liegt in seinem Bett und schläft.«
»Sie sollen länger als üblich in der Zelle gewesen sein. Was haben Sie in der Zeit gemacht?«
»Ich habe das Fenster geschlossen. Ich habe es Ihnen doch schon gesagt. Knieling war krank. Da ist es besser, wenn in einer Winternacht das Fenster zu ist.«
Unterdrückte Aggression war zu spüren. Oder war es Angst?
»Was war danach auf der Station los?«
»Nichts. Die Männer haben gekocht, Billard gespielt, telefoniert oder ferngesehen. Was sie so am Spätnachmittag machen. Um 19:30 Uhr war dann Zählkontrolle und Nachteinschluss. Keiner fehlte. Ich habe die Zahlen in den Computer eingegeben und an die Sicherheitszentrale gemeldet. Um 20 Uhr hatte ich Dienstschluss und habe meinen Arbeitsplatz verlassen. Das war’s.«
»Ich hörte, Sie seien an dem Tag nicht besonders gut drauf gewesen. Stimmt das?«
»Das hat Beeken Ihnen gesteckt, oder? Glauben Sie ihm kein Wort. Ein Inhaftierter lügt, wenn er den Mund aufmacht.«
»Ihnen ging es also gut?«
»Auf jeden Fall nicht schlecht.«
»Gab es am Wochenende oder am Montag besondere Vorfälle auf Ihrer Station?«
»Nein. Das können Sie auch in meinem Bericht nachlesen.«
»Inhaftierte sagten aus, Sie hätten Knieling trotz seines vorbildlichen Verhaltens schikaniert. Es sei immer wieder zu Wortwechseln zwischen ihm und Ihnen gekommen. Meistens hatten Sie zähneknirschend klein beigeben müssen.« Dass er diese Information nur von einem, von Beeken, hatte, buchte Venske unter erlaubtem Lügen ab.
»Vielleicht ist das tatsächlich einmal vorgekommen. Aber das passiert jedem Beamten hier irgendwann mit jedem Insassen.«
»Ist das so?«
»Ja, so ist das. Sie haben es hier überwiegend mit Männern zu tun, die schnell einen erhöhten Adrenalinspiegel haben und gesteigertes Gewaltpotenzial mitbringen. Was meinen Sie wohl, wie oft sich hier zwei Inhaftierte Nase an Nase stehen. Wir sind kein Mädchenpensionat, wenn Sie verstehen, was ich meine.«
Venske verkniff sich die Bemerkung, die ihm auf der Zunge lag, dass er es in seinem Beruf auch mit Kriminellen zu tun hatte. Stattdessen sagte er: »Aber Knieling doch nicht.«
»Ich habe ihn wie alle anderen behandelt.«
»Und als Sie ihn am Dienstag eingeschlossen haben, da lebte er noch.«
»Das habe ich doch schon gesagt. Ja, er lebte noch!«
»Wie können Sie sich da so sicher sein. Sie haben doch nicht nachgeprüft, ob er lebt.«
»Das musste ich auch nicht. Vorschrift ist, die Anwesenheit festzustellen. Das habe ich getan. Lebendkontrolle ist am Morgen. Ich habe mich vorschriftsmäßig verhalten. Sie hängen mir nichts an.«
»Das habe ich auch nicht vor. Aber eine Frage hätte ich noch.«
Sie grinste. »Natürlich, Kommissar. Wie im Fernsehen. Eine Frage hätte ich noch.«
»Ich wüsste gern, wie das Verhältnis Knielings zu Otten war.«
»Sie galten als schwul. Das ist nicht gerade förderlich für das Zusammenleben mit anderen Inhaftierten.«
»Wie hat Otten den Tod Knielings aufgenommen?«
»Er gibt sich Mühe, normal zu erscheinen. Ich glaube aber, dass es ihn sehr mitgenommen hat. Er hat sich mehrfach übergeben und war einen Tag lang bettlägerig. Jetzt tut er so, als sei er drüber weg. Das nehme ich ihm nicht ab.«
***
Zurück in der Polizeiinspektion bekam Konnert einen Anruf seiner Tochter. »Wo steckst du? Ich versuche, dich seit zwölf Uhr zu erreichen. Du wolltest zu uns zum Mittagessen kommen. Du änderst dich auch nicht mehr. Du könntest wenigstens Bescheid sagen, wenn du verhindert bist.«
Konnert ließ sie reden. Als sie endlich schwieg, sagte er: »Entschuldigung. Ich war im Gefängnis. Es tut mir leid.«
Während seine Tochter weiterredete, erinnerte er sich an Vorwürfe seiner verstorbenen Frau. Ich werde wieder kontrolliert und muss mich rechtfertigen, ärgerte er sich und beendete das Gespräch mit dem Hinweis, dass er weiterarbeiten müsse.
Der Anruf von Dr. Landmann erreichte Konnert, als er sich gerade zurücklehnen wollte, um den bisherigen Verlauf des Tages zu durchdenken.
»Zwei Fakten sind vielleicht schon jetzt für euch von Bedeutung. Der Todeszeitpunkt liegt am Dienstagnachmittag zwischen 15 Uhr und 17 Uhr, plus/minus einer Stunde. Und Herzversagen ist definitiv auszuschließen.«
Nach dem Telefonat stopfte er eine Pfeife, zündete sie an, blies Qualmwolken an die Zimmerdecke und betrachtete sein Büro. Dabei kam ihm Lurtz-Brämisch in den Sinn. Wie stur hatte sie sich bei ihrem Amtsantritt im Frühjahr vor einem Jahr gegeben. Und das ausgerechnet in einer Phase, in der er sich müde und ausgebrannt gefühlt hatte.
Dann war er im Sommer mehr als zwei Monate im Urlaub gewesen und hatte obendrein noch Überstunden abgebummelt. Er hatte die Zeit genutzt, um jeden Tag zweimal eine halbe Stunde zu üben, mit zehn Fingern zu tippen.
Als er wieder ins Kommissariat zurückgekommen war, hatte man ihm einen neuen Computer hingestellt und auch ein Programm zur Spracherkennung installiert. Kilian hatte für die Anschaffung gesorgt. Tippen war out. Angesagt war nur noch das Korrigieren der falsch verstandenen Wörter. Natürlich lag die Fehlerquote nicht am Programm, sondern an Konnerts undeutlicher Aussprache, hatte Kilian behauptet.
Auch die Staatsanwältin war wie ausgewechselt gewesen. Sie zeigte sich zugänglich für Vorschläge und selbst bei der einen oder anderen Aktion am Rande der Legalität hatte sie ihnen den Rücken freigehalten.
Er blickte nachdenklich hinüber zu den Grünpflanzen auf der Fensterbank. Wie sich Situationen doch ändern können, stellte er fest und paffte.