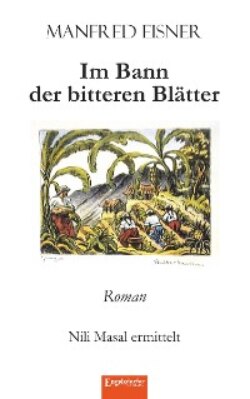Читать книгу Im Bann der bitteren Blätter - Manfred Eisner - Страница 8
2. Nili
ОглавлениеKriminaloberkommissarin Nili Masal legt betroffen den Telefonhörer auf. Sie ist erschüttert über das, was sie soeben von ihrer Freundin Melanie erfahren hat. Sie kennen sich seit ihren gemeinsamen Pennezeiten am Heilweg-Gymnasium in Hamburg, wo sie beide ihr Abitur bestanden haben. Auch in den Jahren danach ist ihr Kontakt nicht abgebrochen. Während Nili – so hatten ihre Eltern sie genannt, zu Ehren jener jüdischen NILI1-Untergrundorganisation, die schon während der türkischen Besatzungszeit bestrebt war, im Heiligen Land wieder einen eigenständigen Verbleib für Juden zu gestalten – ihre sechs Semester an der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in Altenhof bei Eckernförde sowie danach das Praktikum an der Polizeischule in Eutin absolvierte, trafen sie sich regelmäßig. Melanie machte zwischenzeitlich ihre Ausbildung als Finanzwirtin beim Finanzamt Kiel-Nord. Deswegen verbrachten die beiden Freundinnen die gemeinsamen Stunden meistens in Kiel, wo Nili auch gelegentlich im Hause der Westphals übernachtete und dabei die Bekanntschaft mit Melanies Halbbruder Ralph machte. Sie mochte den verträumten, netten jungen Mann und war auch ab und zu bei seinen gelegentlichen musikalischen Auftritten zugegen. Melanie hatte ihr später von der Entziehungskur berichtet und ebenso, äußerst erleichtert und froh, von Ralphs Wiederaufnahme des Studiums in Lübeck. Und jetzt diese furchtbare Nachricht!
Nili geht in den Toilettenraum der kleinen Polizeidienststelle in Oldenmoor, um sich die Tränen abzuwischen und das Gesicht zu waschen. Das Bild, das ihr oberhalb des Waschbeckens aus dem Spiegel entgegenblickt, ist das noch recht jugendliche, faltenlose Gesicht einer hübschen Enddreißigerin mit kurz gestylten, brünetten Haaren, freundlich blickenden dunkelbraunen Augen und einem sehr schön geformtem Mund. Der eng sitzende Rollkragenpulli verrät einen wohlproportionierten Busen, die blaue Uniformhose vermag es nicht vollständig, ihre weiblichen Rundungen zu kaschieren. Trotz der offensichtlich seelischen Belastung wegen des soeben Erfahrenen eine aparte und sympathische junge Frau. Ein wenig erholt von dem Schreck kehrt sie wenig später an ihren Arbeitsplatz zurück.
Ihrem wohlbeleibten Vorgesetzten, Hauptkommissar Boie Hansen, Leiter der Polizeidienststelle Oldenmoor, ist die Aufruhr, die das Telefonat bei seiner tüchtigen Mitarbeiterin verursacht hat, nicht entgangen. In seiner ihm eigenen, stets kurz gehaltenen Ausdrucksweise fragt er sie: „Nun vertell, mien Deern, wat hesst du op’m Haarten?“ Der umfangreiche Kahlkopf grient sie freundlich an. Auch der Kollege, Oberkommissar Hauke Steffens, hebt neugierig den Kopf.
Nili berichtet kurz von dem, was sie soeben erfahren hat. Dabei muss sie sich zusammenreißen, damit nicht wieder Tränen fließen.
„Ist wohl kein Einzelfall“, kommentiert Hauke Steffens. „Ich traf neulich durch Zufall auf Waldi Mohr, den Kieler Drogenfahnder. Er erzählte mir, es gäbe da neuerdings eine gemeine Bande, die es besonders auf jüngere Schüler und Studenten, die mit der Bahn zwischen Kiel und Lübeck pendeln, abgesehen hat.“
Nili reagiert spontan: „Könnte passen. Der Tote wohnte in Kiel und fuhr täglich mit der Bahn nach Lübeck. Melanie, seine Schwester, hat mir soeben erzählt, dass er vom Bahnhof aus immer mit seinem Fahrrad zur Hochschule fuhr.“ Sie überlegt einen Augenblick. „Er verstarb aber im elterlichen Steuerbüro in Kiel. Demnach müsste sein Drahtesel noch am Lübecker Bahnhof sein, oder?“
Boie Hansen greift zum Telefonhörer. „Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir diesem Waldi einen nützlichen Tipp geben können. Ich rufe das Kieler Drogendezernat an.“
„Ach, Chef, ich muss Sie um einen Gefallen bitten. Dürfte ich mir den Mittwoch freinehmen? Melanie bat mich, sie zu begleiten, um ihre Eltern vom Hamburger Flughafen abzuholen. Sie kommen an dem Tag aus dem Urlaub zurück und wissen noch gar nichts von dem Unglück.“
Boie Hansen grient abermals: „Dann fier man een paar Överstundn af, geiht in Ordnung!“ Anschließend spricht er in den Hörer: „Hier Hauptkommissar Boie Hansen, Polizeidienststelle Oldenmoor. Kann ich bitte Ihren – wie heißt der Waldi wirklich? –, also Ihren Kommissar Walter Mohr sprechen? Habe einen wichtigen Hinweis für ihn.“
Polizeimeister Willi Seifert betritt das Büro. Seine Ledermontur ist völlig durchnässt und an der linken Seite mit dem dunklen Schlamm der Marscherde verschmiert. „So’n Shiet aber ok!“ Wütend wirft er seinen Motorradhelm auf den Stuhl. „Beinahe hätte ich die Golfdiebe erwischt, da kommt mir doch so ein blödes Rehkitz in die Quere! Ich musste so stark bremsen, dass ich auf der nassen Fahrbahn mit meinem Krad inne Grippe geschliddert bin. Hatte noch Glück im Unglück, ist nichts Schlimmes passiert, aber die Kerle sind mir durch die Lappen gegangen. Ich habe die Kollegen in Wilster, Sankt Margarethen und Glückstadt per Funk alarmiert, aber ich glaube nicht, dass wir sie kriegen. Ganz schön dreiste Hunde! Brechen doch heute in aller Früh im Autohaus Scholz ein, holen sich den Schlüssel aus dem Laden und klauen einen nagelneuen schwarzen VW Golf GTI vom Hof!“
„Ja, wir haben Ihren Funkruf gehört, Seifert. Na, wir werden die Kerle schon fassen – früher oder später. Jetzt gehen Sie man erst mal nach Hause und ziehen sich um, in so einer Aufmachung können Sie ja hier keinen Staat machen.“ Diese Worte sind Boie Hansens Art, Trost zu spenden. „Dann bringen Sie Ihr Motorrad sicherheitshalber zur Inspektion nach Heiligenstedten, dort soll man sicherstellen, dass alles okay ist. Am besten, Sie fahren mit dem Transporter gleich mit, Seifert, und bringen ihn dann wieder her.“
Nili wirft ein: „Und auf der Rückfahrt fahrt ihr bitte beim Autohaus Scholz vorbei und holt euch die Bänder von der Überwachungskamera ab, ja? Wir sehen uns genau an, wer da alles in den letzten Tagen in den Geschäftsräumen war und den Laden ausbaldowert haben könnte. Sagen Sie mal, Seifert, Sie waren doch ziemlich nah dran am Golf. Wie haben Sie überhaupt bemerkt, dass es sich um den gestohlenen Wagen handelt?“
„Ich kam gerade von der Streifenfahrt zurück, da bemerkte ich im Rückspiegel, wie der schwarze VW plötzlich aus der Ausfahrt vom Jammertalweg kam. Ich wendete und nahm die Verfolgung auf. Die Typen gaben Gas und versuchten, in Richtung Brokdorf davonzujagen. Muss ein verdammt geübter Fahrer sein, er nahm die engen Kurven mit mindestens 120 Sachen, obwohl sie ja nur für 70 Stundenkilometer zugelassen sind. Beim Überholen eines Pkws drängten sie sogar einen entgegenkommenden Lieferwagen von der Straße, einen Sprinter. Ich hielt kurz an. Der Fahrer war okay und machte mir deutliche Zeichen, ich solle weiterfahren. Ich gab wieder Vollgas und kam allmählich ziemlich nahe ran, sie hatten ein Lübecker Kennzeichen, KS 727, am Heck. Irgendwann kam eine Kurve, ich musste runter vom Gas, und dann schoss plötzlich das verdammte Rehkitz quer auf die Fahrbahn.“
„Das Nummernschild ist ganz sicher gestohlen, aber wir checken es trotzdem.“ Nili greift nach dem Telefonhörer. „Und nun ab mit euch!“
***
Nili wartet schon vor ihrer Haustür, als Melanie in dem Mercedes Kombi ihres Vaters in die Theodor-Heuss-Straße einbiegt und neben ihr anhält. Sobald sie eingestiegen ist, fahren sie los.
„Vielen Dank, liebe Nili, dass du mich bei meiner so schweren Mission begleitest“, sagt Melanie und drückt ihrer Freundin fest die Hand.
„Ist doch selbstverständlich, wozu sonst hat man denn Freunde? Nochmals mein allerherzlichstes Beileid.“ Nili blickt auf ihre ganz in Schwarz gekleidete ehemalige Schulkameradin, die nur wortlos nicken kann. Sie selbst hat einen grauen Pulli und eine schwarze Hose angezogen.
„Wie geht es deiner Mutter?“, fragt Melanie etwas später.
„Ach, eigentlich wieder ganz gut!“ Nach einer kurzen Pause setzt Nili fort: „Seit sie auf dem Eulenhof der Familie Carstens ihre freilaufenden Hühner betreut, ist sie wieder ganz in ihrem Element.“
Danach schweigen sie. Während sie entlang der Bundesstraße in Richtung Autobahn und dann weiter nach Hamburg fahren, versinkt jede in ihren eigenen Gedanken.
Nachdem Nilis Großeltern, Heiko und Clarissa Keller, Anfang der fünfziger Jahre aus dem langjährigen Exil in Bolivien nach Oldenmoor zurückgekehrt waren, hatte ihre Mutter, Elisabeth Keller, damals noch Teenager, ihre beiden letzten Jahre bis zum Abitur in Hamburg verbracht. Danach machte sie aber ihren bereits in Bolivien gefassten Entschluss wahr, nach Israel auszuwandern. Eigentlich meinte Lissy, wie sie von allen genannt wurde, sie sei ja gewissermaßen nur „eine vierteljüdische Deutsche“, jedoch hatten sie die schwerwiegenden Begleiterscheinungen der argen nationalsozialistischen Ära, die sie, ihren Bruder Oliver und ihre Eltern zur Auswanderung genötigt hatten, derart geprägt, dass sie sich innerlich uneingeschränkt ihrem Judentum verbunden fühlte. Dies allerdings in einer absolut konfessionslosen Manier, denn ebenso wie ihr Vater und auch ihr Bruder hielt sie absolut nichts von irgendeinem Glauben und dessen Religionsausübung.2
In Israel eingetroffen, trat Lissy in den Kibutz Halonim in Galiläa ein, am Fuße der Golanhöhen ganz in der Nähe der damaligen Grenze zu Syrien gelegen, und gesellte sich dort zu den vielen Vereinskameraden ihrer vormaligen La Pazer jüdischen Jugendbewegung. Schon während der Kindheit war sie betont naturverbunden gewesen. In den zumeist auf der Hacienda ihrer Nennonkel und -tante verbrachten Schulferien hatte sie sich immer schon besonders für die Aufzucht und Hege von Federvieh interessiert. Diese Vorliebe brachte sie auch bald dazu, hauptsächlich im großen Hühnerstall des Kibutz, dem Lul, beschäftigt zu werden. In der La Pazer Jüdischen Primärschule, die sie sechs Jahre lang besuchte, hatte sie im einschlägigen Religionsunterricht eine solide Grundlage der alttestamentarischen hebräischen Sprache mitbekommen, die es ihr jetzt ziemlich erleichterte, sich rasch der neujüdischen Sprache, dem Iwrith, zu bemächtigen. Es dauerte dann auch nicht lange, bis sie bei der Kibutzleitung den Antrag stellte, Geflügelzucht wissenschaftlich zu studieren, wie ihre „Tante“ Frauke ihr in deren Nachlassbrief ans Herz gelegt hatte. Der Kibutz war erst kurz vor der Staatsgründung Israels von den aus mehreren südamerikanischen Ländern eingewanderten jungen Chalutzim3 gegründet worden und deshalb auch noch nicht besonders wohlhabend. Wegen seiner risikoreichen Grenzlage wurde er zudem von der syrischen Seite aus häufiger von marodierenden Eindringlingen heimgesucht und man stand deswegen stets in angespannter Wachsamkeit bereit. Dennoch rechnete man sich gute Zugewinnmöglichkeiten durch eine Erweiterung der Eier- und Geflügelwirtschaft aus und beschloss, neben Lissy auch ihren Mitarbeiter Iakov an eine spezialisierte Ausbildungsstelle zu entsenden und die dadurch entstehenden Kosten zu tragen. Mit ihrem Freund Ruben Masal, den Lissy noch aus ihrer La Pazer Zeit so gut kannte, weil er in der Bäckerei ihres Vaters gelernt und danach dort als tüchtiger Geselle gearbeitet hatte, war sie erst vor einigen Wochen eine engere Beziehung eingegangen. Ruben war deshalb auch überhaupt nicht begeistert von ihrer ganzwöchentlichen Abwesenheit im Internat, die sich voraussichtlich über die nächsten zwei Jahre erstrecken würde. Sie konnten sich ab jetzt nur an den Wochenenden sehen. Mit großem Eifer widmeten sich alsdann die beiden Ausgewählten ihrem Studium an der Landwirtschaftlichen Ruppin-Akademie in Hefer nordöstlich von Netanya, zwischen Tel Aviv und Haifa gelegen. Lissy war natürlich durch ihr Abitur im Vorteil und konnte ihrem Kollegen in den Fächern Mathematik, Chemie, Physik, Biologie und Englisch erfolgreich unter die Arme greifen. Bei der besonderen Ernährungslehre und den im zweiten Studienjahr schwerpunktmäßig gelehrten Fächern Tierheilkunde und Anatomie sowie Futterlehre traf sie aber ebenso auf Neuland wie Iakov. Dieser revanchierte sich jedoch, indem er anfänglich manche bei Lissy noch vorhandene Sprachlücke überbrückte, denn das Studium stellte nicht alltägliche Forderungen an die Eleven.
Liliths – wie Lissys neuer hebräischer Name in Israel lautete – Liebesbeziehung zu Ruben blieb nicht lange ohne Folgen und so brachte sie ihren Sohn fast gleichzeitig mit der erfolgreichen Beendigung des Studiums zur Welt. Beide hatten anlässlich der Anwesenheit eines Rabbi im Kibutz noch vor der Geburt geheiratet und durften nun gemeinsam mit dem Neugeborenen von den bisherigen Junggesellen-Schlafgemächern in ihren bescheidenen Shikun – eine kleine Behausung für Ehepaare – umziehen.
Zur Erinnerung an Lissys so sehr verehrten Großvater Hans-Peter von Steinberg gaben sie dem Jungen den Namen Hanan-Peres, damit wenigstens die Anfangsbuchstaben übereinstimmten. Kurz nach der Geburt und dem Einzug in ihr neues Zuhause konnten sich beide Eltern wieder ihren Aufgaben – Ruben in der Bäckerei, Lilith mit ihren Hühnern – voll widmen. Ebenso wie alle anderen Neugeborenen im Kibutz umsorgten tagsüber geschulte Kleinkinderbetreuerinnen ihren Sprössling im Hort. Gemeinsam mit ihrem Fachkollegen Iakov und einigen weiteren Kameraden machte Lilith den Ausbau des Luls zu ihrer Lebensaufgabe. Die Stallungen wurden erweitert und den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen angepasst. Allerdings hatte man sich gleich zu Beginn für eine artgerechte Bodenhaltung der Tiere entschieden, anstatt sie in jene engen Legebatterien zu pferchen, die gerade damals überall als State of the Art in Mode gekommen waren. Lilith sah ihre Schützlinge immer noch eher als Geschöpfe und nicht nur als nackte Brathändelspießkost oder Eierlegemaschinen an. Dennoch war ihre Arbeit und die des Teams erfolgreich, und schon bald konnte das landwirtschaftliche Gemeinschaftsunternehmen einen guten Gewinn aus der Hühnerzucht und der Eierproduktion erwirtschaften.
Alles wäre so schön gewesen, wäre da nicht immer wieder zwischendurch die grausame Gegenwärtigkeit des Krieges aufgetaucht. Seit der Staatsgründung war Israel der Bedrohung durch die umliegenden feindlichen Nachbarn ausgesetzt, zu der sich nun auch der Terror der Palästinensischen Befreiungsorganisation PLO unter Jassir Arafat summierte. Die während des Befreiungskrieges teils geflüchteten, teils verjagten Araber hatten zwar in den umliegenden Ländern ungeliebte Zuflucht, aber keinerlei Integration oder gar eine neue Heimat gefunden. Sie wurden von deren Regierenden wohlweislich in elenden Flüchtlingscamps zusammengedrängt und lebten dort unter sehr prekären Bedingungen – eine probate Methode, um ihren Hass auf Israel zu wahren und weiter zu schüren. Neben den immer wieder vorkommenden militärischen Kriegsscharmützel, die meist von der israelischen Armee erfolgreich abgewehrt werden konnten, waren es die oft vorkommenden Kommandoaktionen von PLO-Attentätern, die alle Grenz-Kibutzim und -städte zur kontinuierlichen und erhöhten Wachsamkeit zwangen. Auch Halonim befand sich in einer dieser unmittelbaren Gefahrenzonen und blieb nicht von solchen hinterhältigen Attacken verschont, die von meist im Schutz der Dunkelheit heranrobbenden, mordlüsternen Tätern durchgeführt wurden.
Ständig waren deswegen Wachen an den strategisch relevanten Posten aufgestellt und inspizierten aufmerksam das umliegende Gelände. Dennoch geschah es eines Tages, dass es einem dieser Täter gelang, sich während der sengenden Mittagshitze unbemerkt bis in die Nähe des Kinderhorts heranzuschleichen und zwei Handgranaten durch ein Fenster auf die wehrlosen Kleinen zu werfen. Eine der Betreuerinnen schaffte es noch, sich zu opfern, indem sie versuchte, mit ihrem Körper die Granatenexplosion von den Kindern abzuschirmen, die andere Granate explodierte jedoch ungehindert im Raum und verursachte ein Massaker: Sieben Kinder, darunter auch der gerade einjährige Hanan-Peres Masal, waren auf der Stelle tot, vierzehn andere teils schwer verwundet. Leider eine halbe Minute zu spät entdeckte man den Attentäter vom Wachturm aus und tötete ihn mit gezielten Schüssen. Der Schock traf die ganze Gemeinschaft zutiefst. Mit einem Schlag hatte der Mörder fast zwei Drittel der Kibutz-Nachkommenschaft vernichtet oder schwer verletzt. Untröstlich die Eltern der Getöteten, schwer traumatisiert jene der Verletzten. Verständliche Rachegefühle wurden geweckt. Während eines nächtlichen bewaffneten Überfalls auf ein unweit gelegenes syrisches Dorf auf dem Golan, in dem sich auch ein PLO-Stützpunkt versteckte, gelang es, fünf weitere dieser Terroristen unschädlich zu machen. Aber auch dies konnte das junge verblutete Leben nicht wiederbringen. Lilith musste drei Monate in einem Nervensanatorium verbringen, um über ihre schwere Depression hinwegzukommen. Als begleitende Therapie begann sie wieder mit dem Flötenspielen, das ihr schon damals in Bolivien und danach auch in ihrer Hamburger Gymnasialzeit so viel Freude bereitet hatte. Das geliebte Instrument hatte sie zwar während ihrer Auswanderung nach Israel begleitet, doch sie war seitdem nicht dazu gekommen, ihr vormals so geschätztes Hobby weiter zu betreiben.
Erst allmählich schwand der tiefe Schmerz beider Eltern über den grausamen Verlust und es stellte sich mit dem Ablauf der Jahre wieder ein gewissermaßen normaler Alltag ein. Als dann 1972 Lilith schon fast 38 Jahre alt war, schenkte sie Ruben eine Tochter, die sie Nili nannten. Bald danach schlug bei den Masals abermals und unerbittlich das grausame Schicksal zu: Israel war nach den vergangenen, für sie erfolgreich beendeten Kriegen bedauerlicherweise gegenüber den Arabern zu hochmütig geworden und wog sich in einer fatalen, falschen Sicherheit. Während des Jom-Kippur-Krieges im Herbst 1973, der den Staat für einen Moment an den Rand des Untergangs brachte, fiel Ruben bei einem der schweren Artillerie-Angriffe der Syrer, die danach trachteten, ihre im Sechstagekrieg von 1967 eingebüßten Golanhöhen zurückzuerobern. Der simultan ausgeführte ägyptisch-syrische Überfall, der gerade am heiligsten jüdischen Feiertag begann, wurde nach tagelangen Kämpfen im Sinai und am Golan mit äußerst hohem und bitterem Blutzoll zurückgeschlagen und endete dann allerdings abermals mit der militärischen Niederlage der hinterlistigen Angreifer. Der Kibutz Halonim jedoch wurde schwer getroffen, Liliths langjähriges Aufbauwerk, ihre Hühnerstallungen im Lul, Opfer der feindlichen Granateneinschläge. Ihr Bruder Oliver holte kurz danach seine abermals traumatisierte und nun verwitwete Schwester samt der gerade einjährigen Nili zu sich nach Oldenmoor, wo sie von da an verblieben.
***
Abrupt werden Nilis Reminiszenzen bei der Einfahrt des Mercedes in die Ankunft-Parkgarage am Fuhlsbütteler Flughafen unterbrochen. Da die Ankunftstafel eine zwanzigminütige Verspätung der Lufthansamaschine aus Frankfurt meldet, lädt Melanie Nili zu einer Tasse Kaffee an der kleinen Bar in der Ankunftshalle ein.
„Wie soll ich es ihnen nur beibringen?“ Melanie bricht verzweifelt in Tränen aus.
Nili legt einen Arm um sie. „Mach dir keinen Kopf, Melanie, überlasse es einfach deiner momentanen Eingebung. So etwas lässt sich nicht planen, es ergibt sich von selbst.“ Jedenfalls eilt Nili rasch voran, als das Ehepaar Westphal an der Ausganstür erscheint, und kann gerade noch Antje Westphal unter die Arme greifen, als diese beim Anblick der schluchzenden Melanie in den Armen des Vaters instinktiv das geschehene Unglück erahnt und sie die Kräfte verlassen.
Nachdem das erheblich mitgenommene Ehepaar sich ein wenig vom ersten Schock erholen konnte, fahren sie zurück nach Kiel. Nili lenkt den Wagen, neben ihr sitzt der mit steinerner Miene vorausstierende Vater. Im Fond hält Melanie tröstend ihre weinende Stiefmutter in den Armen. Nili berichtet ihnen in knappen Worten, was sich bezüglich Ralph zugetragen hat, und auch ein wenig von dem, was die bisherigen Ermittlungen ergeben haben. Nachdem sie den Wagen in der Kieler Garage der Westphals abgestellt hat, verabschiedet sie sich. „Nein, du brauchst mich nicht zurückzufahren, Melanie, ich komme schon zurecht. Du solltest jetzt vielmehr bei deinen Eltern bleiben, das ist wichtiger!“
Der halbstündige Fußweg bis zur Bezirkskriminalinspektion in der Blumenstraße tut ihr gut, um ein wenig von der Anspannung der letzten Stunden herunterzukommen. In all den Jahren als Polizistin konnte sie immer noch nicht jenes tiefe Mitleid von sich abschütteln, das sie stets gegenüber den von schlimmen Schicksalsschlägen betroffenen Hinterbliebenen empfindet. Wie leichtfüßig raten ihr immer wieder Psychologen und seelische Betreuer bei solchen Geschehnissen, sie solle möglichst Distanz zu den Opfern wahren und sich mit deren Leid nicht allzu sehr identifizieren. „Leicht gesagt, aber überwinden Sie zunächst einmal selbst die eigenen Gefühle nach dem herben Verlust des ermordeten kleinen Bruders, den ich nie kennenlernen konnte, und des geliebten, von feindlichen Granaten getöteten Vaters!“ Gerade als Nili das massive Backsteinpolizeigebäude betreten will, kommen ihr die Kollegen, die Oberkommissare Steffi Hink und Sascha Breiholz, entgegen.
„Mensch, Nili, was machst du hier? Wolltest du uns besuchen?“
Sie kennen sich von früheren gelegentlichen Zusammentreffen und Fortbildungskursen. Einige Male haben sie auch schon wirksam bei der Bildung von ortsübergreifenden Soko-Einsätzen zusammengearbeitet. Nachdem Nili von der Ankunft des Ehepaars Westphal berichtet hat, fragt sie, ob sich inzwischen in dem Fall etwa Neues ergeben hat.
„Du kommst gerade richtig, wir sind auf dem Weg zum Pathologen im Institut für Rechtsmedizin der Universität Kiel. Professor Klamm rief soeben an, er hat den Bericht fertig. Möchtest du uns begleiten? Dann erfährst du alles aus erster Hand.“
Prof. Dr. Christoff Klamm, ein noch jugendlich wirkender Mittvierziger, begrüßt sie im grünen Kittel an der Tür zum Obduktionssaal. Vier vollständig zugedeckte Leichenkörper liegen auf den rostfrei-stählernen Seziertischen unter Leinentüchern, ein jeder mit einem Identifikationsetikett, das am großen Zeh von einem Band herunterhängt. Nili kann den kalten Schauer, der ihr den Rücken herunterfährt, nicht unterdrücken. Er befällt sie immer wieder beim Betreten solch makabrer Stätten.
„Ralph Westphal, männlich, Alter 25 Jahre, Statur 1 Meter, 80 Zentimeter, Gewicht 79 Kilogramm.“ Der Professor deckt das Tuch über dem Kopf der Leiche auf. Ralphs Gesichtszüge zeigen eine leichte Anspannung. Als ob er einen starken Schmerz empfände, denkt Nili. „Der Tod trat am vorigen Sonnabend gegen Mittag ein. Er wurde verursacht von einem akuten Herzinfarkt als unmittelbare Folge einer überstarken Dosis Kokain, die der Betroffene sich selbst kurz davor durch die Nase zugeführt hat. Da er sich dazu eigens in einer Toilette eingeschlossen hatte, ist Fremdeinwirkung auszuschließen. Das ist das Ergebnis der ebenfalls durchgeführten forensischen toxikologischen Untersuchung. Kokain ist bei Weitem tückischer, als viele glauben. Es ist sogar eine sehr gefährliche Droge, die nicht nur innerhalb kürzester Zeit zur Abhängigkeit führt, sondern lebensbedrohliche Schäden am Herzen verursachen kann. Der Verstorbene galt zwar als von seiner vormaligen Kokainsucht geheilt, hatte sich aber als deren Folge bereits eine Angina Pectoris, also eine Herzmuskelschwäche, zugezogen. Deswegen wurde ihm der Konsum dieses Mal zum Verhängnis. Aufgrund der plötzlichen Zufuhr des starken Gifts verkrampften sich die geschwächten Herzgefäße schlagartig und der akute Sauerstoffmangel verursachte schließlich den Herzstillstand. Es ist bedauerlich, dass nur sehr wenige Kokainschnupfer über die Gefährlichkeit ihres leichtsinnigen Tuns Bescheid wissen. Koksen gilt ja sogar bis in die hohen gesellschaftlichen Kreise als ungemein schick!“ Nach einer Pause setzt Prof. Dr. Klamm hinzu: „Übrigens, was bei der toxikologischen Untersuchung besonders auffiel, war die ungewöhnliche Reinheit des Stoffes. Entgegen des üblicherweise für den Konsum mit anderen Zutaten wie Puderzucker oder Stärke gestreckten Pulvers, das dann nur etwa 34 bis 36 Prozent der Droge enthält, handelt es sich bei den neben der Leiche gefundenen Spuren und geringfügigen Restmengen seltsamerweise um 95-prozentig reines Kokain. Dies bewirkte wohl auch das fast sofortige Auslösen des Herzinfarktes.“
„Könnte man aus diesem doch nicht alltäglichen Drogenbefund vielleicht den Verdacht auf eine arglistig beabsichtigte Herbeiführung oder zumindest Inkaufnahme der wahrscheinlichen Todesfolge ableiten?“
Auf Nilis Frage folgt eine Denkpause aller Beteiligten.
„Sie denken an Totschlag oder Körperverletzung mit Todesfolge? Ausschließen möchte ich dies nicht, es kann durchaus sein, dass jener, der diesem Verstorbenen eine derart hoch letal dosierte Droge vermittelt hat, in einer solchen Absicht gehandelt haben könnte.“ Prof. Dr. Klamm zuckt mit den Schultern. „Dürfte allerdings schwer zu beweisen sein, denke ich mal. Aber vielleicht hilft Ihnen dies ein wenig weiter: Uns ist noch etwas Wesentliches an der Kleidung des Toten aufgefallen: Er muss, wenn vielleicht nicht gerade am Tage seines Todes, dann zumindest am Vortage, Geschlechtsverkehr gehabt haben. Wir haben fremde DNA von seiner Kleidung isoliert, diese wird noch untersucht. Schriftlicher Bericht folgt auf dem Amtswege.“
Die drei Oberkommissare danken und verabschieden sich von dem Pathologen. Beim Herausgehen bemerkt Sascha Breiholz: „Und um nochmals auf deine Frage, liebe Nili, zurückzukommen: Wir müssten erst einmal den Übeltäter eindeutig ausmachen.“
„Ich befürchte auch, dass in diesem dubiosen Fall der Staatsanwalt die Akte mit dem Vermerk ‚Versehentliche Selbsttötung durch Drogenkonsum‘ schließen wird.“
Steffi Hink setzt fort: „Aber dies bedeutet keineswegs, dass wir nicht weiterhin mit allen verfügbaren Kräften nach der Pendlerdrogenbande fahnden, die wir auch hierfür verantwortlich halten. Kollege Waldi hat jedenfalls dank deines klugen Hinweises auf Ralph Westphals Fahrrad am Lübecker Bahnhof schon einen Kandidaten ins Visier genommen.“
Während sie zum Wagen gehen, bittet Steffi: „Nili, könntest du deine Freundin, Frau Westphal, fragen, ob ihr Bruder vielleicht eine weibliche Beziehung hatte? Ich meine, wegen der Einordnung der DNA, die Prof. Klamm soeben erwähnte.“
„Ich frage nach und lasse es euch wissen, okay?“ Nili fährt fort: „Ich danke euch. Übrigens, ich würde gern euren berühmten Waldi kennenlernen. Könnt ihr mir bitte seine Handynummer geben?“
***
Wenige Tage später sitzt Walter Mohr alias Waldi an einem Tisch im Restaurant des Lübecker Hauptbahnhofs vor dem halb vollen Glas Latte macchiato und zieht gelegentlich ganz in Gedanken versunken an seiner kalten Pfeife, während er, so scheint es, in die Lektüre der Lübecker Nachrichten vertieft ist. Dem uneingeweihten Beobachter erscheint der in einem edlen Harris Tweedanzug gekleidete stramme Vierziger mit seiner leicht ergrauten lockigen Haarmähne, der altmodischen vernickelten Brille und dem gepflegten Kinnbärtchen wohl eher wie ein Gelehrter als ein Zivilfahnder des Drogendezernats. Unauffällig, jedoch aufmerksam beobachtet er das ungleiche Paar, das in der Ecke des Lokals sitzt und sich angeregt unterhält. Der Mann, offensichtlich ein aus Afrika stammender schwarzer Migrant, redet eindringlich auf sein Gegenüber ein, eine recht hübsche und zierliche weibliche Person mit langem schwarzem Haar und orientalischen Zügen. Den Afrikaner hat er schon vor einigen Tagen am Hauptbahnhof ausgemacht, als dieser sich unbeobachtet glaubte und mit einer Klauenzange die Sicherungskette an Ralph Westphals Fahrrad durchtrennte, um sich danach geschwind auf diesem aus dem Staub zu machen. Anhand der von Waldi heimlich geschossenen Fotos hatte man den Fahrraddieb mit Hilfe der Ausländerbehörde als den dort registrierten Asylantragsteller Mustafa Mbili, 23 Jahre alt, aus Uganda stammend, identifiziert, der sich gelegentlich und meist heimlich, da unerlaubt, als Sonnenbrillen- und Billigschmuckverkäufer in der Stadt herumtrieb und dabei schon einige Male aufgegriffen worden war. Dagegen ist es den Behörden bisher nicht gelungen, die Identität seiner gelegentlich mit ihm beobachteten Begleiterin auszumachen, weil die von ihnen gemachten Fotos zu keinem Ergebnis führten.
Nachdem Mbili gezahlt hat, brechen die beiden auf. Unauffällig werden sie von einem Zivilfahnder, der am Zeitungsstand gewartet hat, bis zu dem Bahnsteig verfolgt, von dem aus in wenigen Minuten der Pendlerzug nach Kiel abfahren wird. Nach einem kurzen Blick auf die Armbanduhr trinkt Waldi seinen Milchkaffee aus und legt ein paar Euromünzen auf den Tisch. Dann steckt er die Pfeife in die Tasche, faltet seine Zeitung zusammen und schlendert gemächlich aus dem Restaurant in die gleiche Richtung wie seine beiden Vorgänger. Zahlreiche jugendliche Gymnasiasten und Studenten warten inzwischen am Bahnsteig auf die Einfahrt des Zuges. Als dieser kurz drauf zum Stillstand kommt, huschen sie eiligst durch die Waggontüren auf der Suche nach ihren bevorzugten Sitzplätzen. Mit Blickkontakt zum Kollegen, der am Zuganfang einsteigt, geht Waldi gemächlich bis zum letzten Waggon, nachdem er sich vergewissert hat, dass sowohl der Afrikaner als auch seine Begleiterin in getrennte Zugabteile eingestiegen sind. Unauffällig setzt er sich in die hinterste Abteilreihe und bemerkt sogleich sehr zufrieden, dass der kahlköpfige und berüchtigte Dealer Drogenmatti soeben an ihm vorbeikommt und in den nächsten Waggon weitergeht. Ihm folgt auf dem Fuß ein Waldi bisher unbekannter dunkelhaariger Mann mittleren Alters, sehr dünn und von kleinerer Statur. Als sich der Zug in Bewegung setzt und aus dem Bahnhof fährt, greift Waldi in die Jackentasche, holt sein Handy heraus und sendet eine vorbereitete SMS. Dann wählt er eine Nummer und spricht rasch einige kurze Worte in den Apparat. Schließlich beobachtet er befriedigt, dass die Antennenanzeige auf seinem Display verschwindet und kein verfügbares Netz mehr angezeigt wird.
„So ’ne Scheiße!“, lässt ein frustrierter Tablet-User verlauten, als nahezu gleichzeitig sein Bild einfriert und dann die Ankündigung „Sie sind mit keinem Netzwerk verbunden“ auf dem Display erscheint. Noch bevor der Zug an der nächsten Haltestelle in Bad Schwartau ankommt, quietschen plötzlich die Bremsen und er hält abrupt auf offener Strecke. Als wären sie vom Himmel herabgefallen, postieren sich schwer bewaffnete Polizisten des Sondereinsatzkommandos an sämtlichen Waggontüren. Eine Stimme ertönt durch die Lautsprecher: „Achtung, Achtung. Hier spricht die Polizei. Dies ist eine Personenkontrolle. Bitte bewahren Sie Ruhe und bleiben Sie unbedingt auf Ihren Plätzen sitzen. Halten Sie Ihre Fahrkarten und Ausweispapiere zur Kontrolle durch unsere Beamten bereit. Ich wiederhole.“ Eine weibliche Stimme wiederholt die Ansage nun auch in englischer und französischer Sprache. Je drei Beamte in schusssicheren Westen mit der weißen Aufschrift „POLIZEI“ kommen in jeden Waggon, der jeweils erste mit einer Maschinenpistole im Anschlag. Die beiden anderen kontrollieren die Ausweise der Reisenden. Ihnen folgt ein Kontrolleur der Deutschen Bahn, der die Fahrkarten überprüft. Diejenigen Personen, die sich nicht ausweisen oder keinen gültigen Fahrausweis vorweisen können – und es sind einige davon betroffen –, werden höflich, aber bestimmt gebeten, zur vorderen Waggonplattform zu gehen. Dort verlassen die Schwarzfahrer den Zug durch die linke Tür und werden in einem improvisierten, auf dem Nebengleis stehenden Bürowaggon registriert. Jene, die sich nicht ausweisen können, verlassen den Zug durch die rechte Waggontür. Letztere, davon einige bereits in Handschellen, steigen in die neben dem Gleis stehenden Polizeibusse und werden unter scharfer Bewachung ins Polizeipräsidium nach Kiel gebracht. Die ganze Operation hat keine zehn Minuten gedauert und der Zug kann schließlich seine Fahrt fortsetzen. Mit Genugtuung beobachtet Waldi von seinem Fenster aus, dass sich alle „seine“ Zielpersonen unter den Abgeführten befinden. Während der Aktion ist er auf seinem Platz sitzen geblieben. Als er sieht, dass sein Handy wieder am Netz ist, wählt er erneut eine Nummer an. „Hat alles wie am Schnürchen geklappt, diesmal haben wir die schrägen Vögel im Käfig!“
Als der Zug im Bad Schwartauer Bahnhof anhält, steigt er aus und schlendert zum Parkplatz, wo sein unauffälliger alter Variant Kombi schon seit einigen Stunden geduldig auf ihn wartet. Belustigt steckt er das Knöllchen, das ihm unter dem Scheibenwischer im Wind entgegenflattert, in die Tasche. „Geht auf Geschäftsspesen“, ulkt er und fährt los.