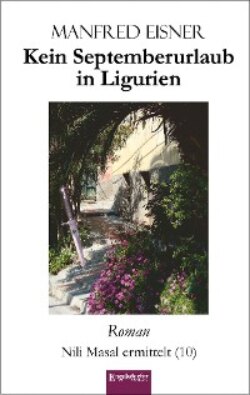Читать книгу Kein Septemberurlaub in Ligurien - Manfred Eisner - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Morbus Chagas
ОглавлениеAhnungslos schläft, inmitten von Bananenbäumen und den mit Cocasträuchern überwucherten Terrassen der Hacienda in den subtropischen Yungas, die kleine indigene Familie Pomacahua in der ärmlichen, strohgedeckten Adobehütte auf den direkt auf dem Erdboden liegenden, traditionellen grell gestreiften Teppichen aus Lama-Schurwolle. Mühelos und unbemerkt verschafft sich die hungrige Vinchuca 4 zwischen den Strohhalmen Einlass und krabbelt die Wand herunter, um ihren Stachel in der Wange des kleinen Ch’ama zu versenken und gierig dessen Blut zu saugen. Nachdem sich die Raubwanze satt gesogen hat, lässt sie von ihrem Opfer ab und verschwindet ebenso lautlos und verdeckt, wie sie eingedrungen ist. Als Reaktion tritt lediglich eine kleine entzündete Schwellung mit Rötung um die vom Insekt erzeugte Stichwunde auf, deren fatale Folgen zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnen kann. Der Dreijährige leidet seit seiner Geburt an Unterernährung und Rachitismus. Wie bei zahlreichen Indiokindern in den ländlichen Regionen Boliviens ist dies der bittersten Armut sowie dem Mangel an ordentlichen Möglichkeiten zur adäquaten Lebensmittelversorgung geschuldet. Wegen der daraus resultierenden Abwehrschwäche tritt bei dem kleinen Jungen schon bald eine akute Phase mit hohem Fieber, Atemnot- und Krampfanfällen, Bauchschmerzen sowie Durchfall auf.
Hilflos und verlassen, sozusagen inmitten vom Niemandsland, ist die Familie Pomacahua, ebenso wie alle anderen Peones, jene geschundenen Landarbeiter, die für den in der neunzig Kilometer entfernten Großstadt La Paz residierenden Gutsherrn dessen Besitz beackern und für ihn die gewinnbringenden Cocablätter ernten, um sie anschließend in der Sonne zum Trocknen auszubreiten. Zuletzt pressen sie die Blätter in 25 Kilo schwere ›Taques‹, die Großsäcke, in denen sie vermarktet werden. Drei anstrengende Stunden Muli-Weg trennen sie dann von der mörderischen, einspurigen ungepflasterten Landstraße, die sich aufgrund der alljährlich wiederkehrenden Erdlawinen und zahlreicher abgestürzter Lkws und Busse ihren makabren Beinamen ›Camino de la Muerte‹ blutig verdient hat.
Die Straße verbindet die Regierungsresidenzstadt Boliviens La Paz mit dem Hauptort Chulumani in den südlichen Yungas, in dem sich die einzige klinische Einrichtung der Region befindet. Nach einigen Tagen entsetzlichen Leidens beschließen die Eltern, den schwer erkrankten Ch’ama in das dortige Hospital Municipal zu bringen. Liebevoll legt Mutter Josefa ihren Sprössling in einen mit einem wollenen Gewebe ausgelegten Korb, den Vater Mariano schließlich auf dem Satteldeckel seines Mulis mit roh gegerbten Rindlederriemen befestigt. Nachdem Josefa sich den zunächst mit Windeln und Reiseproviant gefüllten Aguayo5 um die Schultern gebunden und diesen vorn an der Brust fest verknotet hat, machen sie sich auf die lange Wanderung. Diese führt sie in langgezogenen ständigen Serpentinen auf holprigem Boden stets bergabwärts. Im Tal des wild fließenden Rio Tamampaya angelangt, folgen sie noch etwa achthundert Meter der Straße, bis sie an der kleinen Hütte Casa Blanca in Puente Villa angelangt sind, in der die Witwe Quispe die Pulpería, einen kleinen Kolonialwarenladen, betreibt. Hier lädt Mariano seinen Sohn vom Sattel ab und Josefa wickelt den abgemagerten und jammernden Kleinen neu, bevor sie ihn in ihren Aguayo einhüllt und sich diesen um die Schultern schwingt. Sie müssen nicht lange warten, bis sich der erste Camión nähert und auf ein Zeichen Marianos hin anhält. Zäh verhandelt der Vater mit dem Lkw-Chauffeur um einen möglichst niedrigen Fahrpreis. Ein junger Mann steigt vom Beifahrersitz, um Josefa und ihrem Ch’ama Platz zu machen, und klettert geschwind auf die Ladefläche. Traurig winkend verabschiedet sich Josefa von ihrem Ehemann, der sodann in der Pinte einkehrt, um sich einige Gläser Pisco hinter die Binde zu gießen.
Erst kurz vor Sonnenuntergang torkelt er auf die Straße und schwingt sich mühevoll auf den Sattel seines Mulis, um nach Hause zu reiten. Puente Villa ist sumpfiges Malariagebiet und er muss sich beeilen, so rasch wie möglich in höhere Regionen zu gelangen, in denen die Anofelesmücke nicht herumschwirrt.
*
Glubda Patak, ein kleines, dürres Männchen Mitte fünfzig mit einem weißen Haarkranz rund um die Glatze, ist Doktor der Chemie und hat an der Universität in Delhi promoviert. Er leitet das Versuchslabor in der Mumbai-Niederlassung der deutschen Firma Pharmasalutem, die in Indien ihr ›Wunderheilmittel‹ Haemodioxy für den Weltmarkt herstellen lässt und es von hier aus weltweit vertreibt, da es in der Bundesrepublik Deutschland nicht zugelassen ist. Hierzulande dürfen als Arzneimittel Produkte nur dann in den Handel gelangen, wenn durch ein behördliches Zulassungsverfahren ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis bestätigt wird. In Wahrheit ist die dubiose Substanz jedoch nichts anderes als MMS: ein kontrovers diagnostiziertes und viel diskutiertes Pseudomedikament, in der Fachwelt üblicherweise als ›Miracle Mineral Supplement‹ – frei übersetzt: ›Wunder-Mineralergänzung‹ – bezeichnet. Weltweit von mehreren Unternehmen mit zweifelhaftem Ruf hergestellt, erfolgt der Verkauf dieses bedenklichen Präparates und dessen Vertrieb zumeist über unqualifizierte Versorger und Spam-E-Mails im Internet. Was wird nicht alles diesem fragwürdigen Allheilmittel zugedichtet: Für AIDS, Hepatitis A, B und C, Malaria, Herpes, Tuberkulose, chronische Infektionen, die meisten Krebsformen und viele andere ernste Erkrankungen verspricht es eine Lösung; all diese sowie andere Virenkrankheiten lassen sich damit angeblich erfolgreich bekämpfen. Dabei ist der Wirkstoff kein anderer als das hochriskante Natriumchlorit – nicht zu verwechseln mit Natriumchlorid, unserem alltäglich verwendeten Kochsalz!
Aus Natriumchlorit und einer hinzugefügten verdünnten Säure entsteht Chlordioxid, das auf Haut und Schleimhaut je nach Konzentration reizend bis ätzend wirkt. Die Anwendung kann zu erheblichen Gesundheitsgefahren führen, einen nachweislichen Heileffekt hat sie allerdings nicht. Anders als ihre Mitbewerber, die das flüssige MMS üblicherweise in Zwei-Komponenten-Fläschchen vertreiben, ist es Pharmasalutem dank eines eigenen Verfahrens gelungen, die Substanz durch Zugabe eines besonderen, geheim gehaltenen Wirkstoffs als Pulver in einer einzigen Kapsel mit Langzeitwirkung zu vereinen. Es gibt sie in Dosierungen von 5, 10 und 20 Milligramm, ebenso aber auch als fertige Infusionsbeutel für den klinischen Betrieb.
Doktor Patak bereitet sich an diesem Tag auf hohen Besuch aus Bolivien vor: Der Oficial Mayor – vom Rang her ähnlich wie ein Staatssekretär – des Gesundheitsministeriums ist extra in Begleitung einiger enger Mitarbeiter aus La Paz angereist, um den Kaufvertrag mit der Pharmasalutem für die Lieferung einiger Zehntausend Kapselpackungen und Infusionsbeutel des Präparates abzuschließen. Dr. Dr. Alfred Pahl, Geschäftsführer, und Dr. pharm. Kurt Eisenmann, Vertriebsleiter der Kieler Muttergesellschaft, hatten dem bolivianischen Gesundheitsministerium das Produkt vor einigen Monaten als unfehlbares Heilmittel gegen die vorwiegend in den subtropischen Regionen der Republik grassierende Chagas-Krankheit angepriesen und deren Wirksamkeit zugesichert. Gegen die unter der Hand geleistete Zusage über die ›nützliche Beigabe‹ eines Nobelmarken-Cabrios für die Ehefrau des Herrn Minister wurde schließlich ein ›bilateral vorteilhaftes Geschäft‹ angebahnt.
Um die umständlichen EU-Ausfuhrmodalitäten für Arzneimittel zu umgehen, hatte man sich heimlich darauf geeinigt, das Haemodioxy aus der Produktion im indischen Zweigbetrieb zu liefern. In Wirklichkeit existiert überhaupt keine Herstellung dieser Arznei im Hauptwerk Bredenbeker Gewerbepark, denn hier fabriziert die Pharmasalutem andere, eher harmlose, aber ebenso zweifelhafte Nahrungsergänzungsmittel und fantasievolle Heilungserzeugnisse, die in vielversprechenden Anzeigen in der Regenbogenpresse beworben werden. Um jedoch den wahren Ursprung des Mittels zu verschleiern, sollten die Verpackungen für Bolivien den Aufdruck ›Produced in the EU‹ erhalten. Für das Vermeiden der in Deutschland anfallenden satten Gewinnversteuerung hatte die Muttergesellschaft ebenfalls vorgesorgt. So sollten die fälligen Euro-Zahlungen von einer Briefkastenfirma im steuergünstigeren irländischen Cork fakturiert und auf eines von deren Konten überwiesen werden – eben EU.
Die hochkarätige bolivianische Delegation – Staatssekretär Vicente Amaru Mamani, der Leiter des nationalen Gesundheitsamtes, Dr. med. Alejandro Pacheco Ruiz, die Direktorin der bolivianischen Agentur für die Indigene Gesundheitsversorgung, Licenciada Rosa Angélica Choque de Rojas sowie ein Sicherheitsbeauftragter der politischen Polizei, Coronel Juan Carlos Bravo Cornejo, – wird am Flughafenterminal in Mumbai von den beiden deutschen Geschäftsleuten persönlich in Empfang genommen und in einer Stretchlimousine zum Taj Mahal Palace Hotel gefahren. Hier sollen sie sich erst einmal von dem langen und strapaziösen Flug erholen, bevor sie am nächsten Tag ein imposantes Pharmawerk im Chemie-Industriepark der gigantischen Metropole Indiens besichtigen – ein von den listigen Pharmasalutem-Bossen gemietetes Schauobjekt, das sie den Gästen als ihr eigenes vorgaukeln. Nach der feierlichen, von blumigen Reden begleiteten und mit einem Champagnerfrühstück gekrönten Vertragsunterschrift – beigesellt von der obligaten Übergabe von mit allerhand Barem gefüllten Umschlägen an die Käufer – wird am Abend der hocherfreuliche Anlass mit einem üppigen Galadiner im renommierten Peshawri-Restaurant gebührlich gefeiert.
Am nächsten Vormittag verabschieden Eisenmann und Patak die Gäste am Flughafen und fahren anschließend zu einem unscheinbar wirkenden kleineren Betrieb in Raingad, etwa 100 Kilometer von Mumbai entfernt. Der Werkleiter des Subunternehmens Maharashda Pharmaceuticals führt sie durch das eher prekär anmutende Fabrikgebäude, das inmitten eines Grünackers gelegen ist. Neben der überwiegend manuell durchgeführten Herstellungsprozedur beherbergt es einen in die Jahre gekommenen Maschinenpark, in dem die Dosierung und die Mischung der Komponenten für Haemodioxy sowie die Abfüllung des Pulvers in kleine, dunkelgrünweiße Kunststoffkapseln erfolgt. Diese werden dann in Zehnerblister geschweißt. Hier erfolgt zudem die Mischung der Infusionslösungen, die in 500 Milliliter fassende Kunststoff-Ecobags gefüllt und versiegelt und anschließend in dampfbeheizten Schränken sterilisiert werden. Deren Etikettierung und Endverpackung soll schließlich in einem Verpackungsbetrieb in Mumbai erfolgen. Bevor Kurt Eisenmann vier Stunden später ebenfalls seinen Rückflug nach Frankfurt antritt, erinnert ihn Patak an die baldige Zusendung der spanischen Textvorlage für die Beipackzettel, damit diese hier gedruckt und den Schachteln beigefügt werden können. Der erste Container mit der Lieferung soll in zwei Monaten im Hafen von Mumbai verladen werden.
*
Ayrton da Silva Santos hat seine vor drei Wochen an der Chagas-Krankheit verstorbene Ehefrau gerade noch mit dem letzten Ersparten beerdigen können. Und jetzt hat auch noch seine Hündin erneut einen Wurf von acht Nachkommen zur Welt gebracht. Der verarmte und zurzeit mal wieder arbeitslose Witwer und Vater von vier Kindern haust in einer Favela6 am Stadtrand des brasilianischen Recife. Nun weiß er sich und seiner darbenden Familie nicht anders zu helfen, als sieben der Welpen in einen Sack zu stecken und diesen in den Tragekorb seines Fahrrades zu legen. Mühevoll radelt er bis zum fünfzig Kilometer entfernten Strand von Muro Alto, um die jungen Hunde im Meer zu ertränken. Auf dem Fußweg zum Meeresufer fällt ihm einer der Welpen aus dem Sack. »Lass ihn einfach liegen«, murmelt Ayrton, erschöpft von der langen Fahrt, »der krepiert auch so.« Schritt für Schritt begibt er sich mit dem an der Hand herunterhängenden Sack den seicht abfallenden Sandstrand hinunter in das achtundzwanzig Grad warme Wasser. Als es ihm bis zur Taille reicht, verharrt er, den Blick starr auf den Horizont gerichtet, bis der letzte Jammerlaut verklungen ist. Dann entledigt er sich der toten Last, faltet den Sack zusammen und macht kehrt. Im Schatten einiger hochwachsender Palmen legt sich Ayrton in den Sand, bis die sengende Mittagshitze etwas abgeklungen ist. Dann macht er sich auf den langen Nachhauseweg.
*
Leise winselt der kleine Mischlingswelpe im dreißig Grad heißen Sand und ist kurz vor dem Verdursten.
»Schau mal, Papi, wie niedlich! Ist das nicht ein süßes Hündchen?« Ohne auf die Warnrufe des Vaters zu achten, rennt die achtjährige Isabel zu dem im Sand liegenden hilflosen Welpen, hebt ihn auf und streichelt ihn liebevoll.
Fluchend läuft ihr Vater, Achim Reiter, ihr hinterher. »Um Gottes willen, lass das doch, Kind! Wer weiß, was der für Krankheiten hat!« Er kommt zu spät, um den Kontakt zu verhindern. Bestürzt angesichts der Feststellung, dass das arme Tier kurz vor dem Verenden ist, keimt in ihm Mitleid auf. Rasch zieht er sein T-Shirt aus, greift nach dem Welpen und wickelt ihn darin ein. Dann sagt er: »Komm, Mausi, schnell! Wir müssen ihn zum Tierarzt bringen, sonst stirbt er!«
Eilig laufen beide zurück zur Straße, wo der gemietete Wagen steht. Achim Reiter wählt mit dem Handy das Pernambuco-Ressort an, die luxuriöse Pousada, in dem die Familie ihren dreiwöchigen Urlaub verbringt. Mit seinen wenigen Brocken Portugiesisch fragt er nach der Anschrift der am nächsten gelegenen Tierarztpraxis und gibt sie ins Navi ein. Nach kurzer Fahrt erreichen sie eine kleine Tierklinik am Rande der Stadt. Die Veterinärin nimmt sich des stark dehydrierten Welpen liebevoll an und setzt ihn an den Tropf. Bald öffnet er mühsam die Augen und wimmert leise.
Als ihr Achim Reiter radebrecht, dass sie das ausgesetzte Tier am Strand gefunden hätten, meint die Senhora Doctora: »Die Arme ist ja fast verhungert! Es ist ein kleines Mädchen und wurde viel zu früh von der Mutter getrennt. Ich gebe ihr jetzt erst einmal einige Spritzen, um sie wieder aufzupäppeln. Danach könnten wir sie mit Ersatzmilch ernähren, bis sie kräftig genug ist.
Wollen Sie tatsächlich die Kosten dafür übernehmen, Senhor Reiter? Ich meine, Sie sind doch hier im Urlaub und ich glaube nicht, dass Sie das Tier wirklich mit nach Deutschland nehmen wollen, oder? In diesem Fall kämen weitere Kosten für notwendige Schutzimpfungen und Gesundheitsatteste auf Sie zu. Das summiert sich leicht auf einige Hundert Euro. Dann müsste die Kleine auch noch einen Gesundheitschip implantiert bekommen. Wir können aber gern, wenn Sie mögen, all dies in Zusammenarbeit mit dem hiesigen Tierheim für Sie erledigen.« Achim Reiter zuckt zusammen, als die Senhora Doctora ihm den geschätzten Endbetrag mit etwa fünfzehn- bis achtzehnhundert Euro nennt. Das übersteigt die veranschlagte Urlaubskasse erheblich.
»Bitte, Papi, wir können das süße Hündlein doch nicht so einfach wieder weggeben!«, fleht ihn Isabel mit dicken Tränen in den Augen an, nachdem er ihr berichtet hat, was da alles auf sie zukäme, wenn sie den Welpen behalten wollten. Dass man das Hundebaby ansonsten einschläfern würde, hat er ihr sorgfältig vorenthalten. Brasilianische Tierheime, so hat ihm die Tierärztin erzählt, sind mit wahren Horden von herrenlosen und streunenden Tieren überfüllt, da sei kein Platz mehr.
»Bitte, bitte! Ich will meine kleine Mona mit nach Hause nehmen! Ich verspreche dir, mich um sie zu kümmern.« Als Isabel bemerkt, dass ihr Vater im Begriff ist, ihr eine Absage zu erteilen, fährt sie verzweifelt weinend fort: »Auch Heiner wird sich sicher freuen, denn er wollte doch immer schon einen Hund haben!«
»Also gut«, lenkt Achim Reiter ein, »ein Vorschlag zum Kompromiss, Mausi. Ich sehe, du hast ihr schon einen hübschen Namen gegeben. Wir lassen Mona jetzt erst einmal hier, damit sie gut versorgt ist, und fahren zurück ins Hotel. Dort besprechen wir alles mit Mami; mal sehen, was sie meint. Wir müssen auch noch bei der Reiseagentur nachfragen, wie das mit dem Rückflug werden soll, nicht wahr? Und dann kommen wir morgen wieder und berichten der Frau Doktor, einverstanden?«
Isabel nickt erleichtert.
Ihr Vater will ihr gerade die Tränen aus den Augen wischen, da interveniert die Ärztin. Sie folgen zugleich ihrer Empfehlung und waschen sich zunächst gründlich die Hände mit medizinischer Seife und desinfizieren sie anschließend.
»Das Shirt lassen Sie am besten hier, Senhor, das ist gesünder!«, sagt sie mit einem vielsagenden Lächeln und wirft Achim Reiters T-Shirt in den Abfalleimer. Mit der Zusicherung, am nächsten Tag endgültig Bescheid zu geben, was aus dem Welpen werden soll, hinterlässt er der Ärztin nebst ihrer Adresse in der Pousada Pernambuco die vier Fünfzig-Euro-Scheine, die er im Portemonnaie bei sich trägt.
*
»Hilfe, Karl-Friedrich, komm bitte sofort runter, hier ist etwas Furchtbares passiert!«, kreischt Margarethe, Ehefrau des Stararchitekten Wedekind. Beim Betreten der Küche hat sie soeben ihre peruanische Haushaltshilfe Felipa regungslos auf dem Boden vorgefunden. Ein kleines Blutrinnsal fließt ihr aus dem Mund, starke Zuckungen verkrampfen ab und zu den mageren, kleinwüchsigen Körper. Mit lautem Gepolter stürmt der wuchtige Mann die Treppe herab und durchquert eilig Salon, Esszimmer und den breiten Flur der geräumigen Nobelvilla in Hamburg-Volksdorf. Bestürzt blickt er über die Schulter seiner Frau, die sich augenblicklich in seine Arme flüchtet.
»Beruhige dich, Margarethe, ich rufe gleich die 112. Der Notarzt wird sich schon um sie kümmern.« Als er versucht, sich aus ihrer Umarmung zu lösen, um in der Tasche nach seinem Handy zu greifen, bremst ihn seine Frau, indem sie ihn noch fester umklammert. »Halt«, schreit sie, »das kannst du nicht machen! Die werden unangenehme Fragen stellen. Filipa ist doch eine Illegale und nicht ordnungsgemäß bei uns gemeldet. Bestimmt kriegen wir großen Ärger!«
»Was willst du denn sonst tun? Du siehst doch, die stirbt uns gleich unter den Händen weg! Denkst du nicht, das wäre noch viel schlimmer?« Ohne eine Reaktion abzuwarten, spricht er weiter. »An derartige Konsequenzen hättest du vorher denken müssen. Ich war immer dagegen, sie einzustellen und noch dazu bei uns wohnen zu lassen, aber du wolltest ja nicht auf mich hören!« Mit sanftem Druck befreit er sich aus der panikartigen Umklammerung seiner Frau und geht hinaus, um den Rettungswagen zu rufen. Wenig später kehrt er mit Sitzkissen und einer Decke für die Notleidende in die Küche zurück. Margarethe hat Felipa inzwischen mit einem feucht-kalten Handtuch das Gesicht gesäubert.
Die junge Frau öffnet mit dankbarem Blick für einen Moment die Augen, um sogleich wieder in tiefe Bewusslosigkeit zu versinken.
Eine Viertelstunde später legen zwei Sanitäter und der Notarzt die kranke Frau auf eine Trage, nachdem sie die ersten Untersuchungen durchgeführt und ihr einen Venentropf angebracht haben.
»Es scheint sich um starke innere Blutungen zu handeln, die sehr wahrscheinlich von einer zunächst hier nicht so leicht identifizierbaren Virusinfektion verursacht wurden«, diagnostiziert der Notarzt, ein äußerst sympathischer jüngerer Mann mit offensichtlichem lateinamerikanischem Migrationshintergrund. Während die beiden Sanitäter, die sich auf seine Anordnung hin im Vorfeld besondere Schutzkleidung überziehen mussten, die Trage mit der Erkrankten zum Rettungswagen hinausbringen, stellt er sich vor: »Mein Name ist Doktor med. Angelino Mendez Pizarro. Ich stamme aus Paraguay und lebe seit meinem zweiten Lebensjahr in Deutschland, wo meine Familie Ende der Achtzigerjahre aufgrund der politischen Verfolgung durch den Diktator Alfredo Stroessner Asyl gewährt wurde. Ebenso wie mein Vater, der ein leidenschaftlicher Arzt war, studierte ich an verschiedenen medizinischen Fakultäten in Deutschland und Spanien und promovierte am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Ohne die Patientin genauer untersucht und die notwendigen Analysen durchgeführt zu haben, kann ich keine endgültige Diagnose stellen. Sie wird deswegen vorsorglich in die Isolierstation ins Universitätskrankenhaus Eppendorf gebracht. Allerdings vermute ich angesichts ihrer Herkunft und des vorgefundenen Krankheitsbildes, dass sie sehr wahrscheinlich seit Längerem mit dem Parasiten Trypanosoma cruzi infiziert ist. Dabei handelt es sich um den Erreger der südamerikanischen Chagas-Krankheit. Ist Ihnen womöglich aufgefallen, dass Ihre Haushaltshilfe in der letzten Zeit des Öfteren unter Durchfall litt?« Als keine Reaktion kam, sprach Dr. Pizarro weiter. »Nein? Vielleicht war es ihr unangenehm, darüber zu reden. Jedenfalls müsste ich Sie vorerst ebenfalls unter Quarantäne stellen, bis man Sie entsprechend untersucht hat, um festzustellen, ob Sie sich angesteckt haben. So, jetzt brauche ich der Vollständigkeit halber noch die Daten der Patientin. Hätten Sie ihren Personalausweis oder einen Reisepass parat? Und können Sie mir sagen, wo sie krankenversichert ist?«
»Danke für Ihre umfassende Information, Herr Doktor«, sagte Karl-Friedrich Wedekind. »Sehen Sie, es gibt in der Tat ein ernsthaftes Problem, das wir besprechen sollten.« Verlegen fährt der Architekt fort: »Ich hoffe, Sie haben etwas Zeit für eine ausführliche Geschichte.«
Nachdem sich der Arzt beim Zentralen Gesundheitsdienst gemeldet und erfahren hat, dass momentan kein akuter Notfall vorliegt, willigt er ein und nimmt den Sesselplatz sowie die ihm angebotene Tasse Tee im Wohnzimmer dankend an. Wedekind erzählt ihm sodann, dass Felipa vor ungefähr sechs Monaten an ihrer Tür gestanden und um Hilfe gebettelt habe. Da er und seine Frau häufiger auf den Kanaren Urlaub machen, könne er einige Brocken Spanisch, sodass eine Verständigung mit dem Mädel möglich war. Sie baten sie herein und gaben ihr, weil sie offenbar ausgehungert war, zu essen und zu trinken. Total erschöpft sei sie über ihrem Teller eingeschlafen. Am nächsten Tag nannte sie ihren Namen, Felipa Gonzalez, und erzählte, sie sei zweiundzwanzig Jahre alt und stamme aus Iquitos, einer peruanischen Stadt am Amazonas. Schon in ihrer frühen Kindheit zur Waise geworden, war sie bei einer Tante aufgewachsen, die sie aber nicht in die Schule gehen ließ, sondern als Aschenputtel ausnutzte. Eines Tages sei sie aus dem Haus geflohen und irgendwie in die Fänge eines der vielen Sklavenschleuser geraten, die einen Haufen Geld mit Menschenschmuggel nach USA und Europa verdienten. In einem speziell mit einfachen Holzpritschen und Belüftung ausgerüsteten Container sei sie dann auf einem peruanischen Schiff zusammen mit zwei Dutzend anderen Leidensgenossen in sechsunddreißig Tagen von Callao in das spanische Algeciras gebracht worden. Ebenso wie die Zöllner in beiden Ländern war auch die Schiffsbesatzung bestochen worden, sodass sie in den Nachtstunden den Container für einige Stunden verlassen durften, um Bad und Toiletten zu nutzen und ihre Mahlzeiten einzunehmen. Nachdem der Container im Hafen von Algeciras abgeladen und auf einem Lastwagen in das 330 Kilometer entfernte Cordoba gebracht worden war, wurden dort die illegal ins Land gebrachten und praktisch anonymen Personen nach und nach ihren neuen Ausbeutern zugeführt. So sei sie als Kindermädchen zu einer reichen Familie in Sevilla gekommen. Dort habe man sie zwar nicht schlecht behandelt – sie bekam sogar ein kleines Zimmer auf dem Dachboden, Kleidung und ausreichend zu essen –, wurde aber praktisch wie eine Sklavin gehalten, erhielt also weder Gehalt oder freie Tage, noch durfte sie allein ausgehen. Als das ältere Zwillingspaar in den nahe gelegenen Kindergarten kam, musste Filipa die Kleinen dort morgens hinbringen und sie mittags wieder abholen. In der verbliebenen Zeit kümmerte sie sich auch noch um den jüngeren, zweijährigen Sohn der Familie. Bei ihren täglichen Wanderungen mit den Zwillingen lernte sie Luisa Espinoza, eine Leidensgenossin, kennen, die den Sprössling ihrer Herrschaft ebenfalls hin und her zu bringen hatte. Da beide in etwa den gleichen Weg hatten, freundeten sie sich mit der Zeit an und teilten sich gegenseitig ihr Leid mit. Irgendwann verriet Luisa der neuen Freundin, dass sie jemanden kennengelernt habe, der ihr die Flucht nach Deutschland ermöglichen wolle, damit sie ihren dort lebenden Bruder wiedersehe. Na ja, so meinte sie, der Preis dafür sei eine ›kleine Gefälligkeit‹, die sie ihm zu erweisen habe. Luisa fügte hinzu, sie habe schon mit so vielen Männern geschlafen, auf einen mehr oder weniger käme es ihr nicht an. Hauptsache, sie käme weg von hier. Da habe Felipa sie angebettelt, mitkommen zu dürfen, und Luisa versprach, mit ihrem Bekannten zu sprechen. Wenige Tage danach erhielt sie die erhoffte Nachricht, Luisas Amigo hätte zugesagt. Als der ersehnte Tag gekommen war, zog sie sich doppelte Kleidung an. Nach der ordnungsgemäßen Ablieferung ihrer Schützlinge am Kindergarten stiegen sie in den dort auf sie wartenden alten Seat ein und Alberto brachte sie zunächst zu einer hundert Kilometer entfernten Zitrusplantage, wo sie die Nacht im Arbeiterlager verbrachten. Auch Felipa musste als Fahrpreis eine ›kleine Gefälligkeit‹ entrichten. Um fünf Uhr morgens, während drei Lkws mit Orangen- und Clementinensteigen beladen wurden, kletterten sie in eine besonders präparierte Kiste, die äußerlich vom Rest der Ladung kaum zu unterscheiden war. Diese wurde zwischen die übrige Ladung gestellt. Neben zahlreichen Wasserflaschen, Brot und Wurstproviant mussten die beiden jungen Frauen darin die fünfundvierzig Stunden dauernde Fahrt zumeist im Sitzen verbringen. Nur während der gelegentlichen nächtlichen Stopps konnten sie sich zwischen der engen Ladung hindurchquetschen, um Luft zu schnappen und ihre Notdurft zu verrichten. Zwei Ländergrenzen inklusive der fälligen Zollkontrollen brachten sie hinter sich, ohne entdeckt zu werden. Als sie in Hamburg eintrafen, fuhr der Lastwagen zunächst in eine Lagerhalle am Stadtrand, wo die Tarnkiste entladen wurde, bevor der Wagen zum Großmarkt fuhr. Was den beiden blinden Passagieren allerdings entging, war, dass im Innern jener Sitze, auf denen sie während der gesamten Fahrt Platz gefunden hatten, fast hundert Kilo Kokain verborgen mitgereist waren. Diese waren turnusmäßig von Marokko nach Deutschland geschmuggelt worden. Das wurde jedoch erst einige Wochen später publik, nachdem die Hamburger Zollbehörde bei einer Routinedurchsuchung des Lkws fündig geworden war. Dabei waren ihnen zwei illegale Mitreisende aus Mali ins Netz gegangen.
Nachdem Luisa per Handy den Weg zur Wohnung ihres Bruders in Erfahrung gebracht hatte, machten sich die beiden jungen Frauen auf den Weg. Felipa kam dort zunächst unter, bis Luisas Bruder andeutete, dass sie sich um eine andere Bleibe bemühen müsse. Eine seiner Bekannten hatte auf die gleiche Weise in Eppendorf eine Familie gefunden, die sie einstellte. Felipa brauchte drei Tage, bis sie bei den Wedekinds läutete und ihr Margarethe aus »purem Mitleid und christlicher Nächstenliebe«, wie sie tunlichst am Rande bemerkte, Unterschlupf, Kost und Logis gewährte.
»Um Ihre letzte Frage zu beantworten, Herr Doktor, habe ich vorsorglich die wenigen Daten, über die ich verfüge, notiert: Felipa Gonzalez, zweiundzwanzig Jahre alt, geboren in Iquitos, Perú. Selbstverständlich komme ich für sämtliche Heil- und Medikamentenkosten auf. Hier haben Sie meine Visitenkarte.«
»In Ordnung, Herr Wedekind, das gebe ich so weiter. In Deutschland findet derzeit kein systematisches Screening bei Menschen mit einem epidemiologischen Risiko für eine Chagas-Infektion statt. Nur etwa ein Viertel der Infizierten zeigt akute Symptome wie Fieber, Durchfall und Lymphknotenvergrößerung, wie es bei Filipa der Fall ist. Im weiteren Verlauf kann es jedoch zu chronischen Schädigungen verschiedener Organe kommen. Dabei handelt es sich insbesondere um kardiale Komplikationen wie Herzinsuffizienz, Herzrhythmusstörungen sowie Herzkammervergrößerung. Wegen der geringen medizinischen Behandlungsmöglichkeiten ist die gesundheitliche Vorsorge besonders wichtig. Deswegen muss ich Sie auch inständig bitten, ab sofort das Haus nicht zu verlassen. Ich informiere das Gesundheitsamt entsprechend, das ist meine Pflicht. Man wird gegebenenfalls in Kürze auf Sie zukommen, um geeignete Maßnahmen zwecks Desinfektion zu treffen. Und vermeiden Sie bitte ab sofort jeden Kontakt mit anderen Menschen und auch Tieren, bis wir Gewissheit haben. Am besten, Sie waschen sich sofort sehr sorgfältig und ziehen sich um. Die getragenen Kleidungsstücke sollten Sie, sofern möglich, sehr heiß waschen oder in die chemische Reinigung geben. Zudem besprühen und reinigen Sie bitte alle Gegenstände, mit denen Felipa möglicherweise in Berührung gekommen ist, mit diesem Mittel.« Doktor Mendez stellt eine Sprayflasche auf den Tisch. Als sein Handy brummt, blickt er auf das Display und erhebt sich. »Also, ich muss dann mal wieder! Ich lasse Ihnen meine Karte da für den Fall, dass Sie noch Fragen haben. Machen Sie es gut, auf Wiedersehen!«, sagt er, während er hinauseilt.