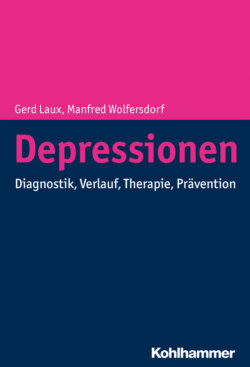Читать книгу Depressionen - Manfred Wolfersdorf - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 Epidemiologische und gesundheitsökonomische Anmerkungen 2.1 Deutschland, Europa, weltweit
ОглавлениеEpidemiologische und gesundheitsökonomische Studien belegen die herausragende Bedeutung depressiver Erkrankungen: Verglichen sowohl mit anderen psychischen Erkrankungen als auch mit allen anderen nichtpsychiatrischen Volkskrankheiten wie Diabetes mellitus sowie kardio- oder zerebrovaskulären Erkrankungen kommt nach der »Burden of Disease Study« der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Weltbank – gemessen an den zentralen Indikatoren DALYs (»Disability-adjusted Life Years«) und YLDs (»Years Lived With Disability«) – in den Industrienationen der Major Depression und der Dysthymia größte Bedeutung zu (Ferrari et al. 2013; Murray und Lopez 1996, 2010).
Depressive Erkrankungen verursachen v. a. indirekte Krankheitskosten durch Krankheitstage/Produktionsausfall und Frühberentungen. Nicht erkannte bzw. nicht diagnostizierte Depressionen ziehen wegen körperlicher Beschwerden aber auch zahllose überflüssige somatische Untersuchungen nach sich. Die mit depressiven Erkrankungen assoziierte Suizidalität besitzt angesichts ihrer Häufigkeit neben ihrer persönlich-familiären Tragik ebenfalls große gesundheitsökonomische Bedeutung.
In Deutschland stehen Depressionen heutzutage bei Krankmeldungen und den zu Arbeitsunfähigkeit führenden Gesundheitsstörungen an der Spitze, Frühberentungen erfolgen zu einem Drittel wegen Depressionen. Der Psychoreport 2015 der DAK und des IGES (Institut für Infrastruktur und Gesundheitsfragen) zeigte einen deutlichen Anstieg der AU-Tage vom Jahr 2000 bis 2014 um über 200 %; der Anteil depressiver Störungen (ICD-10: F32/33) ist dabei fast dreimal so hoch wie der schwerer Belastungs- und Anpassungsstörungen. 2015 wurden die Krankheitskosten für die ICD-10-Depressionsdiagnosen F32-34 mit 8,7 Mrd. € (2,9 Mrd. für Männer, 5,8 Mrd. für Frauen) angegeben (www.gbe-bund.de 2018). Die individuellen Behandlungskosten werden auf jährlich ca. 2.500 bis 5.000 € taxiert, die jährlichen Gesamtkosten werden auf ca. 16 Mrd. € geschätzt. Für Altersdepressionen bei Menschen ab 75 Jahren wurden in einer Beobachtungsstudie (AgeMooDe) mittlere Kosten über sechs Monate von 5.031 € kalkuliert (Bock et al. 2016). In Deutschland sind Depressionen bei Frauen die dritthäufigste, bei Männern die siebthäufigste Ursache für durch Krankheit beeinträchtigte Lebensjahre (DALY) (Plass et al. 2014).
In der TACOS-Studie (»Transitions in Alcohol Consumption and Smoking«; Meyer et al. 2000) mit 4.093 Interviews in einer norddeutschen Region fand man eine Lebenszeitprävalenz für depressive Störungen (Major Depression, Dysthymia) von 11,5 % (Männer 6,8 %, Frauen 16,3 %). In der Studie zur »Gesundheit in Deutschland aktuell« (GEDA) des Robert Koch-Instituts (2019) wurden Selbstangaben zu einer diagnostizierten Depression oder depressiven Verstimmung in den letzten zwölf Monaten vor der Befragung erhoben. Die Prävalenzen betrugen für Männer 5,1 %, für Frauen 9,0 %.
Die Studie zur »Gesundheit Erwachsener in Deutschland« und ihr Zusatzmodul »psychische Gesundheit« (DEGS1-MH), basierend auf einer bevölkerungsrepräsentativen Erwachsenenstichprobe (18–79 Jahre, n = 5.317), ergab anhand ausführlicher Interviews für die unipolare Depression eine 12-Monats-Prävalenz von 6 % (Frauen 8,1 %, Männer 3,8 %). Die Lebenszeitprävalenz einer aus ärztlichen Interviews diagnostizierten Depression betrug 11,6 % (Frauen 15,4 %, Männer 7,8 %) (Busch et al. 2013; Jacobi et al. 2014). In der Hausarzt-Studie »Depression 2000« waren Depressionen die häufigsten psychischen Störungen, am Untersuchungsstichtag erfüllten 11 % der Patienten die Kriterien einer depressiven Episode. 26 % erhielten keine Diagnose einer psychischen Störung, 19 % nicht die einer Depression, in 34 % der Fälle gaben die Ärzte wahrscheinliche Depression an, nur 21 % wurden definitiv erkannt (Wittchen et al. 2002).
Nach neuen Erhebungen liegt die Prävalenz depressiver Symptome und von Depression bei Assistenzärzten bei knapp 30 %, wobei symptomatisch »Hilflosigkeit« dominiert. Ein Großteil der Daten basiert dabei aber auf Fragebögen und nicht auf Interviews.
Für die EU-Staaten wurde eine 1-Jahres-Prävalenz für Major Depression von 6,9 % ohne substanzielle Ländervariation gefunden, die DALY-Rate für die unipolare Depression lag an der Spitze aller psychischen und neurologischen Erkrankungen. Der EU-Report 2010 (Wittchen et al. 2011) stellte dabei Prävalenzraten (12-Monats-Prävalenz) aus den Jahren 2005 und 2011 gegenüber und fand bei der Major Depression in beiden Fällen einen Anteil von 6,9 %, was 30,3 Millionen Personen mit einer diagnostizierten Major Depression bedeutet. Das Risiko, im Laufe des Lebens an einer Depression (alle Formen) zu erkranken,die Lebenszeitprävalenz, liegt national wie international bei 16 bis 20 % (Bijl et al. 1998; Ebmeier et al. 2006; Jacobi et al. 2004). Die Replikation der großen US-amerikanischen National Comorbidity Study (NCS-R) anhand DSM-IV-Kriterien ergab eine 1-Jahres-Prävalenz für Major Depression von 9,5 %.
Nach einer Analyse von Krankenkassendaten (Barmer GEK) aus dem Jahr 2011 von 7,5 Mio Versicherten wurde bei knapp 237.000 eine Depression diagnostiziert. 53 % der schweren Depressionen und 51 % der Depressionen mit schwerer psychiatrischer Komorbidität wurden von Fachärzten behandelt. Knapp die Hälfte der Allgemeinarzt-Patienten wurde mit einem Antidepressivum behandelt, 10 % mit zwei Antidepressiva simultan. 26 % erhielten Psychotherapie (Wiegand et al. 2016).
Die oberbayerische Longitudinalstudie über 25 Jahre, wobei das Durchschnittsalter initial 39,4 Jahre betrug, fand mittels Interviews eine stabile Prävalenz depressiver Syndrome (initial 18,1 %, 16,1 % nach 25 Jahren) sowie für die »depressive Stimmung« (30,8 % bzw. 21,4 % bzw. 23,1 %). Dies unterstreicht die Feststellung, dass Depressionen über die letzten Dekaden nicht zugenommen haben (Fichter et al. 2008).
Das Lebenszeitrisiko, an einer unipolaren Depression zu erkranken, wird auf 11 % bis 26 % geschätzt, bei älteren Menschen auf etwa 10 %.
Untersuchungen zur Prävalenz der Major Depression in verschiedenen Kulturen zeigten eine bis zu 7-fache Varianz, wobei Punktprävalenzen zwischen 4,6 % und 24 % gefunden wurden.
Die Prävalenzraten der Dysthymie variieren stark. Laut DEGS 1-MH-Studie beträgt die 1-Jahresprävalenz etwa 2 % (Frauen 2,5 %, Männer 1,4 %). Für Deutschland (Jacobi et al. 2004) werden 2,5 % Dysthymie neben 8,3 % depressive Episode als Einzelepisode oder im Rahmen rezidivierender Verläufe angegeben. Dabei besteht eine hohe Komorbidität mit anderen psychischen Erkrankungen, vor allem Angststörungen, Substanzmissbrauch und -abhängigkeit sowie Persönlichkeitsstörungen. Einige Autoren bezweifeln deswegen die Eigenständigkeit und die praktische Anwendbarkeit dieser Diagnose, die letztlich einen Sammeltopf aus der früheren (ICD-9) neurotischen Depression, sog. chronischen Depressionen und subsyndromalen depressiv-dysthymen Erkrankungen darstellt.
Die Prävalenzraten für bipolare Störungen werden für Bipolar I mit 0,6 % und für Bipolar II mit 2–6 % angegeben. Hierbei überwiegen Depressionen deutlich (Bauer et al. 2017).
Zu den depressiven Störungen, die noch weiterer Forschung bedürfen, gehören die »Minor Depression«, subsyndromale Formen sowie die rezidivierende kurze depressive Episode (»Recurrent Brief Depression«, RBD), für die Lebenszeitprävalenzen von 2–10 % berichtet werden (Laux 2017b). Der Kliniker und vor allem der niedergelassene Psychiater kennt RBD aus Verlauf und Nachsorge, wo sie als »Einbruch« oder »Absturz«, manchmal mit hoher suizidaler Gefährdung geschildert wird.
Depression bei körperlichen Erkrankungen. Angesichts der altersassoziierten Zunahme (chronischer) körperlicher Erkrankungen wie koronare Herzkrankheit (KHK), Diabetes mellitus, M. Parkinson oder einem Schlaganfall hat die Bedeutung und Häufigkeit komorbider Depressionen zugenommen. Bei Krankenhauspatienten wird die 1-Jahres-Prävalenz von majoren Depressionen mit 4–17 % angegeben. Für einzelne Erkrankungen werden folgende Punktprävalenzen angegeben:
| • Diabetes mellitus | 10–30 % |
| • KHK, Myokardinfarkt | 20–45 % |
| • COPD, Asthma | ca. 30 % |
| • M. Parkinson | 40–50 % |
| • Epilepsie | ca. 30 % |
| • Schlaganfall | ca. 30 % |
| • Schädel-Hirn-Traumen | ca. 30 % |
| • Multiple Sklerose | ca. 40 % |
| • Dialysepatienten | 10–20 % |
| • Karzinompatienten | ca. 25 % |
Bei Krankenhauspatienten wird eine 1-Jahres-Prävalenz von Majoren Depressionen mit 4–18 % angegeben. Hier ist jedoch von einer hohen Dunkelziffer auszugehen.