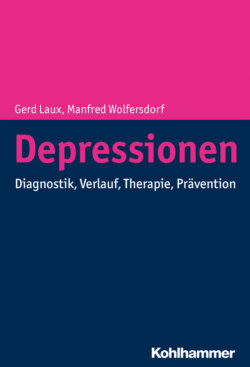Читать книгу Depressionen - Manfred Wolfersdorf - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.3 Abschließende Bemerkungen Hinweis
ОглавлениеUnterschiedliche Erhebungsstrategien (Fragebögen, Selbsteinschätzung, Telefoninterview, Zeitraumbezug, persönliche Untersuchung) und Definitionen (z. B. ICD/DSM-Kriterien) haben erhebliche Auswirkungen auf Prävalenzschätzungen. Depressive Symptome oder vorübergehende depressive Verstimmung geben ca. 25 % der Allgemeinbevölkerung an, die strikten Kriterien einer depressiven Episode nach DSM erfüllen in einer 12-Monats-Querschnittsprävalenz ca. 8 %, depressive Syndrome lassen sich bei ca. 12 % diagnostizieren (Wittchen und Pittrow 2002).
Psychische Krankheiten – insbesondere Depressionen – erfahren in den letzten Jahren eine konträre Entwicklung in Selbst- und Fremdwahrnehmung. Waren sie lange Zeit tabuisierte, heimliche, negativ bewertete und in ihrer Häufigkeit und Bedeutung immens unterschätzte Krankheiten, sind sie heute medial und gesellschaftspolitisch – auch oder sogar primär aus gesundheitsökonomischen Gründen – sehr präsent mit der Gefahr, dass fast alltägliche Befindlichkeitsstörungen zu behandlungsbedürftigen Krankheiten hochstilisiert werden und eine Überdiagnostik erfolgt (vgl. »Burnout-Welle«). In Befragungen angegebene Stimmungsschwankungen, Verstimmungszustände, Belastungs- und Anpassungsstörungen werden zu depressiven Syndromen. In Statistiken der Krankenkassen liegen Depressionen vorne, da diese Diagnose für Abrechnungen erforderlich ist oder diese erleichtern. Auch in Psychosomatischen Kliniken werden überwiegend depressive Störungen diagnostiziert. So leben wir in einem Land mit »Millionen Depressiven«.
Exakte Zahlen zur Häufigkeit hängen von Stichproben- und Diagnosekriterien sowie Untersuchungsinstrumenten ab. In den letzten Jahren ist eine Zunahme der Depressionsraten zu verzeichnen. Berücksichtigt man methodologische Fallstricke (z. B. Falldefinition, Stichprobe) ist eine echte Zunahme depressiver Erkrankungen fraglich (Richter et al. 2008). Auch beruhen die Datenanalysen auf Querschnittserhebungen und ermöglichen damit keine Aussagen über die Richtung bzw. Kausalität der Zusammenhänge.
Vor allem Zahlen auf Basis von Krankenkassendaten sind zu relativieren, da die Diagnose Depression in der ambulanten deutschen Versorgung eine breite Erweiterung erfahren hat (siehe »Burnout«) und z. B. gestellt wird, um ein sedierendes Antidepressivum bei Schlafstörung zu verordnen.
Unsere heutige Dienstleistungsgesellschaft mit ihren sich immer wieder ändernden Arbeits- und Lebensbedingungen stellt hohe Anforderungen an ihre Mitglieder. Psychische Erkrankungen werden immer bedeutsamer. Arbeitsunfähigkeitstage, Krankschreibungen und Frühberentungen wegen psychischer Erkrankungen haben zugenommen, wobei zweifelsohne depressive Erkrankungen sowieso zu den häufigsten psychischen Störungen zählen. Die Depression ist heute so bedeutsam geworden, dass man von »Volkskrankheit« spricht, nicht nur weil sie neben den Angststörungen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen zählt, sondern auch weil die Rate der Früherkennung und der Behandlung zu gering erscheint. Darüber hinaus ist die Depression diejenige psychische Erkrankung mit einem Höchstmaß an Suizidalität, die in der akuten Situation mit Arbeitsunfähigkeit einhergeht, in eine anhaltende sog. chronische Verlaufsform übergehen kann und die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und in Beziehungen deutlich behindert (Murray and Lopez 1996; WHO 2001; Wolfersdorf und Rätzel-Kürzdörfer 2017a, b).
Depressive Erkrankungen verursachen vor allem indirekte Krankheitskosten durch Krankheitstage, was Produktionsausfall bedeutet und Frühberentungen. Nicht erkannte bzw. fehldiagnostizierte Depressionen ziehen wegen körperlicher Beschwerden aber auch zahllose und oft überflüssige somatische Untersuchungen nach sich. Die mit depressiven Erkrankungen assoziierte Suizidalität – bis zu 60 % aller durch Suizid verstorbenen Menschen haben an einer Depression gelitten (Schaller und Wolfersdorf 2010) – besitzt angesichts ihrer Häufigkeit neben ihrer persönlichen und familiären Tragik ebenfalls große gesundheitspoltische und ökonomische Bedeutung.
Die Zahl der schwer depressiv kranken Menschen scheint in Deutschland nicht zugenommen zu haben; geschätzt wurden ca. 4–5 Millionen (1-Jahres-Prävalenz), jedoch scheinen mittelgradig und leicht erkrankte Depressive heute mehr im medizinischen Hilfesystem aufzutauchen (Jacobi et al. 2014; Wolfersdorf und Rätzel-Kürzdörfer 2016).
Die Frage, ob es eine echte d. h. anhand von epidemiologischen Daten nachweisbare Zunahme depressiver Erkrankungen gibt oder im letzten Jahrzehnt gegeben hat oder ob es sich um eine »gefühlte« Zunahme handelt, müsste auf mehreren Ebenen beantwortet werden. Man könnte fragen, ob Arbeits- und Lebensbedingungen sich »depressiogen« verändert hätten. Da ginge es um Arbeitsplatzunsicherheit, Arbeitsverlust, erzwungene Mobilität, Selbstausbeutung durch Arbeitszeiten, Multitasking und ständige Verfügbarkeit, also um Faktoren, die auch in der Burnout-Diskussion angeführt werden. Oft wird Disstress durch Rollenvielfalt (Beruf und Familie für Frauen) aufgeführt, andererseits kann eine gelebte Rollenvielfalt auch eine Ressource im Hinblick auf die psychische Gesundheit darstellen.
Es wäre zu hinterfragen, ob wir angesichts der schwierigen Weltsituation, die vielfach ein Gefühl der Hilflosigkeit – evtl. i. S. von Seligman‘s »Learned Helplessness« – und des Ausgeliefertsein vermittelt, eine melancholische Grundgestimmtheit und einen Verlust von Sicherheit und Tradition, von Ordnung und Verlässlichkeit (i. S. von Tellenbach) in der Gesellschaft haben. Diese Nachweise wären zu erbringen.
Sog. »Minore Depressionen«, subsyndromale Formen sowie die rezidivierende kurze depressive Episode (»Recurrent Brief Depression«, RBD) werden im klinischen Bereich selten gesehen. Die RBD kann aber mit einem ausgeprägten suizidalen Impuls einhergehen, der diese Depressionsform gefährlich macht. Eine Patientin hatte von einem tiefen Schmerz gesprochen, aus dem sie mit allen Mitteln heraus wollte, und sei es tot. Ein anderer verglich diese wenige Stunden anhaltende Depressivität mit dem Sturz in einen Brunnen, der durch die Erdmitte bis Australien reicht.
Fasst man zusammen, so lässt sich festhalten, dass von einer deutlichen Zunahme depressiver Erkrankungen (Inzidenz, Prävalenz) nicht gesprochen werden kann, sondern dass dieser Eindruck durch ein verbessertes diagnostisches Procedere (z. B. auch auf der allgemeinärztlichen Seite) und ein besseres Inanspruchnahmeverhalten (siehe z. B. »Männerdepression«), durch Awareness-Programme und Entstigmatisierungsansätze zu erklären ist. Der Anteil schwerer depressiver Erkrankungen (früher endogene Depression, affektive Psychose genannt) wurde schon Mitte des letzten Jahrhunderts mit etwa 4–5 Millionen betroffenen Bürgerinnen und Bürgern für Deutschland angegeben. Allerdings wurde die gesundheitspolitische Bedeutung einer depressiven Erkrankung erst relativ spät aufgegriffen und wird heute vor allem von den Krankenkassen durch ihre Jahresberichte und die steigenden Arbeitsunfähigkeitstage sowie Frühberentungen untermauert und in die Öffentlichkeit gebracht.
Angesichts der altersassoziierten Zunahme (schwerer und chronischer) körperlicher Erkrankungen wie KHK, Diabetes mellitus, Morbus Parkinson oder Schlaganfall hat die Bedeutung und Häufigkeit komorbider Depressionen zugenommen. Komorbidität von depressiven Störungen mit anderen psychischen bzw. somatischen Erkrankungen wird ein Schwerpunktthema der Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik zukünftig werden müssen, denn depressive Syndrome beeinflussen auch Therapie, Verlauf und Rehabilitation der somatischen Krankheiten.