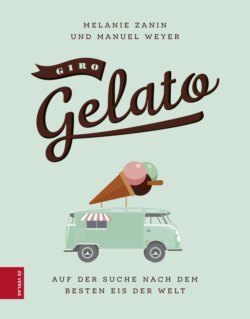Читать книгу Giro Gelato - Manuel Weyer - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDIE GESCHICHTE DER EISMÄNNER
Wer denkt bei Eis nicht sofort an Italiens sonnigen Süden? An Bella Napoli oder Sizilien, wo das Eis in der Hitze so köstlich schmeckt. Doch die Geschichte des Gelato beginnt ganz woanders: hoch im Norden in der Provinz Belluno. Im Schatten der gewaltigen Gipfel der Dolomiten. Von hier kamen die ersten Eismänner, die das Eis auch in den Norden Europas brachten.
VOR DEM EIS WAREN DER NAGEL UND DAS HOLZ
Die Landschaft ist von atemberaubender Schönheit. Schneebedeckte Berge, steile Hänge, im Sommer saftig grüne Wiesen so weit das Auge reicht. Das Zoldotal sieht heute aus wie die perfekte Idylle. Aber vor mehr als 150 Jahren war das Leben dort hart und entbehrungsreich. In den Sommermonaten arbeiteten viele Talbewohner in der Landwirtschaft. Doch auf den kargen Ackerflächen, in gut tausend Meter Höhe gelegen und für wenige Stunden am Tag von der Sonne beschienen, wuchsen nur spärlich Kartoffeln und Gerste. Andere verdienten ihren Lebensunterhalt in der Holz- und Eisenherstellung, denn im Zoldotal wurde damals hauptsächlich Eisenerz gefördert. Besonders bekannt waren die Bewohner des Tals für die Nägel, die sie herstellten. Diese Nägel halten bis zum heutigen Tag die Stadt Venedig zusammen.
In den rauen Wintermonaten jedoch gab es für niemanden mehr Arbeit und die Männer verließen das unwirtschaftliche Tal. In den Städten Italiens versuchten sie sich als fahrende Händler, verkauften heiße Maronen, gekochte Birnen und Maisgebäck. Die Saisonarbeit und das Reisen gehörten also zur ihrer Geschichte.
KALTES EIS STATT HEISSEN BIRNEN UND MARONEN
Zwei große Ereignisse sollten schließlich das Leben der Bewohner des Zoldotals für immer verändern. In den 1850er-Jahren zerstörten Unwetter die Holzsägewerke des Tals und lösten so die erste Auswanderungswelle aus. Viele Talbewohner gingen damals in die USA, wo sie sich eine neue Existenz aufbauten. Zum Ende des Jahrhunderts brach dann auch noch der Absatzmarkt für Nägel ein. Diesmal zog es die Menschen jedoch in Richtung Norden, in das europäische Ausland. Sie versuchten dort ihr Glück als Gelatieri – als Eismacher.
Da die Täler der Dolomiten 1866 zum Königreich Lombardo-Veneto und damit in den Einflussbereich der Habsburgermonarchie gehörten, war das Ziel der ersten Eismacher die Region um die Donau in Österreich und Ungarn. Auf ihrem Weg in die Fremde schlossen sich die Männer zu Kolonnen zusammen. In ihren Wohnbaracken setzten sie abends die Kältemischung auf, um das Speiseeis zu frieren. Frühmorgens stellten sie das Eis her und verkauften es tagsüber in den Straßen.
DER SIEGESZUG DER KÜHLEN KÖSTLICHKEIT
Von Italien, Österreich und Ungarn aus breiteten sich die italienischen Eismacher im 19. Jahrhundert schließlich immer weiter in den Norden und Osten Europas aus. Um die Jahrhundertwende erreichten sie auch das Ruhrgebiet. Dort zogen sie um 1900 mit den ersten zweirädrigen Handkarren durch die Gegend, aus denen sie ihr Eis verkauften. In der rasant wachsenden Industrieregion arbeiteten damals bereits zahlreiche Italiener als Saisonarbeiter im Straßen- und Brückenbau, in Steinbrüchen und im Bergbau. Für sie brachten die Gelatieri so auch ein Stück Heimat in die Ferne.
Die Familien der Eismacher blieben in der Regel in Italien, während die Männer im Sommer in den Norden gingen. Im Winter kehrten sie dann in die Berge zurück, reisten als Wanderarbeiter durch das Umland oder verdingten sich als Handwerker in den Betrieben der heimischen Dörfer – bis die ersten Sonnenstrahlen den Schnee auf den vereisten Berggipfeln zum Schmelzen brachten. Dann ging es, wenn auch schweren Herzens, wieder zurück in Richtung Norden – nach Austria oder eben vor allem nach Germania.
Die Geburtsstunde der Eisdielen, wie wir sie heute kennen, war schließlich einer neuen behördlichen Verordnung in Österreich geschuldet. Dort wird es den fahrenden Eisverkäufern Anfang des 19. Jahrhunderts verboten, ihre Speisen an öffentlichen Plätzen zu verkaufen. Nun waren die Eismänner gezwungen, sich feste Ladenlokale zu suchen. Da sie nur wenig Geld besaßen, mieteten sie die günstigeren, schlecht zu beheizenden Wohnungen im Parterre. Dort konnten sie wohnen, ihr Eis herstellen und es auch verkaufen.
Die kühle, cremig-sahnige Köstlichkeit kam so gut an, dass aus diesen Wohnungen schnell feste Eissalons wurden. Ihre Besitzer gaben ihnen Namen wie „Venezia“, „Dolomiti“ oder „Belluno“, die für die Menschen in Deutschland und Österreich verheißungsvoll exotisch klangen. Für die Italiener aber waren sie tägliche Erinnerung an die Dörfer und Städte ihrer Heimat, die sie einst auf der Suche nach ihrem Glück verlassen hatten.
EIN TRAUM VON ITALIEN – DIE EISDIELE WIRD KULT
Für uns gehören sie so selbstverständlich zum Straßenbild wie Bäckereien und Cafés, Kneipen und Bars – die italienischen Eisdielen. Wer heute das Phänomen und die Faszination „Eisdiele“ verstehen will, muss sich in eine andere Zeit zurückversetzen. In das Deutschland nach dem Krieg. In den 1950er- und 1960er-Jahren war die Eisdiele ein Sehnsuchtsort und avancierte zum angesagten Treff der Jugend. Mit der Kombination aus italienischem Flair und modernem Design entsprach sie absolut dem Zeitgeist. Die Eisdiele prägte das Lebensgefühl einer ganzen Generation. Hier konnte sie träumen und zum ersten Mal eine ganz neue Freiheit genießen.
DIE EISDIELE – BELLA ITALIA IN KLEIN
Wiederaufbau und Wirtschaftswunder kurbelten damals die Nachfrage an. Viele positive Entwicklungen sorgten dafür, dass gerade die Eisdielen in dieser Zeit so erfolgreich waren. Allein am Produkt konnte es nicht liegen, denn auch deutsche Konditoren stellten Speiseeis her, ohne dass ihre Läden einen vergleichbaren Aufschwung erlebt hätten. Der Aufschwung hatte andere Gründe als nur das Eis. Er verlief parallel mit einer wachsenden „Italien-Sehnsucht“ der deutschen Bevölkerung. Das sonnige Land im Süden wurde in zahlreichen Schlagern besungen und populäre Filme dieser Zeit spielten in Italien. Es erschien nach den schweren Jahren des Krieges und Wiederaufbaus wie der Inbegriff von Luxus und Lebensfreude. Zudem ermöglichten der steigende Wohlstand und zum ersten Mal auch der gesetzlich geregelte Jahresurlaub den Deutschen ihre ersten Reisen in das nahe Ausland. Rimini und Riccione werden zu den Traumzielen der Deutschen und fördern ihre Lust auf Eis. Für die Daheimgebliebenen wird die Eisdiele zum Urlaubsersatz.
ROCK ‘N’ ROLL UND ERDBEERFLIP
Ihren ganz großen Erfolg jedoch verdankt die Eisdiele der aufkommenden Jugendkultur. Die Eisläden füllten eine echte Marktlücke. Für Kneipengänge waren die Jugendlichen zu jung. Und Besuch zu Hause bei den Eltern war damals tabu. Kaffeehäuser erschienen den Jugendlichen zu traditionell und bieder. Die Eisdielen und populären Milchbars dagegen mit ihren langen Öffnungszeiten lagen im Trend. Musik aus der Jukebox gab den Eisdielen amerikanischen Charme, der die Jugend begeisterte. Zugleich waren die Eisdielen auch eine Art Rückzugsort. Mit Gardinen schützte man die Gäste vor den neugierigen Blicken der Nachbarn und Passanten. Dadurch ließ es sich ganz unbeobachtet flirten. Außerdem war „Nichtstun“ schließlich bis Mitte der 1960er-Jahre nicht gerne gesehen. So wurde die Eisdiele zum Symbol für eine ganz neue Ära. Heute muss sich niemand mehr hinter Spitzengardinen verstecken, um entspannt sein Eis zu genießen. Aber das erste Eis im Frühling, wenn die Eisdiele nach den langen Wintermonaten wieder öffnet, ist immer noch etwas ganz Besonderes. Oder der Eisbecher an einem warmen Sommerabend. Oder die letzte Kugel Eis vor dem Winter …