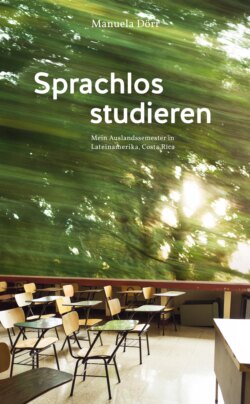Читать книгу Sprachlos studieren - Mein Auslandssemester in Lateinamerika, Costa Rica - Manuela Dörr - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Kapitel
ОглавлениеIn den Bergen der Cordillera de Talamanca, oberhalb der Baumgrenze auf fast viertausend Metern Höhe, erstreckt sich ein Flickenteppich aus wuchtigen Steinen und gelbgrünen Gräsern. Sie ragen aus den Gesteinsschichten empor und trotzen dem pfeifenden Wind. Hier rauscht eine Böe nach der anderen um die Gipfel und breitet sich auf jeder Anhöhe aus, bevor sie sich auf der anderen Seite des höchsten Punktes Costa Ricas, vereint mit trübem Nebel und Eiskristallen, wieder durch den Regenwald zum Ozean hinabstürzt.
„Wir sind gleich oben!“, rufe ich Clémence über die Schulter zu. Ich setze einen Wanderschuh vor den anderen und versuche die schmerzenden Blasen an den Zehen, die schon gestern dick geschwollen waren, zu ignorieren. Mein rechtes Bein zittert vor Erschöpfung. Hätte ich doch nur keine Jeans angezogen, ärgere ich mich, eine Leggins mit Shorts, wie ich sie beim Tanzen manchmal trage, wäre viel bequemer gewesen. Mein Blick wandert zum Gipfel, der sich östlich von mir befinden müsste.
„Endspurt! Ab jetzt steigt jeder in seiner Geschwindigkeit auf“, hatten wir abgesprochen und Sekunden später war Matthias in den Nebelbergen verschwunden. Er legt mit seinen langen Beinen ein flottes Tempo vor.
Um mein Gleichgewicht zu halten, kralle ich mich am tiefschwarzen Felsvorsprung fest, darüber verliert sich mein Weg in den Wolken. Ich halte inne, hauche eine Rauchwolke vor mir in die kalte Nachtluft und ziehe meinen Sommerschal tiefer ins Gesicht.
„Da oben kann man beide Ozeane sehen, Pazifik und Atlantik! Es lohnt sich! Aber es ist eiskalt, zieht euch bloß warm an!“, hatten uns die Ticos, wie die Bewohner Costa Ricas sich nennen, in San José gewarnt. Ich bin dankbar, dass ich zumindest halbwegs auf sie gehört habe und mehrere Schichten Sommerkleidung und die von meiner Kommilitonin María José geliehene Regenjacke übereinander trage. Aber obwohl ich mich wie ein Michelin Männchen fühle, friere ich.
„Manuela…“, keucht es aus der Dunkelheit, „sind wir richtig? … kann nicht mehr …“. Der Nebel lässt mich die Gestalt meiner französischen Mitbewohnerin und Begleiterin erahnen.
„Si se puede!“ motiviere ich sie, schaue wieder nach vorne und stapfe weiter. Meine Haare peitschen mir ins Gesicht und bleiben auf meinen Wangen kleben. Bloß nicht vom Wind zurück gedrückt werden, den glitschigen Halt im Geröll verlieren und abrutschen. Keinen Fehler machen!
Ich bändige meine langen braunen Strähnen zu einem festen Zopf. Dann greife ich in meine Jackentasche und fische nach Proviant, bis ich neben meinem Handy in einer Tüte fünf Erdnüsse und zwei Rosinen finde. Während ich inne halte und schwer atmend kaue, werfe ich einen Blick zurück.
„Clémence?“, frage ich ins Nichts, esse die letzte Nuss und warte einige Sekunden, „kommst du?“
Stille. Ich bin alleine, alleine in der Natur. Alleine an einem Ort in fast viertausend Metern Höhe, von dem ich vor vier Monaten, im Januar, noch nie gehört hatte. An dem niemand ist, auch keine Verantwortung, Sprache, Pflicht oder Rettung.
Er hupt zweimal laut, dann rast er mit Vollgas über die Kreuzung. Er scheint keine Acht auf die anderen Taxen und Monster-LKW zu geben, deren farbige Stahlkarosserien im Sonnenlicht glänzen. Die knallgelbe Ampel, die an einem über die Straße gespannten Drahtseil baumelt, war gerade erst auf rot umgeschlagen. Ich werde abrupt in den Sitz gedrückt.
„Nicht… links abbiegen?“, weise ich den Fahrer des signalroten PKWs irritiert an, schließlich kenne ich den Weg. Er scheint sich ertappt zu fühlen und biegt an der nächsten Kreuzung ab. Entspannter lehne ich mich wieder zurück und suche vergeblich den Anschnallgurt und dessen Steckplatz in der Sitzreihe. Im Rückspiegel sehe ich den Fahrer, der meine Suche belächelnd verfolgt, sodass ich aufgebe, um mich nicht weiter als Tourist zu enttarnen. Wir brausen durch kleine Straßen, nehmen eine scharfe Linkskurve, die überwuchert ist mit verflochtenen Büschen, sodass kein Lichtstrahl hindurch kommt. Wir scheinen Kreise in der Hauptstadt zu drehen und sie nicht zu verlassen. Fast immer stehen Häuser am Straßenrand, in deren Vorgärten Laubbäume oder Sträucher über die in allen Farben bemalten Gitter und Mauern ragen. Nach zehn Minuten rasanter Fahrt stoppt er endlich.
„Viertausendfünfhundert Colones“, raunt er nach hinten und streckt mir seine Hand entgegen, um das Geld in Empfang zu nehmen. Angeblich sind wir mit dem Taximeter namens ‚María‘ zu meiner neuen Vermieterin gefahren, doch ich kann kein Gerät entdecken.
Ich zögere, das sind fast sechs Euro fünfzig und laut Juan, dem hilfsbereiten Hostelmitarbeiter, dürfte die Fahrt maximal drei Euro kosten. Mir fallen die spanischen Wörter zum Diskutieren nicht ein, deshalb gebe ich nach und zahle den Wucher. Immerhin, der stämmige Fahrer wuchtet mein dreiundzwanzig Kilogramm schweres Koffermonster aus dem Wagen, als ich aus dem leuchtenden Taxi steige, und stellt es vor der Haustür ab. Dann steigt er wieder ein und braust in einer Staubwolke davon.
Das ist mein neues Zuhause für die nächsten fünf Monate!
Mein Blick fällt auf die große weiße Mauer, auf der sich ein dreißig Zentimeter hoher Stacheldraht windet. Während ich den kleinen Knopf der Klingel drücke, lasse ich meinen Blick über die vergitterten Nachbarhäuser und die einsame Straße schweifen. Ob es hier wirklich so sicher ist?
Nichts passiert, nach zwei Minuten drücke ich erneut. Was tue ich, wenn María, meine neue Vermieterin, nicht öffnet? Wie könnte ich wieder zurück zum Hostel kommen? Warum habe ich ihr so sehr vertraut? Ich kenne sie doch gar nicht!
Niemand öffnet.
Ich seufze, dann zücke ich mein Handy und wähle die Nummer, die María mir vorgestern auf einen Zettel gekritzelt hat. Telefonieren auf einer Fremdsprache ist die Königsdisziplin. Es tutet, diesmal nimmt jemand ab. Aus dem Hörer plärrt ein schnelles Spanisch, im Hintergrund höre ich Musik und Stimmen. Ich kann mir die passende Mimik und Gestik zu den Worten nicht vorstellen, deshalb verstehe ich nur die Hälfte. Dann legt sie auf. Sie kommt gleich, glaube ich.
Ich schleife den Koffer an einem Schlagloch vorbei bis an die Wand und setze mich auf das Ungetüm. Für meine nächste längere Reise nach Südamerika werde ich auf einen großen Rucksack umsteigen, der ist handlicher.
Drei Kinder huschen auf Bobbycars vorbei. Zwei junge Männer machen sich an einem Erdberg vor ihrer Haustür zu schaffen und schaufeln dynamisch um die Wette. Gegenüber flattert ein leichter Vorhang, es muss die Zielfahne sein, denn die drei Kinder drehen nun bereits kreischend und lachend die dritte Runde.
Eine Stunde ist seit unserem Gespräch vergangen. Zum Glück ist es in San José ganzjährig recht kühl, sonst würde ich in der prallen Sonne einen Hitzschlag bekommen. Es muss merkwürdig für die Bewohner sein, dass eine Europäerin seit einer Stunde vor dem Haus ihrer Nachbarin sitzt.
Reggaemusik hallt durch die Straße und ein junger Mann fährt in seinem Auto vorbei. Er erreicht schließlich meine Höhe und wird langsamer. Ich meide den Blickkontakt und zum Glück fährt er weiter. Verstohlen schaue ich nun immer öfter auf meine Uhr…
Dann endlich! Ein silberner Geländewagen fährt vor, auf dem Beifahrersitz meine Vermieterin. Sie öffnet per Fernbedienung das Tor und ich folge dem Wagen ins Innere. Hinter uns schließt sich die Metallwand wieder.
„Buenos días, Manuela“, grüßt mich María, als sie aussteigt. Ihre Haare sind streng zu einem Pferdeschwanz gebunden und ihr rundliches Gesicht zur Eingangstür gerichtet. Wir gehen über den hellen Innenhof und betreten das Haus durch die unverschlossene Tür. Dort stehen drei wuchtige Couchen, deren Lehnen mit edlem dunklem Holz gearbeitet sind, und ein dazu passender Holztisch. Wir stehen im dunklen Wohnzimmer, welches in die Küche übergeht. Einen Flur scheint es nicht zu geben. María und ihre Tochter Patricia haben wegen mir eine Feier verlassen, entnehme ich ihren Worten. Dann stöckelt sie mit ihren schwarzen Lackschuhen über die Fliesen auf mein Zimmer zu und streckt den Arm wegweisend aus: „Ihr Zimmer.“
Ich sehe einen dunkelbraunen Kleiderschrank, einen kleinen Schreibtisch und ein Bett, auf dem fein säuberlich eine helle Decke mit pastellrosa Blümchen und cremefarbener Spitzenkante liegt. Euphorisch lege ich meinen Koffer auf den beige bemusterten Fliesenboden, krame in seinem Innern und verwandle diesen etwa zehn Quadratmeter großen Raum in mein Reich.
Ordnung! Endlich habe ich meine Kleidung, meine Fotoausrüstung und meine Bücher im Blick. Drei Wochen habe ich im Hostel aus dem Koffer gelebt, jetzt weiß ich einen Schrank zu schätzen.
Ich kann María im Erdgeschoss des zweistöckigen Hauses nicht finden. Aber wo finde ich das Bad? Und wo in der Küche darf ich meine Lebensmittel verstauen? Nicht einmal einen Eingangsschlüssel habe ich bekommen. Ich setze mich an meinen Schreibtisch und werfe einen Blick in mein Spanischbuch. Das Rascheln des Papiers, wenn ich eine Seite umschlage, durchschneidet die merkwürdige Stille. Zuerst tippe ich mit dem Stift auf den Tisch, dann schalte ich Musik über mein Smartphone ein. Immer wieder schaue ich durch die Gardine in den steinernen Garten: Dort passiert nichts. Die weißen Mauern, der weiße Betonboden und die drei weißen Badeliegen scheinen miteinander verschmolzen zu sein. Keine einzige Pflanze, lediglich eine Ecke des türkisfarbenen Swimmingpools sehe ich, doch darin befindet sich kein Wasser.
Bis gerade war ich noch permanent umgeben von Backpackern, die mir ihre schillernden Geschichten auf Englisch erzählten und jetzt… Ich schlucke den Kloß herunter und wende mich wieder meiner Lektüre zu, als aus der Küche unverständliche Wortfetzen in mein Zimmer durch die spaltweit geöffnete Tür dringen.
Mein Einsatz! Auf dem Weg zur Küche kommt Monchis auf mich zugelaufen, springt im Kreis um mich herum und beginnt schwanzwedelnd an meiner Hose zu schnuppern. Sie erinnert mich an die eingelaufene Variante eines Dalmatiners.
Die Hosteltiere scheinen eine bleibende Duftnote auf meinem Kleidungsstück hinterlassen zu haben. Ich kraule die Hündin, die sich direkt auf den Rücken wirft und genussvoll quietschend alle Viere in die Höhe strampelt. Von den Damen werde ich nicht beachtet, es fühlt sich so an, als ob ich schon immer hier wohnen würde.
Nicht als Feind, nicht als Freund. Ich bin da, das ist so. Punkt.
Sprache, das sind Buchstaben und Wörter, getrennt von Punkten und Strichen. Jede Sprache hat ihr eigenes Gefühl und ihre eigene Melodie. Ich liebe spanische Musik, besonders wenn ich mich beim Tanzen in eine andere Welt träume und alles um mich herum vergesse. Vielleicht habe ich deshalb beschlossen, Spanisch zu lernen.
Nach Mexiko wollte ich. Der Gedanke, aus dem grau-braun-weißen Ruhrgebiet zu fliehen und in einem vor Sonne, Natur, Licht und Farbe strotzenden Ort Fotografie zu studieren, hat mich motiviert. Einen Teil der Welt verstehen, so lange ich die Möglichkeit dazu habe. Aber leider gibt es die Partnerschaft zwischen meiner Fachhochschule und der Universität in Guadalajara nicht mehr.
Trotzdem sitze ich in Dortmund in der Gesellschaft von zwanzig anderen Studierenden in einem Klassenraum. Die nagelneuen grauen Tische sind groß genug, dass Hannah und ich unsere Schulbücher, Vokabelhefte, Schreibordner und Stifte darauf ausbreiten können. Ich beuge mich nach vorne, schiebe meinen modernen buchefarbenen Stuhl ein Stück zurück und berühre mit meiner Nase fast den Text. Seit einer Minute versuche ich auf Spanisch zu erklären, dass ich gerne zwei Tomaten und drei Bananen kaufen würde.
Hannah schaut mich mit großen Augen an, wirft ihre unendlich langen blonden Haare in den Nacken und bringt dann ein „Usted quiere más?“ hervor.
Ja, mehr Spanisch möchte ich, aber nicht mehr imaginäre Einkäufe! Ich mag ins Land gehen und mich im Tumult auf dem Markt zwischen die Frauen drängen. Dem grauhaarigen Verkäufer, der zum Gruß an seinen Hut tippt, direkt in die tiefschwarzen Augen sehen: „Buenos días, usted tiene dos tomates y tres bananos, por favor?“
„No, gracias! Yo no quiero más“, sage ich stattdessen. Im Anfängerspanischkurs der Uni haben Hannah und ich uns kennengelernt, sind gute Freundinnen geworden und sitzen nun in unserem zweiten dreimonatigen Kurs nebeneinander. Sie lernt Spanisch, um ihre Schulkenntnisse aufzufrischen und vielleicht bei ihrem nächsten Urlaub in Spanien auf Spanisch einen Café im Café ordern zu können.
„Würdest du in Mittelamerika studieren wollen?“, frage ich sie, als sie meine Antwort zur Aufgabe notiert.
„Neee, das ist doch viel zu gefährlich“, entgegnet sie und hält kurz inne, „und die sind doch alle korrupt, die Machos da… Und das ist voll weit weg! Und ein ganzes Semester wär’ mir auch zu lang, so ohne Familie und Freunde und so“, überschlagen sich ihre Argumente. Ich tippe mit dem Füller kleine Punkte auf das Gemälde in meinem Heft. Vielleicht hat sie recht. Vielleicht betrügt mich der Marktverkäufer und steckt mein Geld dreckig lachend ein. Oder ich erreiche den Stand im Gedränge der Menschen gar nicht erst, sodass ich nicht einmal die Chance bekomme, betrogen zu werden. Was wohl schlimmer ist?
Vielleicht lieber in Europa bleiben und Spanien erkunden? Die Überschriften und Zahlen in meinem Heft habe ich längst in abstrakte Schnörkel verwandelt, andere tragen nun tintenblaue Tomaten und Bananen anstelle von Fragezeichen, als die freundliche chilenische Spanischlehrerin hinter uns steht und das Ergebnis unserer Partnerarbeit sehen möchte.
Nach dem Sprachkurs gerate ich in den Berufsverkehr, als ich mit der Bahn zu meinem Freund fahren möchte. Ein Ellbogen trifft mich unsanft, ich wanke und schiebe mich an den drei Jugendlichen auf den Stufen vorbei, dann schaffe ich es, im Abteil einen Sitzplatz zu ergattern. Meine Füße quetsche ich übereinander, weil die beiden Frauen, die mir gegenüber sitzen, den Fußraum mit ihren Koffern versperren. Die eine hat ihren Kopf auf den Schultern der anderen abgelegt und zupft nun an ihrer Jacke, um sich besser zuzudecken.
Ich widme mich meinen Spanischvokabeln, dafür sind Bahnfahrten hervorragend geeignet. Jede Sekunde, in der ich warten muss, wiederhole ich einige Worte und lasse meinen Wortschatz langsam wachsen. Plötzlich meine ich, spanische Worte zu hören. Treiben meine Gedanken mich in die Irre? Als ich hochschaue, blicke ich direkt in die dunklen Augen der jungen Frau, die mir gegenüber sitzt. Sie war das!
„De dónde estáis?“, wittere ich meine Chance, noch effizienter Spanisch zu lernen.
„De Colombia!“ Ja, die beiden kommen wirklich aus Lateinamerika, aus der Hauptstadt Bogotá. Mutter und Tochter reisen zusammen, um die zum Studium ausgewanderten Söhne beziehungsweise Brüder zu besuchen. Die junge Frau spricht ein wenig Deutsch, die Mutter ausschließlich Spanisch.
„Unglaublich, dass der Zug so voll ist“, stellen die beiden fest.
„Sonntags fahren alle zurück. Nach Hause. Wie Sie reisen? In Kolumbien?“, frage ich gespannt auf Spanisch.
„Da fährt man Auto, ganz viel mit dem Moped oder man nimmt einen der überfüllten Busse.“ Fahrradfahrer? Fußgänger? „Eher weniger“, erklären sie mir.
„Insgesamt sind wir einen Monat in Europa. Wir waren zuerst in Paris, dann in München, in Köln und nun treffen wir uns in einem kleinen Ort an der Nordsee. Weihnachten feiern wir alle zusammen in Berlin und anschließend geht es noch Richtung Nürnberg“, die junge Frau setzt sich auf.
„Waren Sie Costa Rica? Ähhh, IN Costa Rica?“, platzt es aus mir heraus. Das kleine Land ist von Kolumbien nur durch das angrenzende Panama getrennt.
„Nein, noch nicht. Aber die Menschen dort sprechen sehr schnell!“, sie lachen, ich schließe mich an, was auch immer das bedeutet. Bevor ich in Dortmund aussteigen muss und mich verabschiede, wundern die beiden sich noch über meinen Namen.
„Manuela, das klingt doch eher Spanisch oder…“
„Nicht deutsch! Wegen mein… Name… mich… möchte Spanisch zu lernen!“, antworte ich stolz, bevor ich mich hinaus quetsche. Selbst die stockenden Menschenmassen im Hauptbahnhof können mein Dauergrinsen nicht vertreiben. Das war mein erstes spanisches Gespräch außerhalb der Sprachkurse und es hat funktioniert!