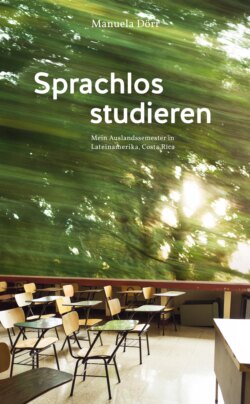Читать книгу Sprachlos studieren - Mein Auslandssemester in Lateinamerika, Costa Rica - Manuela Dörr - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Kapitel
ОглавлениеIch betrete das lichtdurchflutete Verwaltungsgebäude auf dem Campus der Uni, in dem auch das International Office sein Büro hat. Verni ist der für Austauschstudenten zuständige Mitarbeiter der Universidad de Costa Rica, der UCR. Er gibt sich große Mühe und erklärt mir alles mehrmals, wenn ich ihm nicht folgen kann.
„Hier ist eine Zusammenfassung. Also, zuerst müssen Sie…“, setzt er erneut an. Die Liste, die zwischen uns auf dem Tisch liegt, umfasst fünf Seiten, die in einer sehr kleinen Schriftgröße bedruckt sind und Anweisungen für die Beantragung des Visums enthalten.
„… dann müssen Sie zum Notar und die Übersetzungen beglaubigen lassen …“, demonstrativ umkreist er einen Absatz und notiert daneben die Telefonnummer von einem Notar, den er mir empfehlen würde.
Als Tourist hat man zwar die Möglichkeit, nach neunzig Tagen das Land zu verlassen und wieder neu einzureisen, aber das gilt nicht für Studenten: Die Universität darf keine Noten eintragen, wenn man nicht über ein Studentenvisum verfügt. Es führt also kein Weg am Visum vorbei.
Mit den neuen Informationen im Gepäck, laufe ich zurück ins Hostel, in dem ich mittlerweile seit drei Tagen wohne. In dem Hotel am Flughafen hatte ich ausgeschlafen, war gegen sechs Uhr morgens nach neuer Zeitrechnung wach geworden und hatte gefrühstückt, bevor ich mich ins Stadtzentrum zum Hostel, in welchem ich ein Bett für zwei Wochen reserviert hatte, fahren ließ.
Das helle Gebäude mit seinem großen Gittertor befindet sich direkt gegenüber von einem kleinen Park und im Zentrum San Pedros, des Studentenviertels. Wenn man die Klingel drückt, öffnet ein Mitarbeiter das graue Eingangstor und man kann den geräumigen Flur betreten. Die Haustür steht Tag und Nacht weit offen, sodass drinnen permanent ein frischer Luftzug herrscht. Mir kommt es so vor, als ob die Ticos die anderen nicht aus-, sondern sich selbst zum Schutz einsperren würden.
„Hola! Todo bien?“, grüße ich Juan, der an der Rezeption mit einer Backpackerin ins Gespräch vertieft ist und gehe ins Wohnzimmer. An der einen Wand hängt eine riesige Landkarte mit Informationen über die Region, gegenüber steht ein Fernseher und durch das riesige Fenster der dritten Wand kann ich in den Garten schauen. An den mit Stacheldraht bekrönten Mauern wachsen große saftiggrüne Gewächse empor und scheinen eine Wahrheit zu verdecken. Ich würde fast sagen, dass dieser Garten durch seine Kompaktheit an deutsche Gemütlichkeit erinnert, wie ein geheimer Rückzugsort. Dann sind da noch die beiden Haustiere, die nicht ins Haus dürfen, aber immer wieder einen Weg finden. Gerade hat sich der kleine Hund an den Füßen der Gäste vorbei durch die Gartentür gemogelt und sich dann schnell drinnen versteckt. Manchmal klettert die Katze die Regenrinne hinauf und lässt ihren kleinen kläffenden Freund zurück im Pflanzenparadies. Jemand spielt Gitarre.
Ich breite meine Zettel auf dem flachen Couchtisch aus und erstelle mehrere Häufchen, fülle Formulare aus und bin überrascht, dass ich mittlerweile meine Reisepassnummer fast auswendig weiß. Bei der Anmeldung zum Sprachkurs, bei der Aktivierung der Handynummer, bei der UCR, ja, sogar im Hostel beim Check-in muss sie eingetragen werden. Ob der Pass anhand der Ziffernkombination gefälscht werden kann? Ich hoffe nicht.
Ich erstelle eine Liste, was zu tun ist:
- Kopien aller Seiten des Reisepasses und eine Bescheinigung der UCR mit Daten von mir beim Notar beglaubigen lassen
- Nächste Banco Nacional de Costa Rica finden
- Montag dort zehntausend Colones, etwa vierzehn Euro, auf das Konto des Notars einzahlen
- Diese Unterlagen zur UCR bringen und von dort abschicken lassen
- Geburtsurkunde und Polizeiliches Führungszeugnis samt Apostille vom Übersetzungsbüro übersetzen lassen
- Mit Übersetzungsbüro per Mail einen Termin vereinbaren
- Das Übersetzungsbüro finden
- Nächste Banco de Costa Rica finden
- Dort etwa fünfzig Cent, auf das Konto der UCR einzahlen
- Einen ‚Beweis über meine Identität‘ in der Deutschen Botschaft in San José einholen
- Montag dort anrufen und fragen, ob ich einen Termin benötige
- Vom Notar den Liquiditätsnachweis beglaubigen lassen. Ich frage mich nur gerade, ob der nicht vorher übersetzt werden muss...
- Noch einmal mit dem Übersetzungsbüro sprechen
In Costa Rica gibt es keine Adressen. Das konnte ich mir früher nicht vorstellen, jetzt muss ich mich damit zurecht finden. Optimistisch verfolge ich die Wegbeschreibungen zu den einzelnen Stationen auf einer Karte im Smartphone und markiere meine Ziele. Hoffentlich sind die Orte sicher, damit ich das Handy als Karte aus meinem Rucksack holen kann. Schließlich werde ich immer wieder von Ticos vor Überfällen gewarnt.
Manche der anderen Reisenden haben auch mit Papierkrieg zu kämpfen. Bruce aus North Carolina setzt sich mit mindestens zehn Kopien seines Passes neben mich und beginnt sie ordentlich zu falten.
„… um die Grenze bei meiner nächsten Fahrt möglichst schnell passieren zu können…“, erklärt er. Er möchte nach Panama und dann immer weiter in den Süden. So weit, dass es wieder eisig kalt wird und er vom Ende des Kontinents zu fallen droht. Ich merke, dass ich nicht mehr so gestresst und aufgeregt bin, wie bei der Vorbereitung der Reise in Deutschland. Ich muss immer wieder an die verregneten Wintertage in Hamburg denken, an denen ich hinter dem von Tropfen bedeckten Fenster saß und mir alleine den Kopf über etliche spanische Formulare zerbrach.
Ich stelle mir eine große goldene Handtasche vor, die mit etlichen Ein-Dollar-Noten gefüllt ist. Ich laufe durch den Flughafen Atlantas, in dem ich umsteigen werde und bei jedem Schritt flattert ein Geldschein von dannen. Während sich hinter mir Touristen in Hawaiihemden auf die gelblichen Blätter stürzen, steige ich ins Flugzeug und darf dieses in Costa Rica nicht verlassen, da die Tasche leer und mein Auskommen nicht gesichert ist. Ohne Moos nichts los! Ich fliege zurück und kann mir am überteuerten Flughafen in den Staaten gerade noch ein Sandwich leisten, da ich einige meiner verloren geglaubten Scheine in den unendlichen Fluren wiederfinden konnte…
Ich blinzele ins grelle Licht meines Laptops, der geöffnet vor mir steht. Ich muss eingeschlafen sein. Hier viel zu hell, draußen viel zu dunkel; meine Pupillen sind überfordert. Ich sollte ins Bett gehen und mich morgen nach der Arbeit weiter mit dem Papierkrieg befassen.
Gerade bin ich für ein Praktikum in der Hansestadt, sodass der Weg zum Konsulat sehr kurz ist, aber trotzdem habe ich zwei Wochen vor Abflug noch immer kein Einreisevisum. Einige Tage, nachdem ich die Unterlagen das erste Mal übersandt hatte, rief ich im Konsulat an.
„Haben Sie die Apostille?“, hatte mich eine raue Frauenstimme am anderen Ende der Leitung gefragt.
„Apostille? Was ist denn das genau?“, ich verstand diesen Begriff nicht. Ist das ein zusätzliches Formular?
„Ja, dann holen Sie die erst. Tschüss!“, versetzte mich die Mitarbeiterin des Konsulats.
„Moment! Was ist eine Apostille“, konnte ich sie aufhalten, „und wo bekomme ich sie…“
„Das steht in den Unterlagen!“, fiel sie mir ins Wort, ehe ich ihr noch sagen konnte, dass ich die Unterlagen mehrmals gelesen hatte und es daraus für einen Bürokratie- und Visumslaien definitiv nicht hervor ging.
„Moment“, ich war verwirrt, „ich besorge die fehlende Unterlage schnellstmöglich, ich recherchiere das. Kein Problem. Ich muss aber bis in zwei Wochen mein Visum haben, da ich dann fliege. Aber bitte, können Sie mir vielleicht bitte schon einen Ausstellungstermin für das Visum bei Ihnen frei halten?“
„Nein. Erst die Apostille! Diese Woche habe ich keinen Termin mehr frei. Nur nächste Woche noch einen.“
„Können Sie mir den vielleicht bitte…“
„Nein“, tönte es aus dem Hörer und schon hatte sie aufgelegt.
Ich suche also im Internet: Ist eine Apostille ein Siegel, ein Stempel oder ein weiteres Formular?
Die Homepages des Bundesjustizamtes und des Bundesverwaltungsamtes geben mir Aufschluss. Die Apostille gehört auf mein Polizeiliches Führungszeugnis und die Internationale Geburtsurkunde. Eine Katastrophe, so kurz vor dem Ziel!
- Ich brauche jeweils eine Beglaubigung —> Habe ich
- Ich brauche jeweils eine Überbeglaubigung alias Apostille —> Habe ich nicht
- Der Postweg dauert jeweils etwa eine Woche plus Bearbeitungszeit.
- Der vollständige Antrag muss erneut bei der Botschaft eingereicht werden.
- Ich fliege in zwei Wochen…
Ich sitze auf der Bettkante in unserer WG und drehe mit den Fingern etliche kleine Löcher in die bauschige Stofflandschaft. Das kann nicht sein! Ich habe keine Zeit, durch Deutschland zu fahren, nur um Stempel zu besorgen. Wie soll ich das meinen Chefs beim Praktikum gestehen?
„Nein, ich muss das Praktikum wegen des zusätzlichen Sprachkurses in Costa Rica nun nicht nur um einen Monat früher beenden, sondern wegen zweier Stempel einen zusätzlichen Tag fehlen.“ Ich weiß, dass sie Verständnis haben werden, sie reisen selbst viel. Trotzdem hatte ich das alles anders geplant.
Meine WG-Mitbewohnerin kocht Tee für uns und reicht mir eine Tasse.
„Ich würde dir so gerne helfen…“, gesteht sie, aber wir wissen beide, dass das nicht geht. Mein Teebeutel schwimmt von Wand zu Wand und hinterlässt dunkelrote Schliere im heißen Wasser. Ich habe keine Wahl: Ich muss fahren, meinen Körper in einen Zug setzen, den Geist nicht vergessen und schon jetzt mit dem Reisen beginnen.
Der Tee ist durch. Ich beichte mein Vorhaben bei der Praktikumsstelle, kaufe sündhaft teure Tickets und steige am selben Abend in den Zug von Hamburg über Dortmund, nach Bonn, nach Köln.
Das Bundesjustizamt befindet sich drei Minuten Fußweg entfernt von der Haltestelle Bundesrechnungshof. Es ist früh morgens und noch duster, als ich zwischen dunklen Steingebäuden die nasse Straße entlang gehe und versuche, den Pfützen zwischen den Gehwegplatten auszuweichen. Schließlich stehe ich vor einer modernen Glastür, die automatisch öffnet. Der Pförtner lässt mich eintreten, sodass ich am Eingang mein Führungszeugnis mit einem müden Blick durch einen Spalt schieben kann. Im Raum vor mir brennt Licht, ‚karack‘ macht es und ich erhalte mein Polizeiliches Führungszeugnis samt Stempel und Unterschrift zurück. Am liebsten wäre ich der Frau dankend um den Hals gefallen, eine Glasscheibe zwischen uns hält mich jedoch auf Distanz. Durchsichtig, aber unüberwindbar. Ein Tag Fahrt für mich, zwei Minuten für das Amt. Das nenne ich ehrfürchtig Zeitmanagement.
Weiter geht die Fahrt mit der Straßenbahn, durch Vororte und Felder, dann ein Fußmarsch und ich stehe vor dem Bundesverwaltungsamt in Köln. Dort warte ich kurz im Empfangsraum, bis ein zuständiger Mitarbeiter nach meinem Führungszeugnis fragt, hinter einer doppelt gesicherten Glastür verschwindet und mich mit leeren Händen zurück lässt.
Mir bleibt nichts anderes übrig, als mich auf die in dem kleinen Vorraum befindliche eckige moderne Ledercouch zu setzen und unruhig die Umgebung zu betrachten. Hoffentlich klappt alles? Wissen die Behörden, dass sie gerade über mein zukünftiges Leben entscheiden?
Neben mir sitzt ein älterer Herr, gänzlich gelassen; unsere Blicke streifen sich bevor sie sich treffen. Auch er wartet auf einen Stempel.
Bei Visumsangelegenheiten kommt man ins Gespräch und plötzlich lernt man jemanden kennen, der für ein mittelständiges Unternehmen Filteranlagen durch die Welt schippern lässt. Die Aufgabe meines Gesprächspartners ist es, die Stempel zu besorgen und den anderen die lästige Arbeit vom Hals zu halten. Ob er das auch für überforderte angehende Austauschstudenten macht?
Die große Glastür am anderen Ende des Raumes öffnet sich, eine Dame erscheint mit meinem Zeugnis, das nun an ein zweites Blatt geheftet ist und ein weiteres Autogramm trägt. Ob das die Apostille ist? Ich frage sicherheitshalber nach.
„Ja, das macht dreizehn Euro“, verkündet sie. Während ich zahle, vollführe ich innerlich einen Freudentanz, über der edlen Couch verzaubern Scheinwerfer in bunten Farben den Raum und Salsa-Musik sprudelt aus dem Ansagelautsprecher der Empfangsdame. Die Realität sieht anders aus, lediglich ein Sonnenstrahl verirrt sich durch die Jalousien und verfehlt nur knapp die kostbare Urkunde in meinen Händen.
Tadaaa, die Apostille! Sogar günstiger als das Bahnticket!
Der Mann auf der Couch nickt mir zu, er muss noch warten. Ich drückte die schwere Tür des Köllner Verwaltungsamtes auf und trete hinaus. Wenn sich keine Wolken vor die Sonne geschoben hätten, hätte mir diese sicherlich hemmungslos ins Gesicht geschienen. Zeit, den Heimweg anzutreten und morgen beim Praktikum Vollgas zu geben.
Während ich mich von der Bahn in die Polster schaukeln lasse, betrachte ich die Landschaft durch das einen Quadratmeter große Fenster. Am besten sollte sich der Zug direkt in die Lüfte heben und mich in die Hitze Lateinamerikas tragen. Die Landschaft aus kugeligen laublosen Kastanienbäumen würde sich in Streifen verwandeln, wir würden die Wolkendecke durchbrechen und dem blauen Weltall entgegen sausen.
Bis Costa Rica.
Die Menschen haben Kopfhörer im Ohr, schauen auf ihr Handy, auf die Uhr, aus dem Fenster. Einige dösen und der Kopf schaukelt im Takt der Bewegung. Von links nach rechts bei einer Kurve, sonst vor und zurück. Es rattert, quietscht und zischt, als sich die Bahn in die Kurve schmeißt und der Regen gegen die Scheibe klatscht. Dann kommt sie langsam zum Stehen. Hier muss ich raus.
Das Blinken des roten Lichtes wird von einem monotonen Piepen verfolgt und die Tür vor mir schiebt sich zur Seite. Es bildet sich eine Luke, dann ein Tor nach draußen, durch das kühle Luft ins Innere strömt und ich kann es gar nicht erwarten, loszugehen, hängt von diesem Besuch doch so viel ab. Mein rechter Fuß steigt zuerst über den kleinen, aber tiefen Spalt, der den grauen PVC-Fußboden vom Bahnsteig trennt. Gleich hat der Visumsspuk ein Ende!
Die leicht erhobenen Linien der steinigen Gehwegplatten leiten mich zum Ausgang der S-Bahnstation Blankenese, als ich die Hitze aus meiner dicken goldgelben Daunenjacke befreie und die warme Luft wie ein Schwarm winziger Insekten in die Höhe steigt. Im Gehen ziehe ich den Stadtplan aus meiner Tasche und werfe noch einen Blick auf die scheinbar vollständigen Unterlagen, dann bahne ich mir den Weg zum Konsulat.
Bald werde ich mich hoffentlich auf den Weg machen, vorbei an amerikanischen Passkontrollen, direkt ins Herz Mittelamerikas, nach Costa Rica. In das Land, das mit giftgrünen Fröschen, babyblau bemalten Saftständen und Abertausenden von tropischen Bäumen, die mit prallen Früchten behangen sind, in meinem Spanischlehrbuch präsentiert wurde. Das Paradies aller Tiere, vielleicht auch das der Menschen. Ein kleines Land von etwa fünfzigtausend Quadratkilometern Fläche mit fast viereinhalb Millionen Einwohnern. Costa Rica hat nur zweieinhalb mal so viele Einwohner wie Hamburg.
Meine linke Hand umklammert die schwarze Ledertasche, deren Reißverschlüsse ich sorgfältig wieder geschlossen hatte, nachdem ich kurz vor dem Verlassen der Bahn abermals alle Dokumente kontrolliert hatte. Gleich würde ich auch den letzten Stempel für das Visum erhalten. Hoffentlich… Als ich vorhin meinen Reisepass betrachtete, nahm ich auch das blaue Papieretui in die Hand, in dem ich meine Passfotos aufbewahre. Ich lächelte mir selbst aus meiner Hand entgegen. Ob ich wohl einen Stempel auf den Kopf bekomme? Egal, Hauptsache ich bekomme einen Stempel.
Juan läuft vorbei, in der Hand hält er eine geschnittene Limone und zwei Tassen schwarzen Tee. Er stellt eine vor mir auf dem Couchtisch ab und gesellt sich zu mir.
„Was zur Hölle machst du da?“, er mustert erst meine Papiere, dann mich. Anscheinend bin ich doch viel klischeedeutscher, als ich gedacht hatte. Der Mitarbeiter des Hostels begleitet mich in seiner Freizeit zu Wohnungsbesichtigungen und hilft mir bei spanischen Telefonaten. Jetzt beobachtet er meine Sortieraktion.
„Visumszeug. Was ist ‚Contador’?“, eine Strähne kitzelt mich im Gesicht, ich puste sie zu Seite.
„Das ist jemand, der Stempel auf Unterlagen setzt und sie beglaubigt“, antwortet Juan und schiebt seine Brille zurecht. Er wohnt genau so lange im Hostel Urbano wie ich, nur mit dem Unterschied, dass er mindestens ein Jahrzehnt älter ist und hier ein halbes Jahr gegen Logis morgens das Frühstück für die Backpacker zubereiten und die Betten der Schlafsäle frisch bezieht.
Als ich mich für den Tee bedanke, fällt die Strähne zurück. Ich klemme sie nun im Haargummi fest und schnappe mir die grüne Halbkugel, die ich über der braunen Flüssigkeit zerdrücke. An der Tasse nippend lehne ich mich zurück.
„Gut, dass ich sowas als Argentinier nicht machen muss“, bemerkt er und macht es sich ebenfalls auf dem Sessel bequem, indem er bis zur Rückenlehne rutscht und dann die Arme von sich streckt.
„Was meinst du?“
„Na, das Visumszeugs da. Ich hab sowas noch nie gemacht. Meine ganzen fünf Reisejahre nicht. Bin eben immer unterwegs.“
„Du Glücklicher!“, ich beuge mich wieder vor und betrachte die Zettel und die auf ihnen markierten Fremdwörter. Ich habe alles eingefärbt, was ich noch nachschlagen sollte. Das Resultat ist ein fast komplett gelber Text. Mir raucht bereits der Kopf, durch den Tee wird er nicht abkühlen. Ich schiebe Zettel hin und her und verliere ein wenig den Überblick. Ich bilde Stapel. Ein Aktenordner, das wäre eine Lösung meines Sortierproblems und die Krönung des Deutschseins. Effektivität steht im Zentrum. Vermutlich werde ich für die Behördengänge ein Buch zum Lesen in der Wartezeit mitnehmen. Vermutlich werde ich die Zeit sinnvoll nutzen. Ich plane.
„Ich… I ääähhh, I like… Dorm?!“, hören wir die Stimme einer jungen Frau aus dem Eingangsbereich.
„Ich muss runter“, erklärt Juan, streicht sich mit der flachen Hand über den Kopf, als ob er die Haare auf seiner Halbglatze richten müsste und springt auf. Sprachlosen Reisenden unter die Arme greifen, ihnen ihren Tag retten und sich selbst ein Lächeln garantieren, so ist er. Ob er auch einen Ordner mit allen seinen Unterlagen besitzt?
„Nimm bloß keine große Tasche mit auf die Straße“, beschwört mich ein blonder Backpacker, als ich meinen Rucksack packe, um zum großen Bürogeschäft in der Nähe zu gehen, „wer so aussieht, als ob er viel besitzt, der wird überfallen!“
„Du wirst dann sofort überfallen“, hatte auch Hannah damals sorgenvoll für mich recherchiert. Ich verlasse das Hostel und beginne, meinen Rucksack an mich zu klammern. Natürlich habe ich meine Kamera dabei, aller Gefahr zum Trotz. Ein gutes Foto kommt, wenn es kommen will. Dann kein Foto machen zu können, das halte ich nicht aus. Mir bleibt keine Wahl. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich für meine Umgebung sehr reich aussehe. Unsicher gehe ich schnellen Schrittes auf dem Bürgersteig neben der befahrenen Straße. Ein LKW rauscht vorbei und hinterlässt eine riesige Wolke aus Abgasen, ein paar Jungs pfeifen mir nach, gefolgt von einem „Bonita!“ und „Hermosa!“ Ansonsten folgen alle ihrem Weg zum Bus, nach Hause oder zur Mall. Keiner bedrängt mich. Ich gehe einfach an dieser Straße entlang, als wäre es das Normalste der Welt.
Im Eingangsbereich des modernen Bürowarengeschäftes stehen drei Männer. Sie tragen weiße Hemden und schwarze Hosen und nicken mir zur Begrüßung freundlich zu.
„Muchacha, por favor!“, ertönt es hinter mir, als ich zielstrebig in das Innere der Halle gehen möchte. Was? Werde ich überfallen? Ich fahre rasant herum und schaue direkt in das Gesicht eines der drei Sicherheitsmänner.
„Können Sie bitte Ihren Rucksack am Empfang abgeben? Vielen Dank!“, erklärt der jüngste der drei Herren mir und deutet auf einen zum Logo der Firma passend rot gestrichenen Tresen. In größeren Geschäften muss man in Costa Rica immer die Tasche am Eingang abgeben, sie wird in einem Fach hinterlegt und man bekommt ein Schild mit einer Nummer ausgehändigt. Kein Grund zur Sorge, beruhige ich mich und vertraue der Dame meinen Rucksack an. Sie steckt ihn mit ihren langen, lackierten Nägeln in das unterste Fach, dann drückt sie mir eine Plastiknummer in die Hand.
Wenn ich einen Ordner kaufe, dann brauche ich auch einen Locher, stelle ich fest, während ich vor der unendlichen Auswahl stehe und mich nicht entscheiden kann. Letztendlich wähle ich eine grüne Mappe mit zehn Fächern, die in einem Angebot um die Hälfte des Preises reduziert ist. In die Mappe passen laut Beschreibung sowohl meine Din A4 Blätter aus Deutschland, als auch die Din B4 Kopien aus Costa Rica. Ich bin begeistert und greife zu.
„Que tenga un buen día!“, strahlt mich die Kassiererin an, als ich bezahle.
Kurze Zeit später, ich schlendere deutlich entspannter zurück, erreiche ich das Hostel unversehrt. Es gab nie einen Grund zur Sorge, wird mir klar, als ich die beim Straßenhändler erstandene Mango in der geräumigen Küche teile, das Fruchtfleisch in Stücke schneide und mit einem Löffel aus der Schale löse. Ich nehme den alten Filzstift, der an einer Kordel vom Griff hinunter baumelt, beschrifte die andere Hälfte mit meinem Namen und lege sie in den großen Kühlschrank, in dem jeder seine Lebensmittel deponieren kann.
Im Zwölfer-Zimmer verstaue ich meinen Rucksack samt Kamera in meinem Fach unter dem Hochbett und lasse das kleine Vorhängeschloss zuschnappen. Dann widme ich mich wieder meinen Zetteln.
Da ich nicht für immer in Hostel wohnen kann und lieber die costa-ricanische Kultur in einer Familie kennenlernen möchte, suche ich eine neue Bleibe. Von Deutschland aus war es kaum möglich, eine Unterkunft zu finden, da es keine entsprechenden Internetportale gibt. Vor Ort ist das viel einfacher, hatte ich recherchiert. Zum Glück habe ich bei meiner Wohnungssuche eine Mitstreiterin gefunden: Annette arbeitet im Hostel und möchte ein eigenes Zimmer beziehen, nachdem sie einige Monate im Mitarbeiterschlafsaal gewohnt hat. Jetzt sehnt sie sich nach Privatsphäre. Zudem stehen in Costa Rica alle Türen offen, sodass man jedes Hupen von der Straße, die Musik vom Fernseher aus dem Nachbarraum und das Gespräch der Mädels aus der Küche hört.
„Ne, ich muss nicht mit Ticos zusammen wohnen, ich möchte nur mein eigenes Reich haben“, bestätigt Annette meine Vermutung.
„Ich kann Telefonnummern auf dem Campus suchen, ich kenne mich da mittlerweile aus“, biete ich an.
„Ja, gut, dann kann ich die Vermieter anrufen“, schlägt sie vor, schließlich hat sie die besseren Spanischkenntnisse.
„Perfekt! Ich gehe dann mal arbeiten, bis später!“, sie verschwindet wieder in der Küche und ich mache mich auf den Weg zur UCR. Dabei gehe ich einen Umweg um den Campus herum, um mir ein besseres Bild von den verschiedenen Wohnvierteln in Uninähe zu machen.
Die staubige Straße westlich der Uni bin ich bereits auf der Suche nach der Sprachfakultät entlang geschlendert. Vor einigen Tagen war das, als ich mich für den Sprachkurs anmelden wollte. Ich hatte zwar eine kurze Bestätigungsmail erhalten, aber diese besagte, dass die finale Anmeldung vor Ort stattfinden müsse. Kein Kurs - kein Studienplatz!
Der Weg vom Hostel zur UCR war nicht schwierig, ich müsste nur diese zweispurige Straße entlang gehen, hatte mir Juan beim Frühstück erklärt, als er einen fünf Liter Behälter mit Pfannkuchenteig für die ganze Hostelmannschaft anrührte. Kurze Zeit später stand ich dann dem San José gegenüber, wie es in allen Reiseführern beschrieben wird: Laut, groß, dreckig, gefährlich. Ein LKW raste klappernd an mir vorbei, gefolgt von einer Kolonne anderer Irrer. Auf dem Gehweg zwischen einer Mauerwand und der Hauptverkehrsstraße, standen mehrere Männer mittleren Alters. Einer musterte mich und kaute dabei auf einem Stück Holz herum, ein anderer schob einen mit Orangen gefüllten Einkaufswagen vor sich her und schrie mir energisch etwas zu, was ich wegen des Lärms nicht verstand. Die Ampel sprang wieder auf Grün und erneut schwebte uns eine riesige Staubwolke entgegen. Ich schaute verstohlen zu Boden, wurde mit jedem Schritt schneller und ärgerte mich, dass ich nicht den komplizierteren, aber dafür sichereren Weg quer über den Campus genommen hatte. Hinter dieser Mauer müsste er doch sein, hoffte ich immer wieder.
Endlich, nach etwa zweihundert Metern führte eine Straße durch eine Lücke zwischen den Mauern hindurch. Das Tor zu einer anderen Welt. Bäume, Pflanzen und Wiesen säumen die Häuser und Straßen, deren Wegesrand signalgelb markiert ist und Studenten stehen vor farbenfrohen Gebäuden. Gerade noch auf der staubigen Straße, befand ich mich plötzlich im Paradies. Als ich jedoch die Sprachfakultät betrat, stand ich zahllosen, mit dicken, schwarzen Gittern verschlossenen Büros gegenüber. Durch die Stäbe der Zelle 138 sprach ich mit der Insassin, die das Schloss über einen Schalter am Schreibtisch öffnete.
„Guten Morgen“, begrüßte sie mich freudig, als die Tür hinter mir wieder ins Schloss fiel. Es gab keine Türklinke. Wir waren eingesperrt.
„Ich heiße Manuela… Für den Sprachkurs anmelden…“, stellte ich mich vor.
„Ja, sehr gerne, Manuela. Ich habe etwas vorbereitet, nehmen Sie doch Platz“, die Dame, kaum älter als ich, sprach sehr langsam und deutlich, nahm mein gefordertes Passfoto in Empfang und ließ mich einen Bogen Papier unterzeichnen, bevor sie das Bild gekonnt aufklebte. Dann wurde es unangenehmer: Schlappe siebenhundert Dollar kostete mich dieser Teil des Auslandssemesters. Andächtig zückte ich meine Visakarte und das Lesegerät begann zu rechnen. Hoffentlich muss ich nicht nur bezahlen, weil die UCR an mir verdienen will. Ich möchte in den nächsten vier Wochen etwas lernen, denn meine aktuellen Sprachkenntnisse bereiteten mir Sorgen. Eine Vorlesung würde ich so kaum verstehen können, geschweige denn eine Klausur und es bleibt nur noch ein Monat bis zum Kursbeginn.
„Morgen geht es mit dem mündlichen und schriftlichen Sprachtest los, um acht Uhr dreißig“, riss die Frau mich aus meinen Gedanken und lächelte.
„Acht Uhr dreißig?“
„Ja, acht Uhr dreißig, also halb neun“, wiederholte sie erneut langsam und deutlich für mich. Sie drückte den Schalter wieder und das Türschloss öffnete sich nach einem knarrenden Geräusch. Ich war wieder frei.
Erfolgreich suche ich nach Wohnungsangeboten auf dem Campus, überall finde ich Zettel an Wänden und Pfeilern, die Telefonnummern zum Abreißen bereit halten. Leider stehen darauf kaum mehr Informationen als ‚Wohnung zu vermieten, 170 Euro, zentral, nahe der UCR‘, sodass Annette und ich überall anrufen müssen, um mehr zu erfahren. Schließlich verabreden wir uns mit einer gewissen Maria, um uns ihr freies Zimmer anzusehen.
Noch am selben Tag treffen Annette und ich die Vermieterin. Die Nachbarhäuser leuchten babyblau, wachsrot, sonnengelb und mintgrün. Zwischen ihren Mauern schlängeln sich kleine Gänge entlang, durch welche wir auf eine große Grünfläche mit wilden Pflanzen schauen können. An der Wand im Wohnzimmer prangt die gelbe Fahne einer politischen Partei über dem Sofa. Das habe ich schon in mehreren Haushalten Costa Ricas gesehen, denn Politikverdrossenheit ist ein Fremdwort. An Wahltagen tragen die Ticos Schals, Trikots und schwenken Fahnen, wie Fans bei einem gigantischen Fußballspiel. Zwei kleine Hunde wirbeln um unsere Füße, im Hinterhof hängt Wäsche vor einer grünen Wand, deren Putz abblättert und eine Staude Bananen liegt in der Ecke unter einem verrosteten Wasserhahn.
„Meine Mutter hat eine Milchkuhfarm. Dahin fährt man vier Stunden mit dem Auto. Da bin ich jede freie Minute“, erklärt María uns, „deshalb bin ich oft nicht hier. Ihr hättet das Haus dann für euch alleine.“
Viel lieber würde ich mit auf die Farm fahren, denke ich mir, als wir unser potenzielles Zimmer betreten. Die dünne Holztür klemmt und lässt sich weder richtig öffnen noch schließen.
„Das repariert mein Bruder noch“, erklärt sie uns, „ich lasse die Wohnungstür auch immer offen. Die Gegend hier ist sehr sicher.“
Eine offene Haustür und dahinter meine Cam? Das Risiko will ich nicht eingehen. Ganz abgesehen von der Festplatte und den darauf gespeicherten Bildern. Das Wohnviertel macht zwar einen guten Eindruck, aber ich habe ein angeborenes Misstrauen gegen alles Lateinamerikanische. Und zudem gibt es hier keine Waschmaschine.
Trotz unserer direkten Absage, lädt uns Maria noch auf einen Kaffee ein, erzählt aus ihrem Leben und von dem kleinen Welpen, den sie letzte Woche gerettet hat.
In den nächsten Tagen besichtigen wir noch weitere Häuser, unter anderem zwei große Wohngemeinschaften (WGs), in denen aber fast ausschließlich Ausländer wohnen. Meine Sorge, dass dort Englisch gesprochen wird, ist zu groß, deshalb suche ich weiter.
„Ist es egal, wie weit man von den engsten Freunden und der Familie entfernt lebt? San José oder Hamburg, wie viele Kilometer zwischen den Orten und meiner Heimat liegen, spielt keine Rolle. Man ist so oder so weg“, stelle ich fest.
„Na, so kannst du das nicht sagen. In Hamburg kannst du dich im Notfall schnell in den Zug setzen“, beginnt Hannah zu grübeln.
„Ja, stimmt. Aber im Moment jetzt gerade, ist es gleich. Diese bunten Häuser und spanisch sprechenden Menschen, die ganze andere Kultur, hier… Das ist zwar schön, aber… Ich bin froh, dass ich dich habe, Hannah“, stelle ich fest.
„Komm, jetzt is’ aber gut. Du bist ja bald wieder zurück!“
„Nein, nein, so meine ich das nicht. Ich bin ja froh, hier zu sein, aber alles ist so neu. So ungewohnt… Ihr alle da drüben fehlt mir unendlich…“ Stille am anderen Ende der Leitung.
„Was macht die Liebe?“, frage ich, während hinter mir ein gelangweilter Backpacker mit Chipstüte entlang schlurft und ein lockeres ‚Hey!‘ ruft.
„Na, du hast ja auf jeden Fall genug Männer um dich rum, bestimmt hübsche Surfer!“
Was soll ich dazu sagen? Sie redet weiter, „ich weiß nicht, hier gibt es eigentlich nichts Neues. Das übliche eben. Ich hoffe der Typ aus der Bücherei spricht mich endlich mal an.“ Ich weiß, dass Hannah gerade alleine in ihrem Zimmer sitzt, vielleicht auf der Ikea-Couch, vor ihr eine der nach frischen Kirschen duftenden Kerzen und neben ihr ein Berg von Kochzeitschriften. Sie liebt es zu kochen und zaubert immer wieder die köstlichsten Kreationen in größter Perfektion hervor.
Wir wechseln erneut das Thema, denn ich möchte nicht weiter daran erinnert werden, dass ich zwar einen Freund habe, wir aber trotzdem beide alleine sind. Ja, vielleicht sind hier viele interessante Männer, aber was soll ich mit ihnen anfangen, wenn ich doch eine Beziehung habe? Ein wenig erzählen, vielleicht auf einen Berg steigen, aber nicht mehr.
Wir quatschen noch kurz über Dortmund und die permanenten Bauarbeiten neben dem Bahnhof, dann verabschiedet sich Hannah ins Bett. Das Telefonieren nach Deutschland gestaltet sich wie erwartet trotz kostenloser Verbindung über das Internet als schwierig, da neben kurzzeitiger Internetausfälle im Hostel auch die sieben Stunden Zeitverschiebung, mein Spanischkurs und die Arbeit meiner Eltern und Freunde mit meinen möglichen Gesprächszeiten kollidieren.
Überall liegen Pärchen auf den Wiesen, beobachten die Bäume und das Sonnenlicht durch die wehenden Blätter der Baumkronen. Wie gerne würde ich jetzt auch hier mit meinem Freund liegen. Während meines Praktikums haben wir uns zumindest jedes Wochenende gesehen, jetzt gibt es nur noch Telefonate.
Ein zweites Mal betrete ich die Sprachfakultät, diesmal für meine erste Unterrichtsstunde. Sie findet im Raum 412 statt, in der dritten Etage nach deutschen Gegebenheiten. Als ich oben ankomme, sitzt unsere Lehrerin Olma schon vor der weißen Tafel, bereit, uns die spanische Sprache näherzubringen.
„Buenos días muchachas!“, begrüßt sie uns und lacht. Dann teilt sie einen genauen Zeitplan aus, der vorschreibt, welche Grammatikmodule an welchem Tag gelehrt werden. Das Programm ist straff, alle drei Tage folgt eine neue Zeitform, dazwischen stopfen etliche Kleinigkeiten die Lücken, Präpositionen und unregelmäßige Verben wollen auch gelernt werden. Sie reicht uns drei Schülern jeweils ein Buch, beziehungsweise eher einen dicken Stapel gebundener Kopien.
„Jeden Freitag schreiben wir eine Klausur und jeder hält einen Vortrag von etwa zwanzig Minuten“, verkündet sie dann und lacht herzhaft. Schon wieder. Ich kann dieses permanente Lachen nicht deuten.
„Ich bin dreiunddreißig Jahre alt und eine richtige Tica!“, leitet sie die Vorstellungsrunde ein und schiebt dabei alle Zettel beiseite. Passend zu ihrem weiteren Lebenslauf klebt sie Bilder an die Tafel. Sie nimmt ein kleines Comichaus und platziert es oben rechts.
„Ich wohne ganz nah bei meiner Familie, das ist mir sehr wichtig.“
Olma spricht langsam und deutlich, wir verstehen fast alles. Sie ist hervorragend vorbereitet, hat alle Infos auf leuchtend grünem und rosafarbenem Papier gedruckt und eingeschweißt. Sogar verschiedenfarbige Stifte zauberte sie aus ihrer Tasche, um an der Tafel Vokabeln, Grammatik und sonstige Lerneinheiten optisch voneinander zu trennen.
Nachdem wir uns alle etwas holprig vorgestellt haben, spielen wir zum Abschied ein kleines Spiel. Wir werfen uns einen großen Plüschwürfel zu, dessen Zahl uns die Person angibt, in der das Verb auf unseren Zetteln konjugiert werden muss. Wenn der Würfel zu Boden fällt, läuft Olma zu ihm hin und reicht ihn uns - freudestrahlend.
„Zeitverschwendung, total sinnlos!“, raunt mir meine Kurskameradin Fulin zu, während Olma sich wieder umgedreht hat, um den Würfel zu packen. Ich weiß nicht so recht, wie ich über diese Methode denken soll und fühle mich ein bisschen wie im Englischunterricht der siebten Klasse. Trotzdem lockert es auf und zaubert sogar den ehrgeizigen Asiatinnen ein Lächeln auf’s Gesicht.
Mittlerweile hat sich die Sonne anderen Kontinenten zugewendet, in good old Germany dürfte es wieder hell sein, in Costa Rica wird es gerade dunkel, es ist 17:44 Uhr. Ich fühle mich wie in der tiefsten Nacht, eine unendliche Müdigkeit lähmt meinen Körper. Wenn ich jetzt im Schlafsaal bleibe, werde ich den Jetlag niemals überwinden.
Stattdessen gehe ich zurück zum Wohnzimmer und sehe mit einigen Backpackern gemeinsam einen amerikanischen Film. Ich fühle mich im Hostel heimisch und spiele mit dem Gedanken, das ganze halbe Jahr hier zu wohnen und die Wohnungssuche nicht auf später zu verschieben, sondern sie mir ganz zu ersparen.
Die Menschen im Film nuscheln ein unverständliches Englisch, die Untertitel sind auf noch viel verwirrenderem Spanisch, mein Kopf denkt Deutsch. Ich hätte Eiswürfel in den Tee werfen sollen, dann wäre er abgekühlt.
Zum Glück gibt es neben den Wörtern auch Bilder. Astronauten fliegen durch das Weltall, ihre unter Glaskugeln versteckten Köpfe schreien, wollen raus aus dem All und zurück zur Erde. Wollen ihre besten Freunde nicht verlieren. Und während sie diese äußerst unbequeme Situation zu meistern versuchen, schweben Bilder aus ihrer Kindheit umher. Warum welcher Astronaut jetzt in eine andere Richtung schwirrt, wer keinen Sprit mehr in seinem Anzug hat und was mit ihrem zuhause, der Raumfahrtzentrale, passiert ist, kann ich anhand der Bilder nicht nachvollziehen.
„Wir werden uns wiedersehen, das verspreche ich dir“, murmelt einer der weiß umhüllten Menschen zu seiner Geliebten und verschwindet.
Ich kuschele mich in die apfelgrüne Fleecedecke und einer der zwei Backpacker auf dem Sessel beginnt herzhaft zu schnarchen. Ich rutsche zufrieden ein wenig an der Rückenlehne herunter, um es mir noch bequemer zu machen. Wenn mein Freund jetzt noch hier wäre, dann wäre die Welt in Ordnung. Aber dann wäre ich jetzt auch nicht hier.
„Hoffentlich treffen die beiden sich wieder!“, kommentiert der schlanke Amerikaner neben mir das Geschehen und starrt weiter auf den großen Flachbildschirm, „ich bin weit gereist, aber so weit werde ich nie gehen.“
Bruce fährt seit Oktober als Motorrad-Backpacker durch ganz Amerika, von den USA bis ins südliche Argentinien, erzählt er mir nach dem Film. Kein Wort Spanisch hat er vor seiner Abreise beherrscht. Trotzdem lernt er bei seiner Tour nebenbei neue Begriffe und Formulierungen, und bald sogar eine Vergangenheitszeitform, so hofft er.
„Man kann nichts Komplexes erklären, wenn man keine Geschehnisse in der Vergangenheit oder Zukunft beschreiben kann. Wie sage ich dem Zollbeamten, dass ich ‚bezahlt habe‘ und nicht ‚bezahle‘?“
Einmal hatte sein Motorrad einen Schaden, da erkundete er gezwungenermaßen zwei Wochen lang Texas. Das schönste Erlebnis seiner Reise war eine Fahrt unter dem Sternenhimmel Mexikos, später fuhr er sogar durch den Dschungel des riesigen Landes. Er berichtet, dass die Menschen in El Salvador daran arbeiten, ihr Image zu verbessern und Reisende sehr freundlich empfangen. In Honduras hingegen fühlte er sich unsicher. Er träumt davon, mit seinem Rad durch Bolivien zu heizen und in diesem von Tourismus verschonten Gebiet die Kultur zu erkunden. Vorher muss er aber ein Boot finden, dass ihn samt Ausrüstung von Panama nach Kolumbien transportiert, denn es gibt keinen Landweg zwischen den beiden Ländern. Die Schiffsreise ist leider sehr gefährlich, denn viele Kapitäne steuern die kleinen Riesen durch das Meer, ohne sich mit dem gemieteten Boot gut auszukennen. Seine Geschichten nehmen mich mit, wie ein reißender Strom, gegen dessen Strömung man sich nicht wehren mag.
Ich stelle mir weiße Schrift vor, die vor seiner Brust den aktuellen Text in Spanisch abdruckt - bei Filmen in Costa Rica gibt es schließlich immer spanische Untertitel.
Die Länder, von denen er berichtet, kann ich nur schlecht zuordnen und über die Unterschiede und Besonderheiten weiß ich fast nichts. Ob alle diese Länder so bunt, leicht und glücklich sind, wie ich Costa Rica bisher erlebt habe? Ich erinnere mich an meine wilde Fahrt von Hamburg durch Deutschland, gehetzt von einer Behörde zu nächsten, am Ende mit der Trophäe, zwei Stempeln, im Gepäck.
Hier lasse ich mich nicht hetzen und nehme mir die Zeit den Geschichten von Wildfremden zu lauschen. Bruce verabschiedet sich, um sein Motorrad in die sichere Garage zu schieben und ich gehe in den Schlafsaal. Morgen steht wieder der Sprachkurs auf dem Programm und danach heißt es, weiter nach Wohnungen suchen. Als ich mein Hochbett erreiche, werde ich noch in ein Gespräch mit der Backpackerin Rissa verwickelt, die mir von Nicaragua erzählt. Dann schlafe ich endlich ein.
Den Jetlag noch nicht ganz überwunden, schleiche ich um fünf Uhr morgens aus meinem Gemach, vorbei an schlummernden Jugendlichen aus allen Ländern und setze mich zum Spanisch-lernen in den Garten. Kurze Zeit später färben die ersten Sonnenstrahlen meine Haut. Ich habe den Winter verdrängt, den Frühling übersprungen und bin im Sommer gelandet. Manchmal fragt mein Körper, warum es nun plötzlich fünfzehn Grad wärmer ist. Ich lege mich auf den Rücken, beobachte die wedelnden Pflanzen und vergesse die Sprache.
Auch Rissa ist schon wach. Sie gesellt sich zu mir und steckt sich eine Zigarette an. Ursprünglich kommt sie von den Philippinen und lebt seit zwei Jahren in New York. Dort arbeitet sie bei einer großen Motelkette an der Rezeption.
„Ich habe mir San José anders vorgestellt“, bemerkt sie. Wie kann man sich auch einen Ort vorstellen, von dem man nur über die Medien erfahren hat, an dem man selbst aber noch nie war?
„Ich auch“, flüstere ich, schaue in den blauen Himmel, vergesse das Visum und die Sprache. Wir träumen. Zumindest ein paar Minuten, bevor ich zum Sprachkurs aufbreche.
Fast eine ganze Woche bin ich nun in Costa Rica und noch immer hat sich mein Körper nicht daran gewöhnt, dass die Sonne schon um viertel vor sechs aufgeht. Ich schnappe mir meinen Kleiderberg und schleiche aus dem Schlafsaal ins Badezimmer, putze mir schnell die Zähne und trete um kurz vor sieben durch das Gittertor hinaus. Es ist Samstag und zu meiner Verwunderung sind schon viele Menschen auf der Straße, viele Busse und ganz viele knallrote Taxen. Dahinter ragt das weiße Gebäude der Kirche direkt neben der Kreuzung empor.
Die Neugier treibt mich in das Gotteshaus und ich lasse meine Kamera und mich von den leuchtenden Fenstern und der beeindruckenden Helle und Klarheit leiten, als plötzlich ein Priester am Altar steht. Meine Uhr verrät mir, dass es sieben Uhr fünfzehn ist. Gottesdienst zu so einer frühen Morgenstunde an einem Samstag?
Etwa zwanzig Menschen zwischen dreißig und sechzig Jahren bevölkern bereits die Holzbänke im hellen Gebäude und es treten immer mehr Ticos ein. Direkt nach dem ersten Lied und einer kurzen Ansprache beginnt er mit der Predigt.
Kurz lausche ich seinen Worten, dann schleiche ich hinaus, zurück zum Hostel, stecke meine Speicherkarte in den Cardreader und betrachte meine Bilder vom Morgen.
„Ohh, ich mag die Farben! Wo ist das?“, Rissa schaut mir über die Schulter.
„Das ist direkt in der Kirche hier gegenüber, verrückt, oder?“
„Ja, da wäre ich nie rein gegangen“, sagt sie, „aber es scheint sich zu lohnen.“
Rissa hat sich ihren Traum verwirklicht, sie hat lange gespart und sich dann zwei Wochen unbezahlten Urlaub gegönnt, um alleine loszuziehen.
„Ich wollte immer alleine reisen, und jetzt habe ich es getan und ich liebe es!“, erklärte sie mir gestern Abend. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, alleine eine solche Reise zu unternehmen, aber beim Auslandssemester ist man quasi dazu gezwungen. Ich hatte erfolglos versucht, meine Geschwister oder Freunde zu überreden, doch zumindest die ersten beiden Wochen mit mir gemeinsam in den Dschungel zu fliegen, aber entweder fehlte es an Geld oder Zeit.
Es sind erstaunlich viele Mädels alleine unterwegs, stelle ich immer wieder fest. Und keine von ihnen bereut ihre Entscheidung! Die meisten reisen schon länger und genießen es, frei zu entscheiden, welche Menschen und Orte sie morgen kennenlernen möchten. Nie wurde eine bedroht oder hat sich unwohl gefühlt, obwohl wir alle in großen gemischten Schlafsälen übernachten.
„Wir gehen Morgen auf einen Vulkan wandern. Magst du mitkommen?“ spricht mich von hinten eine Frauenstimme an. Es ist bereits später Abend und ich habe den nächsten Tag mit drei Verabredungen durchgeplant. Ich möchte mit meinen Eltern telefonieren, eine Wohnung besichtigen und mit Juan auf den Markt in Zapote gehen, dort soll es tropische Gemüse und Obstsorten geben.
„Nein, ich kann leider nicht“, sage ich ab und die Blondine namens Carly nickt mir verständnisvoll zu, „wenn du doch noch mit magst, wir haben noch einen Platz im Taxi frei.“
Wir erzählen noch kurz, dann verschwinde ich ins Bett. Tief und fest schlafe ich. Kein Schnarchen, kein Rascheln, keine Geräusche, absolute Stille trotz einem mit zwölf Menschen besetzten Schlafsaal.
Um halb fünf werde ich wach und starre an die Holzdielen über mir. Draußen ist es noch stockfinster. Stille. So früh kann ich unmöglich aus dem Bett klettern, ich suche mein Handy und die App der deutschen Tageszeitung verrät mir, dass es in Deutschland schon Mittag ist. Ich stöbere in weltweitem Wissen.
Meine Gedanken schweifen immer wieder ab, fliegen durch das Fenster hinaus in den Garten, hinter die Mauern des Hostels. Costa Rica ist Natur, und ich habe davon, abgesehen vom Hostelgarten und der Universidad de Costa Rica (UCR), noch nichts gesehen. Eine Stadt ist eine Stadt, da gibt es Beton und Stein anstelle von Dschungel, Meer und Vulkanen. Vielleicht ist San José deshalb so unbeliebt, weil man etwas anderes vom Naturparadies Costa Rica erwartet. Ich erinnere mich an den Vorschlag der Backpacker und werde hellwach. Ich könnte heute einen aktiven Vulkan besteigen!
Start ist erst in zwei Stunden, genügend Zeit um meine Verabredungen zu verschieben. Gesagt getan, zwei Stunden später schultern wir unsere Rucksäcke.
Mit dem Taxi geht es zum Bus, dann weiter nach Alajuela, wo wir eineinhalb Stunden auf den nächsten Bus warten, der uns dann zum Nationalpark des Vulkans Poás bringt. Im Bus treffe ich eine Gruppe von deutschen Freiwilligen, die ein soziales Jahr in Costa Rica absolvieren. Aufgeregt schaue ich in die Gesichter der Jugendlichen, kann Julius unter ihnen jedoch nicht entdecken. Trotzdem, wir diskutieren über Visumangelegenheiten, von denen auch die anderen ein Lied singen können.
Meine Sitznachbarin Susi aus England, die ebenfalls aus dem Hostel mitkam, wippt zum Takt der Musik, die aus ihren knallroten Kopfhörern dringt. Ihre Einstellung erinnert mich stark an mein erstes Gespräch fernab der Heimat: „Ich will meine Zeit nicht mit Studieren verschwenden, sondern lieber Spass haben. Am Ende haben doch eh alle den gleichen Job“, stellte sie eben noch fest und drehte an ihren etlichen bunten Armbändern. Da ich nicht weiter auf ihre Aussage eingegangen war, steckt sie sich Kopfhörer ins Ohr, lässt sich warmen Wind von draußen ins Gesicht wehen und schaut seitdem den vorbei huschenden Büschen nach. Ich kann diese Denkweise nicht nachvollziehen, ohne mein Studium wäre ich gar nicht hier. Susi schlägt sich mit ihrem Englisch und ohne Spanisch durch und scheint damit glücklich zu sein.
Nach etwa vier Stunden Tour erreichen wir unser Ziel, verlassen erleichtert die unbequemen Sitze und fiebern dem langen Fußmarsch entgegen.
Wie weit wir wohl bis zum Gipfel laufen müssen? Als wir den Bus verlassen, ist es angenehm kühl, aber längst nicht kalt, wie uns eine Hostelmitarbeiterin gestern angekündigt hatte.
Mit Wanderschuhen ausgestattet, spazieren wir den breiten Asphaltweg hinauf zum Vulkan, werfen einen Blick in den Krater, wollen dann endlich wandern und betreten den Wald, der uns höher führen soll.
Aber es geht nicht viel höher, insgesamt wandern wir eine Stunde durch einen dunklen Wald, dann sind wir wieder am Ausgangsort. Ein relativ unspektakulärer Rundweg, aber mein erstes Mal Natur in Lateinamerika.
Wir setzen uns vor den Vulkan auf die dicken Steine der Aussichtsplattform, wickeln uns in Schals und Jacken ein, um Nieselregen und Wind zu trotzen und warten, dass der Bus wieder abfährt. Nebelschwaden sind aufgezogen und verschmelzen mit der Rauchwolke, die vor uns aufsteigt. Zwischendurch zeigt sich der Krater kurz, dann verschwindet er in der Leere.
Bruce blättert in seinem Notizbuch und präsentiert eine mit schwarzem Filzstift skizzierte Karte, ‚nicht maßstabsgetreu‘ hat er schräg darunter gekritzelt.
„Das wichtigste, was ich jemals verloren habe, war mein kleiner Kompass am Motorrad. Ich habe jemanden gestreift und dann muss er wohl herunter gefallen sein. Ich habe es erst später am Tag bemerkt“, berichtet er, während sein Blick dort verharrt, wo vorhin noch der Abgrund zu sehen gewesen war.
„Und einmal hätte ich fast mein Motorrad verloren“, nun schaut er uns eindringlich an, „ich habe es in Mexiko City abgestellt und mir den Parkplatz nicht richtig gemerkt. Die Stadt ist so riesig, als ich im Dunkeln weiter fahren wollte, erkannte ich nichts wieder. Jede Straßenecke sah gleich aus. Das war wirklich unheimlich!“
„This is so L.A.!“, stöhnt Carly aus Kalifornien und beäugt eine Gruppe von Selfie schießenden Landsleuten. Noch ein Foto, mit Daumen oben, mit Nebelvulkan im Hintergrund, mit Grimassen, alleine, zu zweit, seitlich…
„Amerikaner sind immer so peinlich!“
Im Bus auf der Rückfahrt unterhalte ich mich kurz mit meiner Sitznachbarin aus Venezuela auf Spanisch. Als ich aussteigen muss, lobt sie mich tatsächlich für meine guten Sprachkenntnisse. Das macht mich stolz, meine Anstrengungen sind nicht umsonst.
Erst gegen Nachmittag erreichen wir das Hostel, meine Eltern werden schon tief und fest schlafen, Telefonieren kommt erst morgen wieder in Frage. Ich bin erschöpft und mein Kopf brummt. Zum Glück sind wir heute bei einer Sprache geblieben, fast kein Spanisch, kein Französisch. Von Franzosen halte ich mich nach wie vor fern, sonst vermischen sich die Sprachen weiter. Mit Amerikanern spreche ich schon jetzt Sprançais und die Ticos müssen Denglisch ertragen.
„Was machst du da? Ich versteh dich nicht! Kannst du nicht EINE Sprache sprechen?“, bemerkt Juan genervt beim Abendessen.
„Ich merk’s ja nicht mal, verstehe ja alles“, antworte ich, diesmal komplett auf Spanisch.
Hier funktioniert das Bankensystem anders. Ich stehe vor einem kleinen verrosteten Transporter, der direkt vor dem Verwaltungsgebäude der UCR geparkt ist und auf dessen Seiten das Logo der Banco de Costa Rica prangt. Eine fahrende Bankfiliale. Ich trete vor den Schalter und schräg hinter mir steht plötzlich ein komplett ausgerüsteter Polizist, mit Schlagstock und Pistole, bereit den kleinen Transporter und dessen Inhalt zu beschützen. Er lächelt gelassen, wirklich kein Grund zur Aufregung. Lediglich ein paar UCR Mitarbeiter schlendern am Wagen vorbei, wir befinden uns mitten auf dem Campus, was soll hier schon passieren?
Eine Plexiglasscheibe trennt den korrekt gekleideten Bankmitarbeiter von mir, den ich durch Lautsprecher und Mikrofon hören kann. Hierfür wurde ein Loch in die Metallwand gebohrt.
„Ja?“, murmelt er viel zu leise ins Mikro, sein Spanisch dadurch schlecht verständlich. Ich wünschte, er würde sich zumindest mehr Mühe zu einer deutlicheren Aussprache geben, ich sehe doch wirklich europäisch aus.
„Ich möchte… Geld auf Konto… legen!“, ich reiche ihm den Zettel mit Name und Kontonummer des Notars und hoffe, dass der in Hemd und Schlips steckende Mitarbeiter das Geld auf das richtige Konto einzahlt, mich nicht betrügt und ich mich bei der richtigen Bank befinde.
„Wie viel?“, besonders freundlich ist er ja nicht.
„50 Dollar.“ Er zückt seinen Taschenrechner und ermittelt den tagesaktuellen Wechselkurs zu Colones. Von oben herab schauend, nimmt er mein Geld durch eine kleine Luke in Empfang und beginnt dann in aller Ruhe damit, auf seinen Computer einzutippen.
Wie ich in Costa Rica Geld bekomme, diese Frage hat mich in Deutschland lange beschäftigt. Das ganze Geldsystem ist eine Wissenschaft für sich.
Dollarscheine: Die Landeswährung ist Colones, die man in fast allen Banken wechseln lassen kann. Trotzdem kann man in Costa Rica, wie auch im Kongo, mit Amerikanischen Dollars bezahlen. Deshalb habe ich bereits in Deutschland ein paar Euros in Dollar gewechselt. Besonders sollte man darauf achten, um welche Dollarscheine es sich handelt. In Kinshasa in Afrika wurden zum Beispiel nur Scheine angenommen, die höchstens fünf Jahre alt waren. Außerdem werden keine Scheine angenommen, die größer als fünfzig Dollar sind. Bei manchen Banken muss man für das Geldwechseln eine Gebühr entrichten. Zudem werden zum Umrechnen von Euro in Dollar unterschiedliche Kurse verwendet. Der Kurs für die Travellerschecks war zum Beispiel deutlich günstiger als der für Dollarscheine.
Travellerschecks: Diese antiquierten Papierfetzen hatte ich bisher noch nie benutzt und genau das war auch der Grund, warum ich die Damen in der Sparkasse mit meinem Anliegen ins Schwitzen brachte. Ich wollte noch einmal mit richtigen Travellerschecks zahlen, bevor sie komplett von Kreditkarten ersetzt werden.
„Jetzt muss ich mich erst einmal wieder an mein Passwort erinnern… aber das haben wir gleich…“, bemerkte die Mitarbeiterin, die sich im Team mit einer Kollegin um mein Anliegen kümmerte. Vor ihrem Schreibtisch Platz genommen, musste ich Formulare ausfüllen und jeden Scheck einzeln mit meiner Unterschrift versehen. Die Schecks sind durchnummeriert, werden samt Namen und Nummer des Personalausweises in eine Liste eingetragen und können dann in jedem Land unter Vorlage des Personalausweises und einer Unterschrift in Dollars zurück getauscht werden.
„Die Nummern schreiben Sie am besten auf und haken immer ab, welche Sie ausgegeben haben“, raten die beiden mir noch. Falls man die Schecks verlieren sollte, kann man sie unter Angabe dieser Nummer sperren lassen.
Geld überweisen: Im nächsten Schritt habe ich mein TAN Verfahren zum Überweisen umgestellt, sodass ich nun keine SMS mehr mit einer TAN vor jeder Überweisung auf mein Handy gesendet bekomme, sondern mit einem Gerät meine eigene TAN Nummer generieren kann. Man steckt die Karte in das Lesegerät, scannt einen Code vom Bildschirm ab und erhält seine TAN, ganz GPS- und Funknetz-los. Allerdings ist man immer auf dieses Gerät angewiesen.
Geld abheben: Nun habe ich erfolgreich Geld getauscht und in anderes Papier umgewechselt. Wie bekomme ich noch mehr Geld vor Ort? Bares kann man zum einen mit der EC Karte bekommen, das kostet aber Gebühren. Zum anderen kann man mit der VISA Karte Geld abheben, manche Automaten spucken sogar kostenlos Geld aus. Na gut, es wird irgendwo auf einem Blatt Papier eine Zahl vermerkt, aber man bekommt Geld aus dem Nichts, hervorragend!
Ich erhalte einen gelben Kassenbon von dem Mitarbeiter der fahrenden Bank, natürlich mit Stempel und Unterschrift, und es scheint tatsächlich so, als ob ich nun alle nötigen Visumsunterlagen in meiner Mappe hätte. Nein, die Überbeglaubigung vom Liquiditätsnachweis durch den Notar fehlt noch.
„Ich vermisse dich“, teilt mir mein Handy mit, während ich im Nebenraum der Hostelküche auf der weiß lackierten Holzbank sitze und ein Stück Pfannkuchen mit Ahornsirup in mich hinein schaufele. Jeden Morgen lese ich beim Frühstück meine Nachrichten, die mir meine Freunde aus Deutschland in den letzten Stunden geschickt haben. Durch die Zeitverschiebung sind das manchmal Romane.
Zu einer kurzen Message hat mir Hannah ein Foto ihrer Lasagne geschickt, die wir immer gemeinsam gekocht haben. Vielleicht hat sie die alleine gegessen, hoffentlich hat sie sich aber Freunde eingeladen… Ich seufze. Mir wird das erste Mal bewusst, dass nicht nur ich, sondern auch die Daheim gebliebenen Konsequenzen meiner Entscheidung tragen.
Während ich in meinem virtuellen Deutschland versinke, gesellt sich ein schlanker älterer Herr zu mir. In der Hand trägt er einen Teller mit Juans Spezial-Pancakes und Ananas, den er sachte abstellt.
„Wo kommst du her?“ fragt er mich und verstreicht die Butter auf dem heißen Teigfladen.
„Aus Deutschland. Ich bin Austauschstudentin. Und sie? Aus Nordamerika?“, antworte ich und lege das Handy zu Seite.
„Nein, nein“, lacht Ingvar Henricson, „das ist meine letzte lange Reise. Bin seit drei Monaten unterwegs.“ Der vierundsechzigjährige Schwede ist Weltreisender und hat Bücher über das Segeln verfasst.
„Noch einen Monat bin ich unterwegs, dann gehe ich nach Hause“, er steckt seine Gabel in ein Stück Ananas, „auf meinen Reisen habe ich sechs Sprachen gelernt, darunter auch Chinesisch, Russisch, afrikanische Sprachen, Spanisch und Französisch. Aber im Alter wird es immer schwieriger zu lernen, deshalb finde ich es hervorragend, dass du so viel reist, um Sprachen zu lernen.“
„Ich werfe jetzt schon alle Sprachen durcheinander, besonders Spanisch und Französisch, noch eine wäre zu viel“, gestehe ich ihm beeindruckt auf Englisch.
Alle meinen Sorgen sind verflogen, Ablenkung hilft immer. Das ist es, was ich in Costa Rica suche, Menschen treffen und von ihren Lebenserfahrungen lernen.
„Spanisch klingt besser als Französisch“, stellt er fest.
„Hast du eigentlich Kinder?“, frage ich. Gut, dass das englische ‚Sie‘ und ‚Du‘ identisch sind, im Deutschen oder Spanischen fände ich es merkwürdig, ihn zu duzen.
„Ja, ich habe drei Kinder, das erste bekam ich, als ich in deinem Alter war. Da hörte ich auf zu reisen und nahm meine Leidenschaft erst später wieder auf“, er schaut mich durch seine Brille an. Als einer der wenigen im Hostel trägt er ein Hemd, die meisten tragen bequeme T-Shirts.
„Als ich sechzehn Jahre alt war, bin ich mit meinem Vater von Berlin hoch nach Schweden gefahren. Ich hatte keinen Führerschein, aber trotzdem wechselten wir uns ab und fuhren die Strecke in einem durch. Abenteuerlust hat das in mir geweckt! Deshalb liebe ich es auch besonders, über die Abenteuer anderer zu lesen.“
Wir sprechen über Städte, über Afrika und Lateinamerika und irgendwie kennt er zu jeder Gegebenheit und jedem Ort eine Geschichte. Ich bin froh, vor einiger Zeit die geografischen Positionen vieler Länder der Erde gelernt zu haben und zumindest grob seinen Reisen folgen zu können. Als ein Backpacker aus Washington sich zu uns gesellt, berichtet Ingvar davon, wie er einmal mit dem Auto durch Boston fuhr.
Die meisten Hostelbesucher verbringen Ewigkeiten damit, ihre weiteren Routen zu planen. Kaum jemand geht bis in die Nacht hinein feiern, die meisten freuen sich darüber, zusammen auf der Couch zu sitzen und zu reden, zu relaxen, sich über die Gegend und ihre bisherigen Erlebnisse auszutauschen. Gestern Abend habe ich mich auf Französisch, Englisch, Deutsch und Spanisch unterhalten. Eine faszinierende Erfahrung, wenn man sich mit jedem Landsmann verständigen kann.
„Jeden Tag wird nicht nur mein Spanisch, sondern auch mein Englisch besser. Daran habe ich nie gedacht“, bemerke ich und bohre den Kopfhörer meines Headsets noch weiter ins Ohr.
„Aha, aber hat sich der ganze Aufwand dafür denn gelohnt? Das war ja schon viel“, entgegnet mir Hannah.
„Hannah, ich habe schon so viel gelernt, das kann man nicht beschreiben! Es kommt mir vor, als ob ich schon eine Ewigkeit hier wäre. Dabei sind es gerade mal zwei Wochen. Alles ist neu!“, ich kann gar nicht stoppen, ich bin begeistert. Ich rutsche ein Stück auf der Couch zur Seite, denn jemand möchte sich ebenfalls setzen. Ich versuche leiser zu sprechen.
„Und bist du noch immer so aufgeregt und machst dir so viele Gedanken, dass etwas nicht klappt?“, fragt mich Hannah, die sehr genau weiß, dass ich vor meiner Abreise öfter fast aufgegeben und die ganzen Unterlagen am liebsten in die Ecke geworfen hätte.
„Nein, mir ist jetzt irgendwie alles egal. Ich bin hier und lerne Spanisch, das war mein Ziel“, stelle ich fest und drehe mit den Finger der rechten Hand die Haare meines Pferdeschwanzes um den Zeigefinger, bis er sich zu einer Locke verformt hat, „seit ich in Costa Rica gelandet bin, bin ich viel entspannter. Das sind auch alles nur Menschen. Und die haben die gleichen Sorgen und Ängste, die gleichen Probleme, Hoffnungen und Wünsche.“
Als ich Hannah das erste Mal von meiner Zusage erzählt hatte, war sie zum einen sehr glücklich, zum anderen aber sehr nachdenklich gewesen.
„Das ist gefährlich!“, hatte sie ängstlich festgestellt. Sie dachte, dass Costa Rica eine andere Welt darstellt, in die man sich als Frau alleine niemals, niemals wagen sollte. Eine Männerdomäne bestimmt von Machos. Ich hatte das auch gedacht und wollte es trotzdem hinterfragen.
Ein Rotkehlchen fliegt vor Hannahs Fenster vorbei, als sie mir vom Schnee im Garten ihrer Eltern erzählt. Wer hätte geahnt, dass Hannah in der Natur in Deutschland und ich in einer staubigen Stadt in Costa Rica sitze?
„Bald werde ich in meinem Zimmer wohnen, kann das Licht ein- und ausschalten, wann ich will und Musik hören, ohne mich an ein Kabel binden zu müssen. Bald ziehe ich zu María. Großartig, oder?“, schwärme ich von meinem zukünftigen Zuhause. Die Wohnungssuche mit Annette hatte sich sehr schwierig gestaltet, doch zum Glück habe ich durch eine Freundin von jemandem erfahren, der gerade ein Zimmer frei hat. Dann verabschieden wir uns, Hannah geht schlafen und für mich geht es los.
„Wie soll der ganze Inhalt meines Bettkastens in meinen Koffer passen?“, frage ich Juan, der mir beim Packen zusieht, während er das Nachbarbett bezieht. Er zupft das weiße Laken auf der Schaumstoffmatratze zurecht und setzt sich dann.
„Schenk mir alles, was du nicht brauchst“, grinst er. Recht hat er, denn ich besitze bestimmt fünf Mal so viel wie er. Mir wird das erste Mal richtig bewusst, wie reich ich bin. Wir beziehen mein Bett gemeinsam neu, dann ziehe ich die graue Eingangsgittertür hinter uns zu und lasse sie klackend einrasten. Ich bin raus, meine Reise geht weiter.
Juan läuft vor, ruft mir eines der roten Taxis heran und erklärt dem Fahrer auf Spanisch den Weg zu Marías Haus.
„Du kommst aber bald wieder vorbei, versprochen?“, verabschiedet er mich, drückt mich noch einmal und schon setzt sich die Limousine in Bewegung. Herrlich, nun wird alles besser. Tschüss Hostel Urbano! Mein eigenes Zimmer und mein richtiges eigenes Heim. Endlich ankommen und mich endgültig richtig wohl fühlen!
Ich freue mich riesig, doch dann fährt der Fahrer in die falsche Richtung.