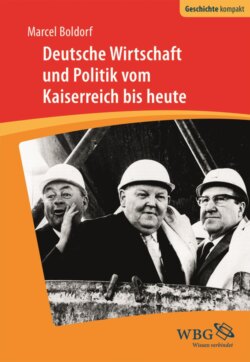Читать книгу Deutsche Wirtschaft und Politik - Marcel Boldorf - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Reorganisation durch Kriegswirtschaft
ОглавлениеMit der Notwendigkeit, die Wirtschaft auf die Anforderungen des Krieges umzustellen, sah sich die Staatspolitik einer völlig neuen Aufgabe gegenübergestellt. Insofern könnte man annehmen, dass 1914 die Stunde der Politik schlug und der Staat energisch in den Wirtschaftsprozess eingriff, um die Wirtschaft auf Kriegskurs zu bringen. Jedoch waren den regulierenden Eingriffen erhebliche Grenzen gesetzt, weil es an konzeptionellen Vorüberlegungen für eine Kriegswirtschaftsplanung weitgehend fehlte.
Mangelhafte Mobilisierung
Noch bei Kriegsausbruch rechneten weder die Oberste Heeresleitung (OHL) noch die Industriellen damit, dass eine besondere wirtschaftliche Mobilisierung notwendig sei. Nach Ansicht des Generals Alfred von Schlieffen (1833–1913), dessen Vorkriegsplanung den schnellen Sieg gegen Frankreich mittels eines Angriffs über Belgien vorsah, wäre ein langwieriger Krieg ohnehin nicht führbar, weil der moderne Staat auf den ungebrochenen Fortgang von Handel und Industrie angewiesen sei. Die Annahme, dass modernes Wirtschaften nicht mit dem Krieg zu vereinbaren sei, verstellte auch den Blick auf die mögliche Planung der kriegswirtschaftlichen Mobilmachung. Obgleich die Militärs durchaus Überlegungen zur Intensivierung der Rüstungsproduktion anstellten, wiegten sie sich in der Hoffnung, dass man sich auf die staatlichen Rüstungsfirmen verlassen könne und nur wenige größere private Rüstungsunternehmen wie z.B. Krupp einbeziehen müsse. Die Industriellen rechneten ihrerseits nicht mit einer umfassenden Rüstungsproduktion für die Zwecke des Heeres. Überhaupt kam ihnen der Krieg ungelegen, weil er den Außenhandel störte, an dem sie unter anderem durch das Flottenbauprogramm in lukrativer Weise partizipierten.
Prekäre Rohstofflage
Walther Rathenau (1867–1922), Präsident der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft (AEG), und der leitende Beamte Wichard von Moellendorf (1881–1937) gehörten zu den wenigen, die die prekäre Rohstofflage realistisch einschätzten, denn Deutschland war 1913 auf den Import von rund 40 Prozent seiner Rohstoffe angewiesen. Mit Erfolg bemühten sie sich in den ersten beiden Kriegswochen um die Einrichtung einer Kriegsrohstoffabteilung im Preußischen Kriegsministerium. Damit wurde einer Landesbehörde die nationale Aufgabe der Rohstoffbewirtschaftung übertragen. Zur Durchführung der Lenkungsaufgaben bildeten sich sogenannte Kriegsrohstoffgesellschaften, die meist als Aktiengesellschaften organisiert waren. In ihren Aufsichtsräten saßen vor allem Ministerialbeamte, während ihre Vorstände aus den kriegswichtigen Großunternehmen stammten. Die Rohstofflenkung bildete den Ausgangspunkt für eine kriegswirtschaftliche Ordnungspolitik, die sich anfangs zögerlich entwickelte. Neben der Importaktivierung bzw. -substitution gehörte zu ihren Aufgaben die Erfüllung folgender Hauptanliegen: die Anregung der Rüstungsgüterproduktion, die im Verlauf des Kriegs immer stärker wachsen sollte, die Schließung der aufgrund der Mobilisierung entstehenden Lücken auf dem Arbeitsmarkt, die Finanzierung des wachsenden Staatsverbrauchs.
Stichwort
Burgfrieden und Kriegsfinanzierung
Der seit dem Mittelalter gängige Begriff, nach dem in einer vom Feind belagerten Burg keine Fehde ausgetragen werden darf, wurde nach Kriegsbeginn vom deutschen Kaiser Wilhelm II. (1859–1941) bildlich in den Sprachgebrauch übertragen: „Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur Deutsche.“ In der politischen Praxis meinte die Burgfriedenspolitik insbesondere die Einbeziehung der Sozialdemokratie in den nationalen Konsens. Wirtschaftlich bereitete der Burgfrieden den Weg für die Kriegsfinanzierung, die von der staatlichen Warte aus ein vordringliches Problem war. Die Frage der Fortführung der Burgfriedenspolitik ging in die Diskussion um die Zustimmung zur Kriegsführung der kaiserlichen Regierung über. Kriegsgegner wie die Spartakusgruppe um Karl Liebknecht (1871–1919) versagten im Parlament ihre Zustimmung zu den Kriegsanleihen des Staates.
Wege der Kriegsfinanzierung
Die Einsicht in die Priorität der Kriegsfinanzierung setzte sich bei den politisch Handelnden und der Heeresleitung schnell durch, denn schon vor Kriegsbeginn verzeichnete man im Zuge der forcierten Aufrüstung eine Explosion der staatlichen Ausgaben. Die Kostensteigerung betraf nicht nur die Rüstung, sondern allgemein den Ausbau der Verwaltungstätigkeit. Dem Staat standen drei Finanzierungswege offen: a) durch Besteuerung, indem man den Bürgern die Kosten direkt aufbürdete. Da dieser Weg die Kaufkraft der Bevölkerung bei zu erwartender Güterverknappung verringerte, sahen ihn die zeitgenössischen Ökonomen als beste Lösung an. Allerdings waren die zu erwartenden Beträge gering, denn Reichssteuern wurden vor 1914 vor allem über den Verbrauch von Genussmitteln wie Kaffee, Alkohol oder Tabak eingenommen. Das Aufkommen ging wegen der Kriegsblockade extrem zurück. Dagegen war das Einkommensteuersystem nur wenig entwickelt und die Erhebung den Einzelstaaten vorbehalten. Die Kriegsregierungen wagten es nicht, eine Reichseinkommenssteuer einzuführen. Die im Dezember 1915 angekündigte Kriegsgewinnsteuer wurde erst ab Juni 1916 erhoben. Erst im April 1917 führte die Reichsregierung eine Verbrauchssteuer auf Kohlen ein, bezahlte den Großteil der Zeche aber selbst, weil das Reich der Hauptabnehmer von Industriewaren und Kriegsgerät war. b) Völlig unattraktiv war von staatlicher Warte aus der Zugriff auf die Goldreserven. Zwar musste auf den Zerfall des Goldstandards kaum mehr Rücksicht genommen werden, denn die Deckung der staatlichen Geldemission durch Edelmetallreserven war bereits vor dem Krieg ausgehöhlt worden. Der Verkauf des Goldes hätte den Staat aber unwiderruflich seiner letzten Reserven beraubt. c) Es blieb die Finanzierung über Anleihen. Anders als für die europäischen Kriegsgegner schieden Auslandsanleihen für das Reich aus: Im Gegenteil gewährte Deutschland sogar Kredite an Österreich. Die inländische Anleihepolitik begann in Deutschland schon vor dem Krieg, als die Reichsschuld zwischen 1900 und 1913 von 2,3 auf 5 Milliarden Mark anstieg. Die Kriegsanleihen wurden durch den Aufruf an die Besitzenden mobilisiert, dem Staat ihre Ersparnisse gegen Zertifikate zur Verfügung zu stellen. Diese befriedigten das Gewinninteresse der Sparer, denn der Staat versprach, die Summe nach Kriegsende mit Zinsen zurückzuzahlen. Darüber hinaus ließ sich der Ankauf von Staatsanleihen als patriotischer Akt verkaufen. Von Regierungsseite bestand die Zuversicht, nach gewonnenem Krieg dem Gegner die zurückzuzahlenden Summen aufzubürden.
Abb.1 Das 1. bayerische schwere Reiter-Regiment marschiert am 4. August 1914 ins Feld.
Kriegsanleihen
Während des Ersten Weltkrieges wurden neun Anleihen aufgelegt, die die Regierung halbjährlich im Frühjahr und Herbst im Reichstag verabschieden ließ, erstmals im September 1914. Bei dieser Prozedur gerieten die Sozialdemokraten wegen ihrer Zustimmung zur Burgfriedenspolitik stark in Bedrängnis, weil sie der Kriegsführung dadurch immer wieder zustimmten. Die innere Zerreißprobe führte 1917 zur Spaltung und zur Bildung der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (USPD). Die Kriegsfinanzierung stellte sich als Kristallisationspunkt dar, an dem sich Zustimmung und Ablehnung zur politischen Führung manifestierten. Der versprengten politischen Opposition stand eine breitere patriotische Front gegenüber. Der Staatssekretär im Reichsschatzamt Karl Helfferich (1872–1924), der als Verantwortlicher für die Finanzierungsweise anzusehen war, stellte eine Refinanzierung nach siegreichem Kriegsverlauf in Aussicht. Er war zutiefst davon überzeugt, dass den Feinden nach gewonnenem Krieg die Rechnung vorgelegt werden könne. Selbst noch 1917 drückten Experten wie der Münchner Ökonomieprofessor Edgar Jaffé (1866–1921) die Erwartung aus, dass England in Bälde zur Begleichung der Hälfte der deutschen Kriegsschuld herangezogen werden könne. Diese Logik entsprach derjenigen der Gegenseite, doch mit dem entscheidenden Unterschied, dass die siegreichen Alliierten sie im Versailler Vertrag mit der Auferlegung hoher Reparationen in die Realität umzusetzen vermochten.
Angesichts der falschen Einschätzung des Kriegsverlaufs und der zunehmenden Bedeutung der Privatindustrie für die Rüstung stellte sich für die Reichsregierung das Problem der Einbindung dieser Firmen in die staatliche Bürokratie. Allein für die Rohstoffverteilung war mit Einführung der Kriegsgesellschaften eine vorerst zufriedenstellende Lösung gefunden worden, von der allerdings die Großindustrie am meisten zu profitieren wusste. Rathenau nahm als Hauptinitiator der Rohstoffbewirtschaftung in der Frage der Unternehmensreglementierung eine wirtschaftsliberale Haltung ein. Er betrachtete es als „eine Selbstverständlichkeit, dass Handel und Industrie ein wohlerworbenes Recht auf Verdienen und möglichst freie Bewegung“ hätten.
Als das Kriegsministerium angesichts der Munitionskrise vom November 1914 das industrielle Geschäftsgebaren einer Prüfung unterzog, musste es feststellen, dass die Privatwirtschaft von ihren Freiheiten ausgiebig Gebrauch machte. Zwar hielten die Industriellen patriotische Reden, bekundeten ihre vaterländische Gesinnung und forderten Annexionen, doch folgten sie in ihrer Unternehmensleitung strikt der immanenten Logik der Marktwirtschaft. Sie handelten zu ihrem Vorteil, der sich nicht unbedingt mit der kriegswirtschaftlichen Rationalität deckte. Die Industriekapitäne waren kaum geneigt, die Produktionskapazitäten ihrer Fabriken zu erweitern, um in ihrer Sichtweise unrentable Mengen zu produzieren. Trotz des Krieges dachten sie strategisch in langfristigen Perspektiven. Über die Kriegsgesellschaften versuchten sie, in vielen Sektoren eine Monopolstellung aufzubauen. Im Wettbewerb um Rüstungsaufträge waren sie nicht gewillt, alternativen Anbietern Marktanteile zu überlassen, auch wenn diese die Aufträge der militärischen Beschaffungsstellen ebenso gut erfüllen konnten.
Stichwort
Kriegsgesellschaften
Zur Durchführung der Rohstoffbewirtschaftung wurden die Rüstungsunternehmen nach Branchen zu Kriegsgesellschaften gruppiert, die bis Herbst 1916 der Kriegsrohstoffabteilung des preußischen Kriegsministeriums unterstanden, z.B. die Kriegschemikalien AG, Kriegsmetall AG, Kriegswollbedarf AG (September 1914), Kammwoll AG (Oktober 1914) oder die Kriegsleder AG (November 1914). Als Aktiengesellschaften waren sie private Unternehmen, die die öffentliche Aufgabe der Kontrolle der Rohstoffverbraucher übernahmen. Ihre Tätigkeit deckte sich mit derjenigen der Syndikate und sie fügten sich auch in deren Organisationsstrukturen ein. Alle großen Firmen einer Branche übernahmen Anteile an der jeweiligen Kriegsgesellschaft, weil sie ansonsten einen Ausschluss aus der Rohstoffbelieferung befürchteten. Kleinere und mittlere Unternehmen wurden an den Rand gedrängt und bezogen ihr Material häufig über Großunternehmen. Die Kriegsgesellschaften glichen Rohstoffangebot und -nachfrage zum amtlich festgelegten Preis aus, doch belieferten sie ihre Aktionäre häufig bevorzugt. Bei Kriegsende zählte man 200 Kriegsgesellschaften mit ca. 33.000 Beschäftigten.
Aufgrund der staatlichen und privatwirtschaftlichen Beteiligung wurde die Organisation der Kriegsgesellschaften als gemein- oder gemischtwirtschaftlich bezeichnet. Die zeitgenössischen Akteure verbanden damit kein neues ordnungspolitisches Modell, sondern sahen ihre Existenz auf die Zeit des Krieges beschränkt. Die Unternehmensform schuf eine Brücke zwischen kapitalistischer Privatwirtschaft und staatlichem Interventionismus. Die Industrie blieb skeptisch, weil sich ihre unternehmerischen Ziele auch über die Syndikate erreichen ließen, ohne dem Staat Zugriffsmöglichkeiten zu eröffnen. Obwohl die Kriegsgesellschaften nicht bewusst als Alternative zur privaten Wirtschaft gedacht waren, dienten sie in der Folge als Modell für die Diskussion einer korporativen Wirtschaftsverfassung.
Geschäftsgebaren der Industriellen
Im Sinne des Syndikatsgedankens nutzte beispielsweise die Eisen- und Stahlindustrie ihre Schlüsselstellung aus, um beim Staat hohe Preise zu fordern. Mittels der Monopolisierung des Rohstoffaufkaufs traten sie wie andere großindustrielle Unternehmen als Lieferanten für kleinere Firmen auf, unter Wahrung ihres Vorteils bei der Preisgestaltung. Die Bildung von Preissyndikaten zur Erzielung von Höchstpreisen war auch ein Teil der industriellen Exportpolitik. Zu Beginn des Kriegs wusste die Industrielobby bereits den Erlass von Ausfuhrbeschränkungen in neutrale Länder zu verhindern. Die Industriellen erklärten, dass ihre Syndikate dafür sorgten, dass die Produktion nicht in die Hand des Kriegsgegners falle. Diese Kontrolle erwies sich als Illusion, denn deutsches Eisen gelangte über die Neutralen nach Frankreich und Italien. In manchen Fällen zogen Stahlindustrielle über das Jahr 1916 hinweg den Außenhandel gegenüber dem Binnenabsatz vor, weil die Nachfrage der neutralen Länder wegen der Einstellung der britischen Lieferungen gestiegen war.
Die Effekte der Kartellbildung spitzten sich im Krieg zu. Die Bergbauunternehmen, die sich schon seit 1893 nicht mehr im Wettbewerb befanden, gingen in einem die gesamte Kohlenwirtschaft umfassenden Kartell auf. Zwar behielten sie rechtlich ihren Unternehmensstatus, gaben aber ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit auf. Angesichts dieser Vermachtung konnten sie wie andere kriegswichtige Industriezweige ihre Forderungen beim Kriegsministerium ohne Zurückhaltung vorbringen. Gleichzeitig hing das Heer von den führenden Schwerindustriellen ab und schloss sich deshalb mit ihnen zu einer strategischen Clique zusammen. Entsprechend zögerlich ging die Regierung gegen die Interessen der Großindustriellen vor, wie vor allem die Frage der Einführung einer Kriegsgewinnsteuer zeigte. Erst im Juni 1916 kam es zu einer moderaten Besteuerung durch das Kriegssteuergesetz, das nach großem Zögern erlassen wurde.
Fehlende Lenkungsinstrumente
Wirtschaft und Politik rückten binnen kurzer Zeit in einer Weise zusammen, die ohne den Krieg kaum denkbar gewesen wäre. Sicherlich wog die Fehleinschätzung einer kurzen Kriegsdauer schwer, zumal sie mit der Überzeugung einherging, dass sich eine leistungsfähige Friedenswirtschaft rasch an die Erfordernisse des Krieges anzupassen wisse. Als die Einsicht in die Langfristigkeit des Wirtschaftskrieges vorhanden war, standen immer noch keine geeigneten Planungsinstrumente und Konzepte zur Verfügung. Eine gezielte Wirtschaftspolitik im Sinne einer gesamtwirtschaftlichen Ordnungs- oder Steuerungspolitik war unbekannt. Insofern mussten viele Maßnahmen wie Improvisation wirken, wofür die geschätzten 1.200 gesetzlichen Einzelregelungen allein im Bereich der Bewirtschaftung ein beredtes Zeugnis lieferten. Aus der Bürokratisierung wirtschaftlicher Abläufe ergab sich auch ein Bewertungsproblem: Während das Militär Erfolge, auch wirtschaftlicher Natur, für sich reklamierte, standen die staatlichen Verwaltungen am Pranger, sobald sich Misserfolge einstellten. Zugleich erwies sich die ad hoc entstandene Verwaltungsorganisation als dysfunktional, weil den zivilen Behörden vielfach eine militärische Instanz übergeordnet worden war.
Reorganisation der OHL
1916 schlug nicht die Stunde der Politik, sondern diejenige des Militärs. Angesichts der wirtschaftlichen Verteilungs- und Machtkämpfe schwebte der OHL ebenso wie den führenden Industriellen die Installation eines wirtschaftlichen Generalstabs vor, dessen Befehle für eine straffe militärische Leitung der Kriegswirtschaft sorgen sollen. Die Gelegenheit für eine umfassende administrative Neuordnung ergab sich durch die Neuorganisation der OHL unter Leitung der Generäle Paul von Hindenburg (1847–1934) und Erich Ludendorff (1865–1937). Das Mitte September 1916 veröffentlichte Hindenburg-Programm sah eine Ausweitung der Militärpflicht, eine Einbeziehung der Frauen in die Dienstpflicht, die Umleitung von Arbeitern in kriegswichtige Industrien, die Schließung der Universitäten sowie die Koordination der Rüstungswirtschaft durch die Einrichtung eines obersten Kriegsamtes vor. Der letzte Punkt, der im Hinblick auf die Wirtschaftsordnungspolitik am bedeutendsten war, führte zu direkten Verhandlungen mit dem Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg (1856–1921). Die konkret diskutierten Pläne nahmen auf die bestehenden Reichsstrukturen sowie die Mitspracherechte des Parlaments stärker Rücksicht und endeten mit der Kompromisslösung eines Umbaus des preußischen Kriegsministeriums. Zum 1. November 1916 nahm das Kriegsamt, dem neben der existierenden Kriegsrohstoffabteilung auch das kurz zuvor errichtete Waffen- und Munitionsbeschaffungsamt eingegliedert wurden, seine Arbeit auf. Daneben umfasste es noch Abteilungen für Einfuhr und Ausfuhr, für Volksernährung sowie ein Amt für Kleiderbeschaffung. Die Zielsetzung einer effizienteren Koordination begrüßten insbesondere die Vertreter der Industrie, die immer wieder die Ineffizienz der Beschaffungsstellen gerügt hatten. Die neue oberste Kriegsbehörde stand unter der Leitung des Generals Wilhelm Groener (1867–1939), der nicht nur den militärischen Zugriff sicherte, sondern auch als Garant für die Wahrung der industriellen Interessen galt. Trotz ihrer Sonderexistenz innerhalb des preußischen Kriegsministeriums konnte sie die Konfliktlagen mit anderen kriegswichtigen Instanzen, z.B. mit dem Reichsamt des Inneren oder mit den Kriegsministerien der Länder, nicht auflösen.
Quelle
Denkschrift der Reichsregierung über wirtschaftliche Maßnahmen aus Anlass des Krieges. Reichstagsdrucksache vom 5. März 1917
Aus: Geheimes Preußisches Staatsarchiv, 1. Hauptabteilung, Repositur 90A, Nr. 4651
Die Bewirtschaftung der Rohstoffe durch die Kriegsrohstoffabteilung (KRA) bedeutet einen durch die Kriegsereignisse erforderten Eingriff in die bestehende Wirtschaftsordnung und die auf ihr beruhende unbeschränkte Verfügungsfreiheit, für den es im deutschen Wirtschaftsleben ein Vorbild nicht gab. Der Umkreis der Aufgaben und der ihnen anzupassenden Organisation ließ sich daher zu Anfang nur teilweise übersehen und konnte erst im Laufe der Zeit aus den Anforderungen der Heeresverwaltung und der für sie arbeitenden staatlichen und privaten Betriebe und des Bedarfes der Friedensindustrie in vollem Umfange ermessen werden. Die Tätigkeit der Rohstoffabteilung läßt sich heute dahin umschreiben, dass ihre vornehmste Aufgabe – auf Grundlage der Verfügungsberechtigung über die für den Heeresbedarf unentbehrlichen Rohstoffe – auf deren Ansammlung und Verteilung beruht.
Die Ansammlung geschieht in der Absicht, eine Vergeudung der Rohstoffe zu verhindern, ihre Verwendung für Heereszwecke zu sichern, eine Übersicht über die zur Verfügung stehenden Mengen zu gewinnen, die vorhandenen Bestände zu vergrößern und zu strecken, kurz in vorsorglicher Weise den Rohstoffhaushalt zu regeln. […] Die Verteilung der Rohstoffe ordnete sich dem Grundsatze unter, den Betrieben fortlaufend ihren Bedarf an Stoffen zur Herstellung von Kriegsgütern zuzuführen und Ungerechtigkeiten durch Bevorzugungen oder ungleichmäßige Verteilungen zu verhindern.
Eine weitere Aufgabe der KRA besteht in der Wertabschätzung der beschlagnahmten und requirierten Güter. […] Endlich entstand die Notwendigkeit, Organisationen zu schaffen, um die Bestände aus Feindesland in die Heimat zu leiten, nach Verwendungsgebieten und örtlichem Bedarf zu sammeln, zu verteilen, abzuschätzen, zu buchen und abzurechnen. Es entwickelt sich hieraus eine Warenwirtschaft, die kaum zuvor in einer Hand gelegen hat, und die ohne Mithilfe der geschaffenen Handelsorganisationen nicht zu bewältigen gewesen wäre.
Überhitzung der Wirtschaft
Militärisch lag der Schwerpunkt des Hindenburg-Programms auf der Munitionsproduktion. Der verlustreiche Stellungskrieg an der Somme wies im Sommer 1916 eindrücklich auf diesen Hauptengpass hin. Ohne Rücksicht auf die Kosten sollte binnen eines halben Jahres der Bestand an Munition verdoppelt werden. Bei dieser Entscheidung der OHL spielte auch die Erkenntnis eine Rolle, dass die zahlenmäßige Überlegenheit der alliierten Armeen weiter wachsen würde und dies, obwohl der Kriegseintritt der USA noch nicht feststand. Auch qualitative Verbesserungen bildeten ein Ziel der Rüstungspolitik mit Blick auf die Steigerung der Effizienz der Armee durch „Maschinen“. Damit waren in Abgrenzung zur herkömmlichen Waffentechnik neuartige Waffen wie Maschinengewehre, Geschütze, Minenwerfer und Flugzeuge gemeint.
Ferner lancierte die OHL ein großes Programm zum Neubau von Industrieanlagen, ohne für eine bessere Nutzung bestehender Anlagen zu sorgen. Geplant und teilweise durchgeführt wurden Investitionen in neue Fabriken, neue Hochöfen, sogar in neue Rheinbrücken. Auf der Gegenseite schloss das Kriegsamt für die Rüstungsproduktion entbehrliche Betriebe und entzog ihnen dadurch die Arbeitskräfte, Rohstoffe und Maschinen. Im Dezember 1916 entstand zu diesem Zweck ein „Ständiger Ausschuss für die Zusammenlegung von Betrieben“, der aber nur ein knappes Jahr existierte, weil seine Arbeit zu stark von Richtungskämpfen bestimmt war.
Mangel an Arbeitskräften
Weitere anhaltende Engpässe, die ebenfalls für Konflikte zwischen Industriellen und Kriegsministerium sorgten, traten auf dem Arbeitsmarkt auf. Bereits mit der massenhaften Mobilisierung im ersten Kriegsjahr waren den Unternehmen viele Arbeitskräfte entzogen worden. Je nach Industriebranche schrumpften die Belegschaften um ein Viertel oder gar ein Drittel, beispielsweise verlor der Ruhrbergbau 145.000 seiner 425.000 Bergleute. Die Industriellen warfen dem Ministerium auch vor, nur eine unzureichende Anzahl von Facharbeitern zurückgestellt zu haben, sodass sich der industrielle Facharbeiterstamm in nichts aufgelöst habe.
Mit dem Hindenburg-Programm verfolgten OHL und Industrielle das Leitbild einer Militarisierung der Arbeitsverhältnisse, um nach Möglichkeit die gesamte Zivilbevölkerung für den Arbeitsdienst zu mobilisieren. Zu diesem Zweck sei die Freizügigkeit einzuschränken, was zugleich für eine Milderung des Ärgernisses der Arbeitskräftefluktuation sorgen sollte. Gegen solch drastische Vorstellungen formierte sich Widerstand von ungewohnter Seite. Staatssekretär Helfferich gab teils aus einer wirtschaftsliberalen, teils aus einer sozialkonservativen Haltung zu bedenken, dass sich ein Heer befehligen lasse, nicht aber eine Volkswirtschaft. In der Tat erwies es sich als Fehleinschätzung, derartige Forderungen an die Arbeiter stellen zu können, ohne Zugeständnisse anzubieten. Nicht nur die Reichstagsmehrheit stellte sich gegen die Pläne, sondern auch die Reichsregierung forderte im Gegenzug Mitbestimmungsrechte für die Gewerkschaften ein. Im Ergebnis entstand ein Hilfsdienstgesetz mit starkem Kompromisscharakter.
Stichwort
Gesetz über den Vaterländischen Hilfsdienst
5. Dezember 1916. Gegeben im Großen Hauptquartier, gezeichnet von Kaiser Wilhelm II. und Reichskanzler von Bethmann Hollweg Das Dienstleistungsgesetz führte eine allgemeine Arbeitspflicht ein, die euphemistisch als „vaterländischer Hilfsdienst“ bezeichnet wird. Zwangsverpflichtet wurden alle arbeitsfähigen Männer zwischen 17 und 60 Jahren. Weitergehende Forderungen der OHL, insbesondere zum Zwangspflichteinsatz von Frauen, scheiterten an Widerständen aus dem Parlament. Die Regelungen des Gesetzes wurden auf Intervention der Gewerkschaften abgeschwächt, auf die die Regierung in der Kriegssituation Rücksicht nehmen musste.
Entgegen den Intentionen der im Sommer 1916 neu formierten OHL entfaltete das Gesetz eine bahnbrechende sozialpolitische Wirkung. Es stärkte die gewerkschaftliche Forderung nach Mitbestimmung, indem es in Betrieben mit mehr als 50 Beschäftigten obligatorische Arbeiterausschüsse einrichtete. Diese paritätisch besetzten Gremien sollten „das gute Einvernehmen innerhalb des Betriebes und zwischen der Arbeiterschaft und dem Arbeitgeber“ fördern (§ 12). Sie ebneten als erstmalige gesetzliche Verankerung der Arbeitervertretungen den Weg zu den 1920 eingerichteten Betriebsräten. Ein Verfahren zur Schlichtung von Konflikten im Arbeitsleben wurde institutionalisiert.
Die weitgehenden Zugeständnisse trugen der Schlüsselrolle der Gewerkschaften für die Rüstungswirtschaft Rechnung. Der Historiker Wolfgang Mommsen bezeichnete die Anerkennung des gewerkschaftlichen Anspruchs auf Gleichberechtigung als ihren „Ausbruch aus dem Ghetto“.
Das Hilfsdienstgesetz setzte einen Markstein für das Verhältnis von Politik, Wirtschaft und Militär. Unfreiwillig ergriff das kaiserliche Regime für die Arbeiterinteressen Partei und gab seine Einwilligung dazu, dass Gewerkschaftsvertreter Ämter bekleideten, die zur Ausführung von Gesetzen dienten. Wenn es der Reichstagsmehrheit derartige Zugeständnisse machte, zeigte sich, dass es kaum mehr in der Lage war, eine eigenständige Position gegenüber den divergierenden Forderungen der sozialen Gruppen zu behaupten. Im Gegenteil lieferte das Hilfsdienstgesetz den Beweis dafür, dass die Regierung einen herben Autoritätsverlust hinzunehmen hatte und zum Spielball organisierter Klasseninteressen wurde. Die nachfolgende Zunahme der Klassenspannungen lässt sich auf diese Weise erklären.
Deklassierung Mittelstand
Die Auswirkungen der lobbyistischen Interessenpolitik der Großindustrie zeigten sich an der Deklassierung des selbstständigen Mittelstandes. Kleinbetriebe, aber auch mittlere Unternehmen hingen zumeist von einem einzelnen Handwerksmeister oder Geschäftsleiter ab. Dessen Einberufung zum Kriegsdienst zog oft die Schließung oder Stilllegung des Geschäfts nach sich. Angesichts der Machtverhältnisse in den Kriegsgesellschaften waren kleinere und mittlere Unternehmen auch hinsichtlich der Rohstoffverteilung benachteiligt. Ihre Produktion war kriegswirtschaftlich weniger relevant, sodass ihre Absatzmöglichkeiten wegen der Verbrauchsbeschränkungen im Rationierungssystem zurückgingen. Auch die Lohnerhöhungen konnten von den industriellen Großbetrieben leichter verkraftet werden. Wegen des Mangels an Arbeitskräften und Rohstoffen sowie des fehlenden Absatzes standen nach zwei Jahren Krieg rund 250.000 kleingewerbliche Betriebe still. Die Praxis der Kriegswirtschaft führte tendenziell zu einem Verdrängungswettbewerb zulasten des gewerblichen Mittelstandes. Allerdings sind die langfristigen Effekte zeitgenössisch meist überzeichnet worden, denn viele kleinere Betriebe konnten die im Dezember 1916 verfügten Betriebsstilllegungen abwehren. Insgesamt lag der Rückgang der Handwerksbetriebe sogar im langfristigen Trend, denn ihre Anzahl nahm zwischen 1907 und 1919 lediglich um acht Prozent ab.
Weder das Hindenburg-Programm noch das Hilfsdienstgesetz konnten die weitreichenden Erwartungen erfüllen, die an sie gestellt wurden. Gemäß den Vorgaben der Hindenburg-Denkschrift konzentrierte sich die Eisen- und Stahlindustrie auf die Rüstungsproduktion. Deshalb fehlten Ausbau- und Ersatzteile für die Eisenbahn, zudem war der Bahnbetrieb durch die Steigerung des Transportvolumens überfordert. Dieser Zustand mündete in eine allgemeine Verkehrskrise, die ihrerseits auf den industriellen Produktionsbereich zurückwirkte. Schon ab Mitte Oktober 1916 kam es zu Betriebsunterbrechungen in Rüstungsfabriken wegen Kohlemangel, weil zu ihrer Zulieferung die Waggons fehlten.
Zwangsverpflichtungen zur Arbeit
Die Durchführung des ambitionierten Rüstungsprogramms machte eine Mobilisierung zusätzlicher Arbeitskräfte, darunter viele Frauen, nötig. Die OHL zog 125.000 Stahlarbeiter von der Front wegen der Einsicht zurück, dass Lücken in der Produktion zu schließen seien. Zusätzlich wurden Anfang 1916 begonnene Versuche intensiviert, mithilfe der Zwangsrekrutierung ausländischer Arbeitskräfte dem anhaltenden Problem Herr zu werden. Deutsche Industrielle drängten im Verein mit der OHL im Herbst 1916 erfolgreich darauf, die Lücken durch die weitere Zuführung belgischer Arbeiter zu schließen. Die Zwangsverpflichteten wurden überwiegend im rheinisch-westfälischen Industriegebiet eingesetzt. Trotz der Verschleppung von knapp 80.000 belgischen Arbeitskräften konnte das Ziel, der gesamten deutschen Wirtschaft massenhaft Arbeiter zuzuführen, nicht erreicht werden. Die Deportationen wurden im Februar 1917 auf starken ausländischen Druck, der auf die Völkerrechtswidrigkeit hinwies, eingeschränkt. Viele Arbeiter wurden zurückgeführt und die Zwangsarbeiterverpflichtung blieb dem kollektiven Gedächtnis als eindrückliches Szenario der Schrankenlosigkeit einer totalen Kriegsführung erhalten.
Die Anwerbung aus Belgien setzte sich indessen unter geringerer Zwangsanwendung fort, sodass bis Sommer 1918 nochmals 100.000 Arbeiter ins Deutsche Reich gelangten. Im Herbst 1916 radikalisierte sich auch die Zwangsarbeiterrekrutierung in Polen, die aus der traditionell üblichen Saisonarbeit hervorging. Die Arbeitsverpflichtung erfolgte meist im Agrarsektor, in dem rund eine halbe Million polnischer Beschäftigter gezählt wurde. Von den 2,5 Millionen Kriegsgefangenen wurden außerdem 1,6 Millionen zwangsweise eingesetzt, etwa zur Hälfte in der Landwirtschaft und zu einem Drittel im Industriesektor.
In dieser Situation trat im Dezember das Hilfsdienstgesetz in Kraft, das sich der inländischen Arbeitskräfteverpflichtung verschrieb. Jedoch brachte es kaum befriedigende Ergebnisse. Zwar ließen sich Umsetzungen in Richtung der kriegswichtigen Industrien erreichen, doch waren in der Breite viel zu wenig neue Arbeitskräfte zu mobilisieren. Insbesondere blieb der gravierende Mangel an ausgebildeten Arbeitern virulent, sodass sich das Ergebnis der Kampagne aus Sicht des Militärs als Misserfolg darbot. Der durch die Transportkrise im Winter 1916/17 zugespitzte Ernährungsmangel wirkte ebenfalls auf den Zustand der Arbeiterschaft zurück. Neben den Lieferungsproblemen erwies sich ihre Überforderung als entscheidender Engpass der deutschen Kriegswirtschaft.
Verschärfung der Wirtschaftskrise
Unter dem Eindruck der Transportkrise konnten die zu hoch gesteckten Ziele des von Hindenburg propagierten Produktionsprogramms nicht erfüllt werden. Das ambitionierte Ziel einer Verdopplung der Munition wurde knapp verfehlt, doch waren auch hier wirtschaftliche Interdependenzen zu beachten. Um das zusätzlich produzierte Pulver zu Infanterie- und Artilleriemunition verarbeiten zu können, war zugleich eine Monatsproduktion von 150.000 t Rohstahl sowie von Nichteisenmetallen wie Kupfer, Blei, Zink und Aluminium im vierstelligen Tonnenbereich erforderlich. Nur bei den letztgenannten Metallen gelang die notwendige Produktionssteigerung, während die Eisen- und Stahlproduktion in der Transportkrise Anfang 1917 jäh abfiel und sich erst im Laufe des Frühjahrs wieder erholte. Insgesamt konnte in diesem Sektor 1917 der Vorjahreswert leicht übertroffen werden. Dennoch erreichte der erzielte Produktionswert an Stahl und Eisen nur 83 Prozent der Vorkriegsproduktion von 1913.
Kohlemangel
An der Basis der Rohstoffversorgung entwickelte sich der Kohlemangel zum Dauerproblem des Wirtschaftskriegs. Zu keinem Zeitpunkt gelang es, die Produktion des Jahres 1913 wieder zu erreichen. Nach einem Einbruch im Jahr 1915 auf 78 Prozent der Vorkriegsförderung verzeichnete man 1917 immerhin wieder eine Steigerung auf 90 Prozent. Um dieses Ergebnis zu erzielen, war allerdings im Mai/Juni 1917 eine Freistellung von 50.000 Frontsoldaten für den Ruhrbergbau die Voraussetzung. Kohle wurde immer mehr rationiert und ihre Zuteilung auf Vorzugsbetriebe beschränkt, d.h. 5.000 Betriebe der Grundversorgung mit Energie, während 35.000 prioritäre Rüstungsbetriebe nur noch 60 bis 80 Prozent ihres angemeldeten Bedarfs erhielten.
Eine leichte Verbesserung der rüstungswirtschaftlichen Situation trat im Laufe des Jahres 1917 ein, weil die OHL einige Entscheidungen des Hindenburg-Programms korrigierte. Der Bau von Neuanlagen, in die viel Arbeitszeit und Material investiert worden war, wurde zurückgestellt und Investitionsprogramme wurden zugunsten der laufenden Produktion eingeschränkt. Dem stand nach wie vor das Interesse der Industrie entgegen, die zu errichtenden Kapazitäten eventuell für eine Friedenswirtschaft nutzen zu können. Demgegenüber zeichnete sich die Kriegswirtschaftsordnung allgemein dadurch aus, dass viele Investitionen in Bereiche flossen, für die unter Friedensbedingungen kein Bedarf abzusehen war. Insofern führten die kriegswirtschaftlichen Prioritäten zu einem Verlust an gesamtwirtschaftlichen Überlegungen. Die für Wirtschaftsfragen zuständigen Ressorts der Reichsregierung und des preußischen Staates waren kaum mehr an den Planungen beteiligt. Die Totalmobilisierung führte im Rüstungsbereich zumindest zum Erhalt der Produktionsleistungen. Trotz der bedingungslosen Konzentration der Ressourcen auf die Rüstungswirtschaft war der Zusammenbruch angesichts der wirtschaftlichen Überlegenheit der Kriegsgegner, insbesondere nach dem Kriegseintritt der USA im April 1917, vorprogrammiert.
Fallende Agrarproduktion
Die deutsche Landwirtschaft erreichte um 1913 einen Selbstversorgungsgrad von 90 Prozent, der sich aber über die Agrarprodukte ungleich verteilte. Überschüsse gab es in der Zuckerrüben- sowie in der Kartoffel- und Roggenerzeugung. Basisprodukte wie Brotgetreide und Fleisch lagen im Durchschnitt der Selbstversorgungsquote, während bei Fetten und Eiern nur 60 Prozent des Verbrauchs im Inland produziert werden konnten. Das Halten der relativ hohen Selbstversorgungsquote der Vorkriegszeit erwies sich recht bald als Illusion. Schon im Herbst 1914 traten in Bezug auf die Ernährung die ersten Engpässe auf. Ab Winter 1915/16 verknappten und verteuerten sich die Lebensmittel allgemein und von einer Ernährungskrise konnte man ab Frühjahr 1916 sprechen. Von Kriegsbeginn bis zum Jahr 1917 fiel die agrarische Produktion um 42,8 Prozent.
Die Ursachen der Produktionskrise waren vielfältig. Die Anzahl der Arbeitskräfte ging durch die Einberufung vieler Bauern und Landarbeiter stark zurück, weil der Heeresdienst absoluten Vorrang hatte. Stattdessen wurden viele Frauen und Jugendliche in der Landarbeit eingesetzt und, wie erwähnt, auch knapp eine Million Kriegsgefangene. Diese Substitution der Arbeitskräfte führte zu einem Rückgang der Arbeitsproduktivität. Die menschliche Arbeitskraft wurde knapp, aber die Mobilisierung erstreckte sich auch auf Arbeitstiere, vor allem Pferde, die als Nutztiere an der Front gebraucht wurden. Die landwirtschaftliche Anbaufläche ging zurück, denn Ackerland lag brach, weil Arbeitskräfte zu seiner Bestellung fehlten. Vielfach wurde es nur als Weide genutzt. Auch Saatgut und Dünger wurden knapp. Zwar standen in Deutschland große Mengen an Kalidünger zur Verfügung, doch waren Stickstoff und Phosphor nicht ausreichend vorhanden. Insbesondere machte sich das Fehlen des chilenischen Salpeters bemerkbar, dessen Vorkriegsimport rund 770.000 t pro Jahr erreichte. Mangelnde Düngung hatte einen Rückgang der Bodenproduktivität zur Folge, d.h., die Hektarerträge fielen. Das Hindenburg-Programm erkannte zwar die Priorität des Agrarsektors an, konnte aber die wichtigsten Engpässe wie den Arbeitskräfte- und Zugtiermangel sowie die Düngerknappheit nicht beheben.
Legende der Aushungerung
Der Nahrungsmittelmangel wurde zeitgenössisch häufig als Wirkung der britischen Blockade dargestellt. Doch ist die Deutung, dass Deutschland von den Alliierten ausgehungert wurde, kaum haltbar. Zwar waren die Mittelmächte vom überseeischen Handel abgeschnitten, was sich vor allem in strategischen Bereichen wie der erwähnten Salpeterversorgung bemerkbar machte. Auch ging die Einbindung in die internationale Arbeitsteilung verloren. Bis zur Mitte des Kriegs existierte aber ein weitgehend funktionsfähiges Reexport-system über die neutralen skandinavischen Länder sowie über die Niederlande und die Schweiz. Die Kompensation der Handelsausfälle über verbündete Länder war dagegen unbedeutend, weil Österreich und Ungarn als kriegführende Mächte selbst mit Versorgungsproblemen zu kämpfen hatten. Insgesamt blieben die Lieferungen aus ost- und südosteuropäischen Gebieten gering, wenn man von punktuellen Ausnahmen, zum Beispiel den Olivenöllieferungen aus der Türkei, absieht. Eine Milderung der Folgen der Blockade brachte auch die Unterwerfung Rumäniens, aus dem bedeutende Lieferungen an Getreide bezogen wurden. Gegen Kriegsende konnten nach dem Friedensschluss von Brest-Litowsk auch 400.000 t Getreide aus der Ukraine gepresst werden.
Als die deutschen Ressourcen gegen 1916/17 zur Neige gingen, ließ sich das insofern mit der Blockade in Verbindung bringen, als die Kompensation des Produktionsrückgangs über Importe nicht gelang. Die Ernährungskrise war aber weitaus mehr ein Ergebnis der Transportkrise sowie der allgemeinen Überforderung der deutschen Wirtschaft. Insofern ist die Erklärung zurückzuweisen, dass Deutschland den Krieg verlor, weil es ausgehungert wurde, wie sie in der Weimarer Republik im Zuge der Dolchstoßlegende vorgebracht wurde. Allgemein ist darauf hinzuweisen, dass der Vergleich mit einer belagerten Burg nicht stimmte, weil in einer großen Volkswirtschaft nur bestimmte Bereiche von dem Handelsembargo getroffen werden. Auch stand dem Rückgang der Einfuhren ein noch stärkerer Rückgang der Ausfuhren gegenüber, sodass größere Teile der Produktion, die ansonsten exportiert wurden, in den inländischen Verbrauch gingen. Dies galt für die Ernährung allerdings weniger, weil die Agrarexportleistung Deutschlands vor Kriegsausbruch kaum nennenswert war.
Rationalisierung und Ersatzstoffe
Die Ernährungskrise hatte auch bedeutende verteilungspolitische Implikationen. Als erste deutsche Großstadt führte Berlin bereits Anfang 1915 eine Brotkarte ein. Das System der Lebensmittelkarten wurde ausgedehnt und ab 1916 trat eine allgemeine Rationierung ein. Im Zuge dessen sank zum Beispiel die Fleischzuteilung für den Durchschnittsbürger, gemessen am Vorkriegsverbrauch, im Juli 1916 auf 31 Prozent, im Juli 1917 auf 21 Prozent. Zum Rückgrat der Ernährung wurden Kartoffeln, während die Mehlzuteilungen nur noch auf der Hälfte des Vorkriegsstandes lagen. Die Qualität der Lebensmittel verschlechterte sich fortwährend durch die Verwendung von Ersatzstoffen: Mischbrot wurde beispielsweise unter Zusatz von Kartoffelmehl gebacken.
Um die Nahrungsmittelknappheit zu bewirtschaften, wurde eine Zentraleinkaufsstelle als Monopolstelle für Importe eingerichtet. Da die Regulierungsanforderungen immer umfassender wurden, richtete die kaiserliche Regierung im Mai 1916 das Kriegsernährungsamt ein. Neben der Importregulierung war seine Aufgabe die Steigerung der inländischen Produktion. Von der Einsetzung von Reichskommissaren bis zur Errichtung der Reichsgetreidestelle wurde die Nahrungsmittelbewirtschaftung bürokratisch durchorganisiert. Durch diese Bürokratisierung rückte die Verantwortlichkeit der Politik für die Ernährungssituation in den Vordergrund. Infolge der Missernte im Herbst 1916 wurden Steckrüben (Kohlrüben), die sonst als Viehfutter dienten, zum Ersatz für Kartoffeln. Daneben trugen die Effekte der Transportkrise zum verbreiteten Hunger des sogenannten Steckrübenwinters 1916/17 bei, in dem die Verbraucher nochmals Kürzungen ihrer Rationen hinnehmen mussten. Die öffentliche Stimmung schlug im Verlauf der Krise gegen den vermeintlich Verantwortlichen um: Der Präsident des Kriegsernährungsamtes, der ostpreußische Oberpräsident Adolf von Batocki (1868–1944), wurde als Ernährungsdiktator bezeichnet.
Quelle
Flugblatt mit Anweisungen zum Kohlrübengebrauch, Oktober 1916
Aus: Deutsches Historisches Museum, Berlin, Do 69/514I
Kohlrübe statt Kartoffel.
Der geringere Ausfall der letzten Kartoffelernte nötigt dazu, Ersatzmittel heranzuziehen. Als solches eignet sich in hohem Grade die Kohlrübe. Sie ist zwar wasserreicher als die Kartoffel, hat aber den Vorteil, dass sie sich bequemer zubereiten läßt, weniger kostet, auch durch Frost nicht leidet und in großer Menge beschafft werden kann. Überall wo die Kartoffelversorgung Schwierigkeiten bietet, sollte man deshalb zur Kohlrübe greifen, und zwar ist die Verwendung im Herbst und Winter zu empfehlen, weil sie im Frühjahr mehr zum Verderben neigt.
Zubereitung: Die Kohlrübe wird durch Waschen und Putzen gereinigt und von der äußeren harten Schale befreit; hierauf wird sie in große Stücke geschnitten und gekocht oder gedämpft. Das Brühwasser wird abgegossen, weil in ihm hauptsächlich der Rübengeschmack enthalten ist. Die gekochten Kohlrüben werden nunmehr feiner geteilt, mit anderen Nahrungsmitteln vermischt und nochmals gekocht.
Verteilungskonflikte
Die Frage ist strittig, ob den auftretenden Verteilungskonflikten eine politische Einflussnahme zugrunde lag. Zu Beginn des Krieges war es durchaus das Ziel, die Produktion von Brotgetreide, Kartoffeln und Rüben zu fördern zuungunsten der Fleischproduktion, in der man zu Recht eine Vernichtung von Kalorieneinheiten sah. Dennoch verschob sich die Präferenz aufgrund des Kriegsverlaufs zum Fleisch, weil es sich wegen der längeren Haltbarkeit besser für die Versorgung Tausender von Frontsoldaten eignete. Die ohnehin bevorzugte Zuteilung der Lebensmittel an die Armee umfasste auch 500.000 kg Fleisch pro Monat. In diesem Sinne gestaltete sich schon zu Kriegsbeginn die Preispolitik. Während man zum Schutz der Verbraucher für den Getreidepreis eine Höchstgrenze setzte, blieb der Fleischpreis frei. Die dadurch verursachte Hochpreispolitik für Fleisch setzte politisch ungewollte Anreize für die Erzeuger: Die Bauern verfütterten ihr Getreide lieber an Schweine, weil für das Fleisch ein hoher Preis zu erzielen war. Die Beförderung der Viehhaltung entzog dem Markt zusätzlich Brotgetreide.
„Schweinemord“
Eine daran anknüpfende ernährungspolitische Entscheidung wurde in ihrer Wirkung zeitgenössisch überschätzt. Die Zwangsschlachtungen des im Volksmund so bezeichneten Schweinemords sollten Anfang 1915 die Schweine als Ernährungskonkurrenten des Menschen ausschalten. Einerseits wurde dabei die Rolle der Schweine als Abfallverwerter vergessen. Andererseits ließ die Schlachtung von zwei Millionen Tieren, bei einem Vorkriegsbestand von 27 Millionen, die Folgen der Bestandsverminderung teils als übertrieben dargestellt erscheinen. Die quantitative Betrachtung zeigt, dass der sich einstellende Schweinefleischmangel schwerlich allein durch die geringere Reproduktionsrate erklärt werden kann. Gegen die Zwangsanordnungen der Verwaltung gab es Widerstände. Insbesondere die Großgrundbesitzer, die ostelbischen Junker, lehnten sich gegen jegliche Regulierung der Landwirtschaft und die Verordnungen zur Nahrungsmittelverteilung auf. Nicht selten betrieben sie Sabotage und ließen sich von ihren egoistischen Zielen leiten.
Die Mobilität durch höheres Einkommen versprach eine bessere Ernährung. Die Reiselust des Bürgertums war ausgeprägt, sodass die Hotels der Ferienorte in den Sommermonaten 1916 und 1917 überfüllt waren. Dort wurde von guten Versorgungsbedingungen im Kontrast zu den städtischen Realitäten berichtet. Das Kriegsernährungsamt war vor allem im Winter 1916/17 nicht mehr Herr der Lage. Es herrschten soziale Spannungen zwischen Stadt und Land, zwischen Gutsituierten und ärmeren Schichten, zwischen Rüstungsarbeitern mit hohen Sonderzuteilungen und Normalverbrauchern. Die Versorgungsengpässe sowie Ungerechtigkeiten in der Verteilung wurden öffentlich stark diskutiert und die Ernährungsverwaltung für die desolate Lage verantwortlich gemacht. Aus der Ernährungskrise erwuchs eine Krise der politischen Herrschaft. Sie ließ das Vertrauen in den Staat schwinden und weitete sich zu einer politischen Legitimitätskrise aus.
Verfall der Regierungslegitimität
Als die Hoffnung auf die Führung eines kurzen, erfolgreichen Krieges schwand, war die Reichsregierung durch die Anforderungen eines langwierigen, „totalen“ Krieges überfordert. Sie sah sich nicht in der Lage, die militärische und zivile Gewalt so zu organisieren, dass die Wirtschaft in ausreichendem Maße mobilisiert wurde. Als 1916 die Stunde des Militärs schlug, wurde die zivile Regierung ins Abseits gedrängt. Aber auch der OHL gelang es nicht, die gesellschaftlichen Konflikte zu entschärfen – im Gegenteil: Da die ranghöchsten militärischen Vertreter einen kompromisslosen Kurs verfolgten, trugen sie zur Verschärfung der Spannungen zwischen den sozialen Gruppen bei.
Industrielle in der Politik
Die Großindustriellen behaupteten im Krieg nicht nur ihre wirtschaftlich herausgehobene Stellung, sondern bauten auch ihren politischen Einfluss aus. Weil die Politik mehr als vorher über den wirtschaftlichen Erfolg entschied, stieg für sie der Anreiz, politische Verantwortung zu übernehmen. Eine größere Anzahl von Unternehmern und Managern zog in hohe Positionen der staatlichen Verwaltung ein, z.B. Walther Rathenau, Karl Helfferich, Carl Duisberg (1861–1935), Wichard von Moellendorf, Richard Merton (1881–1960) oder Kurt Sorge (1855–1928), sei es in den Kriegsgesellschaften oder in den für die Kriegswirtschaft errichteten Sonderverwaltungen. In diesen Stellungen arbeiteten sie mit den Führungsetagen ihrer Unternehmen aufs Engste zusammen.
Neuformierung der politischen Rechten
Der ideologisch-wirtschaftliche Zusammenschluss der Industriellen mit dem Militär äußerte sich in der Gründung der Deutschen Vaterlandspartei im September 1917. Unter der Führung des Großadmirals Alfred von Tirpitz (1849–1930) und des ostpreußischen Generallandschaftsdirektors Wolfgang Kapp (1858–1922) vereinte diese erstmalig auftretende außerparlamentarische Bewegung von rechts „weiteste vaterländische Kreise“ und erreichte bis Kriegsende einen Stand von 800.000 Mitgliedern. Sie wandte sich gegen die diskutierten Verfassungsreformen, den „verderblichen Parteienstreit“ und die „innere Zwietracht“. Der Verständigungsfriede sollte verhindert und statt „nervenschwacher Friedenskundgebungen“ sollten alle Kräfte für den militärischen Sieg mobilisiert werden. Die rechtsextreme Sammlungsbewegung brachte Industrievertreter mit konservativen Organisationen wie dem Alldeutschen Verband, aber auch mit den Bauernvereinen und dem Reichsdeutschen Mittelstandsverband zusammen. Trotz seiner Deklassierung entwickelte der Mittelstand keine Solidarität mit der Arbeiterschaft, sondern wandte sich auch dem neuen rechten Radikalkonzept zu.
Unruhen und Proteste
Auf der Gegenseite formierte sich die Arbeiterschaft, die sich immer lautstärker gegen die Kriegsführung wandte. Ab 1916 waren Brotunruhen lokalen Zuschnitts zu verzeichnen, die vor allem von Frauen und Jugendlichen getragen waren. Im Winter 1916/17 griffen die Proteste auch in den industriellen Zentren um sich, z.B. zwischen Januar und März im Ruhrgebiet, in Berlin und anderen Orten. Die Hauptforderungen an die Industriellen bezogen sich auf höhere Löhne und vom Staat forderte man Maßnahmen zur Verbesserung der Ernährung. Trotz ihrer erstarkten Stellung sahen sich die freien Gewerkschaften mit „wilden Streiks“ konfrontiert, die sie nicht initiiert hatten. Meistenteils handelte es sich aber um klassische Formen des Aufbegehrens gegen Zustände, die als ungerecht empfunden wurden. Die Ziele waren klar umrissen, insbesondere die Verbesserung der Versorgung, während ein politisches Gesamtkonzept kaum erkennbar war. Einigkeit herrschte aber hinsichtlich der pessimistischen Annahmen zum Kriegsverlauf. Das manifeste Krisenbewusstsein und die Kriegsmüdigkeit mündeten in eine Sehnsucht nach Frieden. Die Kriegssituation führte zu einer Polarisierung der Kriegsgesellschaft, sodass sich Arbeiterschaft und Unternehmerschaft konfrontativ gegenüberstanden.
Wirtschaftliche Schäden
Während die sozialen Großgruppen kaum Positionsverluste hinzunehmen hatten, präsentierte sich der Erste Weltkrieg volkswirtschaftlich als eine große Verlustrechnung. Im Zuge der Totalisierung des Krieges erhöhte sich im Deutschen Reich die Anzahl der unter Waffen stehenden Soldaten von rund zwei Millionen (1914) auf elf Millionen (1918). Davon fielen über zwei Millionen in Kampfhandlungen. Zudem waren rund 600.000 Hungertote im Zuge der Ernährungskrise zu beklagen. Beachtlich waren auch die Folgekosten, denn Kriegshinterbliebene sowie dauerhaft Schwer- und Leichtbeschädigte bildeten auf Dauer eine soziale Last. Von den Hunderttausenden mit psychischen Folgelasten wie Traumata und Kriegsneurosen wurde zeitgenössisch wenig gesprochen, sodass nur wenige Spezialkliniken für psychiatrische Behandlungsformen entstanden.
Auch die materielle Bilanz der Produktion war verheerend. Die Kriegsführung schadete allen Sektoren der Volkswirtschaft, denn die Friedensproduktion war ausnahmslos nicht zu halten bzw. wieder zu erreichen. Dieser Befund galt selbst für die kriegswichtigen Sektoren. Ökonomisch gesprochen, wurden Inputfaktoren wie Kapital, Arbeitskraft und Rohstoffe in eine Güterproduktion investiert, die nicht nur verpuffte, sondern millionenfachen Tod brachte. Ab 1915 wurden mehr als zwei Fünftel der Produktion für militärische Zwecke verwendet. Entsprechend sanken die Warenmengen, die für den zivilen Verbrauch zur Verfügung standen. Die Einsicht in die militärische Niederlage, die auf der erkannten Lähmung und Erschöpfung der Kriegswirtschaft beruhte, führte die OHL zum Waffenstillstandsangebot im September 1918.
Auf einen Blick
Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts gewann der Staatssozialismus an Popularität. Mit welchen Argumenten trat man auf allen politischen Seiten für die Stärkung der staatlichen Intervention in die Wirtschaft ein?
Inwiefern basierten die Konzepte der Kolonialwirtschaft auf den Vorstellungen des Protektionismus und der Autarkie?
Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs traf die deutsche Volkswirtschaft unvorbereitet. Aus welchen Gründen fehlten Konzepte und Elemente für eine effiziente Wirtschaftslenkung?
Mit der Kriegsrohstoffabteilung im preußischen Kriegsministerium begann die Bürokratisierung der Ressourcenlenkung. Inwiefern machte der Krieg einen Ad-hoc-Umbau der Ordnungspolitik und ein weitreichendes regulierendes Eingreifen staatlicher Stellen erforderlich?
Der Erste Weltkrieg begann mit einer Wirtschaftskrise, die sich zur einer Legitimitätskrise des Staates ausweitete. Weshalb lässt sich die Ernährungskrise als Verteilungskonflikt begreifen? Wie wirkte sich die Transportkrise aus? Inwiefern überhitzte die Wirtschaft durch das Hindenburg-Programm und seine bedingungslose Konzentration der Ressourcen auf die Rüstung?