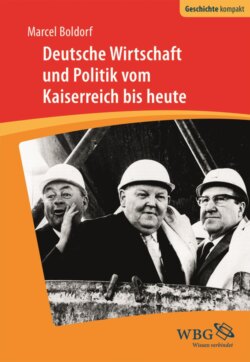Читать книгу Deutsche Wirtschaft und Politik - Marcel Boldorf - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorwort
ОглавлениеDas spannungsreiche Wechselverhältnis von Wirtschaft und Politik kann aus zwei Perspektiven angenähert werden: „Die Politik deformiert die Wirtschaft“ und „Die Wirtschaft treibt die Politik“. Beide Aphorismen hatten in Deutschland seit dem Kaiserreich Gültigkeit, wenn auch der erste Satz eine längere Periode starker Staatseingriffe und Regulierungen charakterisiert, während der zweite eher für das ausgehende 20. Jahrhundert steht. Dass die Wirtschaft die Politik treibt, ist eine jüngere Erfahrung, die heute insbesondere mit der auf den Finanzmärkten ausgelösten Wirtschaftskrise um das Jahr 2008 in Verbindung gebracht wird. Aber auch die Rekonstruktionsperiode nach dem Zweiten Weltkrieg mit ihrem Ausbau der Sozialstaatlichkeit kann mit dem Denkansatz, dass die Politik von der Wirtschaft getragen wird, erklärt werden. Politische Regulierungen, die zur Deformation der Wirtschaft führten, stehen dagegen vor allem mit den deutschen Diktaturen des 20. Jahrhunderts in Zusammenhang. Aber selbst unter marktwirtschaftlichen Bedingungen und relativ wirtschaftsliberalen Regierungen setzten sich Deregulierungen nur zögerlich durch, denn sie erforderten nicht nur ein politisches Umdenken, sondern hatten ein Anwachsen des allgemeinen Wohlstandes zur Voraussetzung.
Zwei Phasen relativ liberaler Wirtschaftsordnungen bilden den Rahmen für den Zeitabschnitt, den dieses Buch behandelt. Die weitreichende Liberalität in der Mitte des 19. Jahrhunderts war vom Vorbild des britischen Freihandels inspiriert. Der Staat enthielt sich der Wirtschaftsregulierung, oft war vom laisser faire die Rede. Eine gewisse Entsprechung fand diese Art des Wirtschaftsliberalismus im ausgehenden 20. Jahrhundert und wurde nun vielfach als Neoliberalismus bezeichnet. Mit der verstärkten Rezeption der Lehren der Chicagoer Schule wuchs ab den 1970er Jahren der Glaube an die Effizienz freier Märkte und die Skepsis gegenüber Staatseingriffen in die Wirtschaft nahm zu. Beispiele für den darauf folgenden Rückzug des Staates aus der Wirtschaft sind die Privatisierung ehemals staatlicher Wirtschaftsdomänen wie der Post, der Bahn oder der öffentlichen Versorgungsleistungen.
Zwischen den beiden liberalen bzw. nach Liberalisierung strebenden Perioden liegt unser Hauptbetrachtungszeitraum, der durch einen massiven staatlichen Interventionismus, kulminierend in den Kriegswirtschaftsordnungen, geprägt war. Die folgende Darstellung lässt die Wirtschaftsordnungen des ausgehenden 19. und des 20. Jahrhunderts sowie ihre politische Einbettung chronologisch Revue passieren. Im deutschen Kaiserreich entstand der Wille zu ordnungspolitischen Eingriffen in die Wirtschaft. Diese Tendenz verstärkte sich schlagartig mit dem Eintritt in den Ersten Weltkrieg. Dabei setzte der schrittweise Übergang in eine gelenkte Kriegswirtschaft Prozesse in Gang, die teilweise längerfristige Wirkungen entfalteten. Die Schuldenfinanzierung des Ersten Weltkriegs kulminierte in der Inflationskrise des Jahres 1923. Ein System der Bewirtschaftung wurde für Rohstoffe und andere wirtschaftliche Inputfaktoren errichtet; spätestens mit dem Hilfsdienstgesetz von 1916 unterlag der Arbeitsmarkt einer umfassenden staatlichen Lenkung. In der Demobilisierungsphase hoben die demokratischen Regierungen zwar manche Regulierung auf, doch verblieb die Wirtschaft aufgrund der geschaffenen Zwänge, zu denen sich neue wie die Reparationsbelastung gesellten, in einem engen Korsett. Hinzu kamen starke außenwirtschaftliche Einflüsse, die eine erfolgreiche Rekonstruktion behinderten: Weltweit ergriffen viele Staaten protektionistische Maßnahmen, die bis in die 1930er Jahre zu einer Bilateralisierung der Wirtschaftsbeziehungen führten. Die 1929 beginnende Weltwirtschaftskrise lässt sich als Kulminationspunkt einer Entwicklung deuten, in der die wirtschaftlichen Zwänge die politischen Handlungsspielräume immer mehr einengten. In der vorgestellten Lesart war die Krise jedoch vielmehr ein Produkt politisch zu vertretender Regulierungen, die mit einem Konjunktureinbruch zusammentrafen. Auch Letzterer kann als Ergebnis des politisch gewollten Protektionismus gedeutet werden. Mithin trieb nicht die Wirtschaftskrise der späten zwanziger Jahre die Politik, sondern es waren umgekehrt politische Entscheidungen, die als Ursache der Krise auszumachen sind.
In den 1930er Jahren setzte sich die Regulierungspolitik im internationalen wie im deutschen Kontext fort; ihr wichtigstes Kennzeichen blieb die Abkehr von einem multilateralen Handelssystem. In seiner spezifischen Zuspitzung stellte das NS-Regime die Weichen auf ein autarkes Wirtschaftssystem, das binnen weniger Jahre in eine umfassendere Kriegswirtschaft überführt wurde, als sie der Erste Weltkrieg gekannt hatte. Unter NS-Hegemonie fand nicht nur eine Deformation der Wirtschaft im Deutschen Reich statt, sondern große Teile Europas wurden in die erzwungene Umgestaltung einbezogen. Die Kriegsführung des NS-Machtapparates beruhte erneut auf Schuldenfinanzierung, zu der eine Vielzahl europäischer Länder über Besatzungskosten und ungleiche Handelsbedingungen zwangsweise Beiträge leisteten.
Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist als Periode der schrittweise erfolgenden Deregulierung zu beschreiben, zumindest wenn man die westdeutsche Entwicklung betrachtet. Der Startpunkt war die befreiende Wirkung der Währungs- und Wirtschaftsreform des Jahres 1948. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass in der Rekonstruktionsphase erst allmählich alle Wirtschaftsbeschränkungen, z.B. auf dem Kapital- oder Wohnungsmarkt, aufgehoben wurden. Das wirtschaftliche Wachstum, das historisch beispiellos war, eröffnete der Politik erhebliche Spielräume, insbesondere im Hinblick auf die Umverteilung des Volkseinkommens z.B. durch die Sozialversicherung. Erstmals seit Jahrzehnten stieg der materielle Lebensstandard, nachdem die Reallöhne 1950 noch kaum über dem Niveau von 1913 lagen.
Prinzipiell waren viele Elemente, die man mit dem Wirtschaftsaufschwung der Bundesrepublik verbindet, auch für Ostdeutschland gültig, wenn auch in abgeschwächter Form und nur im ersten Nachkriegsjahrzehnt. Keinesfalls galt dies aber für die wirtschaftliche Liberalisierung, denn mit der Errichtung der Planwirtschaft wurde schon in der SBZ ein System eingerichtet, das die im frühen 20. Jahrhundert angewandten Regulierungen bei Weitem übertraf. Zunächst erwies es sich zwar für die Generierung von extensivem Wachstum als dienlich, scheiterte aber beim Übergang zu intensivem Wachstum. Die im Vergleich zur Bundesrepublik stark gebremste Wohlstandsentwicklung ließ die treibende Kraft der Wirtschaft immer mehr verebben. Gegen Ende der staatlichen Existenz der DDR mussten zur Sicherung des Konsums immer höhere Subventionssummen aufgewandt werden, was zulasten der Investitionen ging und die dem Plansystem immanente Wachstumsschwäche perpetuierte.
Die überdurchschnittlichen Wachstumsraten der Bundesrepublik hielten bis in die 1970er Jahre an, als externe Schocks für eine Abschwächung des Wachstums sorgten, was sogleich als Krisenphänomen gedeutet wurde. Mit dem Übergang zum Monetarismus fand eine weltweite Deregulierung und Liberalisierung der Märkte statt, die nun auch Bereiche betraf, die sich vorher geschützt unter staatlicher Obhut befanden. Die wirtschaftliche Liberalisierung entzog der Politik Handlungsmöglichkeiten, zumal die günstigen Effekte überdurchschnittlicher Wachstumsraten zunehmend entfielen. Die für das Jahrhundert kennzeichnende Entwicklung kehrte sich um: Die Wirtschaft, insbesondere die Finanzwirtschaft, trieb die Staatspolitik, die ihrerseits beträchtliche Mittel aufzubringen hatte, um das fragile kapitalistische Wirtschaftssystem zu stützen. Hauptkennzeichen dessen war die ab Mitte der 1970er Jahre entstehende Massenarbeitslosigkeit, die das staatliche Engagement dauerhaft herausforderte.
Grundsätzlich funktioniert die Wirtschaft auch ohne Politik, obwohl die Politiker oft das Gegenteil glaubhaft machen wollen. Wirtschaftspolitische Entscheidungen, die begrenzt gedacht waren, wirkten sich manchmal anders auf die Wirtschaft aus, als es die Akteure beabsichtigten. Allerdings scheint wirtschaftliche Entwicklung per se zu wachsender Staatspräsenz in der Wirtschaft und größerer politischer Einflussnahme zu führen. Das nach dem deutschen Ökonomen Adolph Wagner (1835–1917) benannte Gesetz der wachsenden Staatstätigkeit beruht auf seiner Beobachtung, dass der Anteil der Staatsausgaben am Sozialprodukt mit fortschreitender Entwicklung ansteigt. Die der industriellen Gesellschaft eigene Komplexität forderte staatliches Handeln in vielfältiger Weise heraus. Zudem bewirkte die Entwicklung der Volkswirtschaften zu Dienstleistungsgesellschaften, dass der Staat immer mehr Leistungen verbrauchte und somit zu einem großen Teil selbst für die Entstehung des Sozialprodukts sorgte. Auch diese theoretischen Überlegungen zum säkularen Anstieg der Staatstätigkeit fließen in die folgende Darstellung zur Expansion der Wirtschaftspolitik ein.