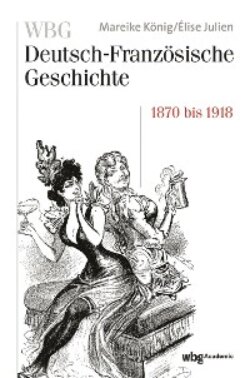Читать книгу WBG Deutsch-Französische Geschichte Bd. VII - Mareike König - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Herausforderungen und Ambitionen
ОглавлениеRepublik und Monarchie denken und gestalten
Das Deutsche Kaiserreich und die Dritte Republik in Frankreich standen nach 1870/71 vor der Herausforderung, den neu entstandenen Staat bzw. das neue Regime im Inneren aufzubauen und zu festigen. Denn mit der Proklamation der Dritten Republik am 4. September 1870 war ihre Etablierung und Konsolidierung genauso wenig abgeschlossen wie der deutsche Einigungsprozess nach der formalen Gründung des Kaiserreichs am 18. Januar 1871 in Versailles. Beide Länder traten in einen dauerhaften und vielschichtigen Prozess der Nationalstaatsbildung und der nationalen Integration: Neben der Aushandlung der jeweiligen politischen Ordnung standen die Festigung eines nationalen Gemeinschaftsbewusstseins und die Loyalitätssicherung der Bevölkerung im Mittelpunkt der Bemühungen. Dies sollte über vereinheitlichte wirtschaftliche, rechtliche und kulturelle Ordnungen bewirkt werden. Schule und Militärdienst waren wichtige Erziehungsinstanzen, die fast alle Schichten und im Fall der Schulpflicht auch die weiblichen Bevölkerungen erreichten. Symbole, Festtage und eine offizielle Geschichte sollten die eigene Vorstellung von Nation und Nationalstaat gegenüber konkurrierenden Entwürfen festigen.
Für das Deutsche Kaiserreich lag eine große Herausforderung beim Prozess der Nationsbildung im Zusammenwachsen der deutschen Einzelstaaten, die nur wenige Jahre zuvor noch Krieg gegeneinander geführt hatten1. Ein Großteil der Bevölkerung zeigte sich gegenüber dem neuen Reich eher gleichgültig und nicht alle waren mit der preußisch dominierten Lösung zufrieden. Während Nationalliberale, Protestanten und Teile der Konservativen in Preußen, den norddeutschen Ländern und Sachsen die Einheit begrüßten, herrschte überall dort Enttäuschung, wo man sich eine „großdeutsche Lösung“ unter Einschluss Österreichs erhofft hatte, etwa bei den süddeutschen Liberalen, bei süddeutschen und sächsischen Demokraten, sowie mit regionalen Unterschieden bei Teilen der Katholiken2. Enttäuscht waren besonders Anhänger der freiheitlichen Nationalbewegung sowie die sozialistischen Arbeiterbewegungen, die ihre Hoffnungen auf eine demokratische Verfassung und auf Volkssouveränität gesetzt hatten, und sich stattdessen in einer konstitutionellen Monarchie mit begrenzten politischen Partizipationsmöglichkeiten wiederfanden. Das Kaiserreich stand darüber hinaus vor der Frage, wie mit den polnischen, dänischen und französischen Minderheiten der Grenzregionen umzugehen war. Reichskanzler Otto von Bismarck erklärte die ihm missliebigen Gruppen wie nationale Minderheiten, Sozialisten und Katholiken zu „Reichsfeinden“. Karrieren in der kaiserlichen Regierung, in Verwaltung und Armee waren für Sozialisten, Linksliberale, Katholiken und Juden gleichermaßen ausgeschlossen. Darüber hinaus bestimmten wirtschaftliche Spannungen den politischen und sozialen Alltag im Reich, dessen Gesellschaft von starken sozialen Klassenunterschieden gezeichnet war3.
Als Reichskanzler prägte Otto von Bismarck vor allem in den Anfangsjahren das politische System und die politische Kultur des Kaiserreiches. Sein Gestaltungsspielraum war jedoch letztlich begrenzt, denn wirtschaftliche und soziale Entwicklungen lagen außerhalb seines Einflussbereichs4. Dies gilt etwa für die „konservative Wende“ von 1878/79, mit der die liberale Ära zu Ende ging. Die Bedeutung dieser von der Forschung früher als „Zweite Reichsgründung“ bezeichneten Wende wird heute relativiert, obschon sie nicht folgenlos blieb: Im Anschluss kam es zur dauerhaften Spaltung der Nationalliberalen und zu einer konservativen Ausrichtung der Innenpolitik. Die nicht zuletzt aus Bismarcks Exklusionspolitik resultierende Zerklüftung der deutschen Gesellschaft hielt trotz eines Rückgangs der Spannungen nach seiner Entlassung im März 1890 bis in den Ersten Weltkrieg hinein an5. So war das Misstrauen gegenüber Elsass-Lothringern, Sozialdemokraten und Juden im Ersten Weltkrieg selbst im „Burgfrieden“ weiterhin virulent.
Die Integration der Deutschen erfolgte nicht nur auf der Basis kultureller Werte wie gemeinsamer Sprache und Geschichte, die das Nationalgefühl über weite Strecken des 19. Jahrhunderts geprägt haben. Mit dem Fortschreiten beim Erlass von Reichsgesetzen und Rechtsordnungen sowie mit dem Aufbau einer eigenständigen Reichsverwaltung und der Vereinheitlichung von Münzen, Maßen und Gewichten nahmen die unitarischen Tendenzen im Kaiserreich weiter zu6. Die Schaffung eines nationalen Rechts- und Wirtschaftsraums mit weitreichenden und im internationalen Vergleich modernen Reformen war ein langsamer Prozess, der sich beispielsweise bei der Einigung auf ein national verbindliches Zivilrecht, dem zu großen Teilen bis heute gültigen Bürgerlichen Gesetzbuch, bis 1900 hinzog. Der gemeinsame Rechts- und Wirtschaftsraum war die Voraussetzung für die ab den 1890er-Jahren einsetzende Hochindustrialisierung, die neben der Schwerindustrie neue rapide expandierende Branchen wie Chemie und Elektrotechnik hervorbrachte. Er trug darüber hinaus gemeinsam mit dem Ausbau des Eisenbahn- und Postnetzes sowie der Freizügigkeit zwischen den deutschen Ländern maßgeblich zum Aufbau eines gemeinsamen Nationalverständnisses im Alltag bei7. So mussten Reisende in Deutschland noch 1874 die Eisenbahnzeit inklusive ihrer voraussichtlichen Ankunftszeit mühsam auf der Basis verschiedener großstädtischer, amtlich überwachter Ortszeiten selbst errechnen. Erst 1893 wurde eine einheitliche amtliche Normalzeit eingeführt, gefördert durch die zeitlich vorgelagerte internationale Standardisierung8. Trotz dieser Vereinheitlichungen bestand eine große regionale wie lokale politische, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Vielfalt im Kaiserreich9.
In Frankreich waren in der Folge der Niederlage im Krieg gegen Deutschland und der blutigen Niederschlagung der Kommune im Mai 1871 zahlreiche ideologische und soziale Gegensätze aufgebrochen. Durch den Regimewechsel von der Monarchie zur Republik war der politische Bruch größer als im Kaiserreich, obgleich es in Verwaltung, Wirtschaft und bei soziokulturellen Praktiken wie Wahlen oder öffentlichen Feiern Kontinuitäten zwischen Second Empire und Dritter Republik gab10. Neben den Auseinandersetzungen zwischen Republikanern und Monarchisten verschiedener Couleur um die „richtige“ Staatsform war das politische Leben der Dritten Republik geprägt durch die Haltung zum Katholizismus, der von verschiedenen Seiten instrumentalisiert wurde. Die Vorstellung der deux France, eines zweigeteilten Frankreichs, beherrschte die Diskussionen. Demnach standen sich ein republikanisches, fortschrittliches und laizistisches Frankreich und ein konservatives, monarchistisches und klerikales Frankreich gegenüber, wobei eine große Bandbreite an Einstellungen zwischen diesen beiden Polen herrschte11. Die Herausforderung für die Republikaner bestand darin, das Trauma der Spaltung nach verlorenem Krieg und Bürgerkrieg zu überwinden und die deux France miteinander auszusöhnen. Es galt, die Republik als Staatsform zu festigen und neue Eliten in Politik, Bildung, Verwaltung und Justiz zu etablieren, die für ein republikanisches, antiklerikales und patriotisches Frankreich eintraten. Im Rahmen der Republikanisierung und Säkularisierung wurden Hunderte von klerikal oder monarchistisch eingestellten Beamten entlassen und Magistrate suspendiert. Insbesondere im Bereich der Verwaltung kam es zu weitreichenden und konflikthaften Säuberungen, die selbst 1914 noch nicht beendet waren12.
Die republikanischen Ideen und Werte sollten über Parlamentswahlen, die 1882 eingeführte staatsweite Schulpflicht mit kostenlosem Unterricht für Mädchen und Jungen, Symbole der Republik, eine gemeinsame Nationalsprache in der Nachfolge regionaler Dialekte sowie über republikanische Reden und Praktiken bis in die ländlichen Gegenden getragen werden13. Eine zentrale Rolle bei der Integration spielte darüber hinaus der Militärdienst, der in Frankreich 1872 mit Blick auf die Regelungen in Preußen verpflichtend eingeführt wurde, mit einer bis 1905 gültigen Ausnahme für bestimmte Berufsgruppen wie Lehrer, Ärzte und Rechtsanwälte14. Die Armee galt als zentrale Stütze für die neue demokratische Ordnung: Sie sollte die Einheit und die Grandeur der Nation garantieren und das Vaterland vor Invasionen schützen15. Internationales Prestige hofften die französischen Regierungen durch die Kolonialpolitik zu erlangen.
Wie im Deutschen Kaiserreich erfolgte eine nationale Integration über die Kommunikationsrevolution mit der Entstehung der Massenmedien, für die die Alphabetisierung durch die Schulpflicht die allgemeine Voraussetzung schuf. Über Wirtschaftsbeziehungen, Arbeitsmigration und Abwanderung in die Städte zirkulierten Menschen, Ideen und Güter und wurden ländliche Gebiete mit den Metropolen und deren Kulturen vernetzt. Der plan Freycinet sorgte ab 1879 für eine enge Anbindung der Regionen über den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Mit der Erschließung neuer Eisenbahnstrecken, dem Bau neuer Kanäle, Hafenbecken und Brücken sowie dem Ausbau und der Befestigung von Straßen sollten die nicht industrialisierten Gegenden an das Verkehrsnetz angeschlossen werden16. Eine Herausforderung stellten die zu Beginn der 1880er-Jahre einsetzende Wirtschaftskrise und die daraus resultierende Verschlechterung des sozialen Klimas in der Bevölkerung dar, in deren Folge populäre Protestbewegungen wie der Boulangismus Auftrieb erhielten. Ähnlich wie im Deutschen Kaiserreich, obgleich weniger emotional aufgeladen, bildeten die nationale und regionale Ebene – in Frankreich mit grande patrie und petite patrie treffend bezeichnet – keinen Gegensatz im Identitätsbezug und keine hierarchische Beziehung, sondern bedingten und stützten sich gegenseitig17. Überdies wurde die regionale Vielfalt durch die nationalstaatliche Vereinheitlichungspolitik wenig eingeschränkt. Regionale Akteure besaßen in Kommunalpolitik, Selbstverwaltung und Zivilgesellschaft durchaus eigene Handlungsoptionen18.
Im Zuge der Industrialisierung und der Verkehrs- und Kommunikationsrevolution spielten Migrationsbewegungen eine wichtige Rolle in beiden Gesellschaften. Ein Großteil waren saisonale Wanderungen zumeist zwischen den Städten und ihrem unmittelbaren Umland. In Zeiten wirtschaftlicher Depression stieg die Fernwanderung an, die im Kaiserreich vor allem von Ostpreußen ins industrialisierte Rheinland und zu den Hochöfen des Ruhrgebiets führte. Rund 2,85 Millionen Menschen migrierten während des Kaiserreichs nach Übersee19. Ab Mitte der 1890er-Jahre stieg die Nachfrage nach Arbeitskräften im Kaiserreich, sodass die Auswanderung zurückging, während die transnationale Zuwanderung anstieg. Der Großteil der landwirtschaftlichen Wander- und Saisonarbeiter kam aus Osteuropa, vor allem aus Polen, Russland, Galizien sowie aus Italien20. Zu diesem Zeitpunkt war Frankreich bereits ein Einwanderungsland: Zwischen 1872 und 1886 hatte sich dort die Anzahl der Ausländer verdoppelt. Über eine Millionen Einwanderer kam 1881 nach Frankreich, zumeist aus Belgien und Italien, aber auch aus Spanien und der Schweiz21. Mit 11,9 % stellten die deutschsprachigen Einwanderer 1911 nach Italienern und Belgiern in Frankreich die drittgrößte Gruppe22. Umgekehrt gab es keine nennenswerte Einwanderung aus Frankreich nach Deutschland, wohl aber Reisen aus geschäftlichem, wissenschaftlichem oder touristischem Anlass23. An den französischen Industriestandorten ließ die Wirtschaftskrise in den 1880er- und verstärkt ab den 1890er-Jahren Fremdenfeindlichkeit und gewaltvolle Ausschreitungen zwischen französischen und ausländischen Arbeitern ansteigen24.
Vor dem Ersten Weltkrieg hatten sich die Zuwanderungszahlen in beiden Ländern angeglichen: Rund 1,16 Millionen Einwanderer kamen 1911 laut offiziellen Statistiken nach Frankreich. Nach Deutschland waren es 1910 etwa 1,26 Millionen, wobei nicht alle Saisonarbeiter und temporären Migranten erfasst sein dürften25. Die transnationalen Migrationen verbunden mit der demografischen Entwicklung – in Deutschland stark ansteigend, in Frankreich stagnierend – hatten in beiden Ländern Auswirkungen auf den Nationalismusdiskurs und auf die Ausgestaltung des Staatsangehörigkeitsrechts. In der Dritten Republik war das Gesetz von 1889 vor dem Hintergrund der demografischen Stagnation, dem Arbeitskräftemangel und dem Ziel, Wehrpflichtige zu gewinnen, überwiegend vom Territorialprinzip (ius soli) geprägt, womit in Frankreich geborene Kinder von Einwanderern die französische Nationalität erhielten. Das deutsche Staatsbürgergesetz von 1913 schrieb dagegen vor allem das Abstammungsprinzip (ius sanguinis) mit dem Ziel einer Homogenisierung des Nationalstaats fest. Beide Staatsbürgergesetze waren jedoch Mischformen dieser idealtypisch dargestellten Prinzipien und durch internationale Transfers bei der Ausarbeitung der Gesetzestexte entstanden26.
Verfassungen und politische Kulturen
Einen starken Kontrast zwischen beiden Ländern bildeten die politischen Ordnungen, mit der konservativ-autoritären und föderalen Monarchie in Deutschland auf der einen und der bürgerlich-parlamentarischen und zentralistisch ausgerichteten Republik in Frankreich auf der anderen Seite27. Das Deutsche Kaiserreich bestand als föderativer Verbund aus 22 Staaten und drei freien Städten, die in Größe, Bevölkerung, Wirtschaft und Machtanspruch sehr unterschiedlich waren. Die Einzelstaaten behielten ihre Regierungen, Landtage und Verwaltungen und waren für den überwiegenden Teil der Politikfelder wie für die Umsetzung der reichseinheitlichen Bestimmungen verantwortlich. Die föderative Struktur zog eine relative Schwäche des Reiches nach sich, das von den Matrikularbeiträgen seiner Mitgliedsstaaten abhängig war und selbst abgesehen von einigen Verbrauchssteuern wie auf Salz, Tabak und Rübenzucker keine Reichssteuern erhob28.
Die Reichsverfassung von 1871 basierte auf derjenigen des Norddeutschen Bundes von 1867, die, geprägt von Bismarck, unter Berücksichtigung preußischer Machtinteressen und mit einer starken Stellung für die Exekutive, d.h. Kaiser und Reichskanzler, erarbeitet worden war29. Der Reichskanzler war bis 1918 fast durchgehend in Personalunion zugleich preußischer Ministerpräsident und zumindest in der Bismarckzeit die „maßgebliche Instanz des politischen Systems“30. Der Kanzler war dem Reichstag zwar Rechenschaft schuldig, hing aber allein vom Vertrauen des Kaisers ab. Der Reichstag hatte jedoch ein Gesetzinitiativrecht und musste allen Gesetzen sowie dem Reichshaushalt zustimmen und hatte damit wichtige Einflussmöglichkeiten31. Der Bundesrat hatte die formelle Souveränität inne und arbeitete Gesetzesvorlagen aus, über die der Reichstag abstimmte. Der Bundesrat konnte mit Zustimmung des Kaisers den Reichstag auflösen. Bismarck drohte mit dieser Option, wenn die Abgeordneten die Zustimmung zu Gesetzen verweigerten. So forderte Bismarck 1887 mit taktischem Hinweis auf die durch General Boulanger geschürte Kriegsstimmung in Frankreich einen neuen siebenjährigen Militäretat, den ihm der Reichstag verwehrte. Der Bundesrat folgte Bismarck, löste den Reichstag auf und setzte Neuwahlen an. Die Ausübung und Erweiterung der parlamentarischen Mitbestimmungs- und Kontrollrechte war ein innenpolitisch beherrschendes Dauerthema, das insbesondere vonseiten der Liberalen verfolgt wurde.
Der Kaiser berief den Bundesrat und den Reichstag ein, ernannte und entließ den Kanzler. Er hatte den Oberbefehl über Heer und Marine. Das Militär war damit außerhalb der konstitutionellen Verfassung, denn es unterlag nicht der Mitbestimmung und der Kontrolle durch das Parlament32. Kaiser Wilhelm II. versuchte während seiner Regierungszeit ab 1888, den eigenen Machtbereich zu vergrößern und die Exekutive stärker in seiner Person zu bündeln. Das tatsächliche Ausmaß der Machterweiterung durch sein „persönliches Regiment“ ist in der Forschung genauso umstritten wie die Reformfähigkeit des Kaiserreichs33.
In Frankreich begann 1870 der komplexe Prozess der Etablierung und Festigung des republikanischen Regimes, der institutionelle sowie soziokulturelle Aspekte umfasste34. Trotz einer republikfeindlichen Konstellation im ersten Parlament im Februar 1871, in dem rund zwei Drittel der Abgeordneten bekennende Monarchisten waren, konnten republikanische Institutionen aufgebaut werden, ein Paradox, das sich mit der Komplexität der damaligen politischen Positionen erklären lässt35. Es lag vor allem an der Spaltung der Monarchisten in drei Lager – Legitimisten, Orléanisten und Bonapartisten –, die jeweils unterschiedliche Dynastien und konkurrierende Vorstellungen von politischer Legitimität vertraten, dass die Versuche zur Restauration der Monarchie scheiterten36. Integrierend und stabilisierend auf die neue Staatsform wirkte die vorzeitige Zahlung der Kriegsschulden an Deutschland noch unter der Präsidentschaft von Adolphe Thiers. Die rasche Begleichung der Reparationen in zwei statt fünf Jahren stellte nicht nur das politische und wirtschaftliche Leistungsvermögen der jungen Republik unter Beweis, sondern hatte zugleich den stufenweisen Abzug der deutschen Truppen bis September 1873 zur Folge. Die sogenannten Befreiungsanleihen (emprunts de la libération) mobilisierten zu diesem Zweck in erheblichem Maß das Kapital von Kleinanlegern, die der Republik damit einen Vertrauensvorschuss gaben.
Eine tatsächliche Verfassung wurde für die Dritte Republik nicht ausgearbeitet. Auf Betreiben der Republikaner wurden 1875 drei Verfassungsgesetze (lois constitutionelles) erlassen, jedoch ohne Präambel oder Doktrin. In diesen Gesetzen, die im Wesentlichen bis 1940 in Kraft blieben, wurden die Organisation der Staatsgewalt, des Senats und die Beziehungen der Staatsgewalten untereinander geklärt. Die Legislative bestand demnach mit der Chambre des députés und dem Senat aus zwei Kammern, die gemeinsam die Assemblée nationale bildeten. In Budgetfragen lag das Vorrecht bei der Chambre des députés mit rund 600 Abgeordneten, die auf vier Jahre gewählt wurden, gegenüber dem Senat mit 300 auf neun Jahre gewählten Senatoren. In allen anderen Fällen wurden die legislativen Aufgaben gemeinsam wahrgenommen37. Gesetzesinitiativen wurden dabei von der einen zur anderen Kammer geschickt, bis eine Fassung eine Mehrheit in beiden Kammern erhielt.
Die Regierung war den Kammern gegenüber verantwortlich und von den Mehrheiten darin abhängig, was zu häufigen Kabinettswechseln führte. Oftmals hatten sich die Mehrheitsverhältnisse jedoch gar nicht geändert und die neuen Regierungen wurden weitgehend mit identischem Personal gebildet. Destabilisierend wirkte auf die Regierungen, dass die Abgeordneten aufgrund der verhältnismäßig schwach ausgeprägten Parteienlandschaft bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts in ihrem Abstimmungsverhalten häufig wechselnde Koalitionen bildeten38. Sie fühlten sich vor allem ihrem Wahlkreis verpflichtet, weniger einer Parteiorganisation oder einem Parteiprogramm. Die in die Kammer gewählten Abgeordneten waren zunächst mehrheitlich Adelige und Notabeln, was nicht der sozialen Struktur der Wählerschaft entsprach. Eine stärkere Durchmischung entstand ab 1900, als mit den Abgeordneten der sozialistischen Parteien Männer aus sozial niedrigen und bildungsfernen Schichten Mandate erhielten39.
Die Kammern wählten in einer gemeinsamen Sitzung den Präsidenten der Republik auf sieben Jahren, der wiederum den Ministerpräsident (président du Conseil) zur Kabinettsbildung ernannte. Der Präsident hatte eine starke Stellung gegenüber der Regierung, obgleich seine Entscheidungen jeweils von einem Minister gegengezeichnet werden mussten40. Er ernannte Beamte, Botschafter und Offiziere, berief die Minister und leitete den Ministerrat. Er vertrat die Republik nach außen. Vom Parlament verabschiedete Gesetze konnte er zurückweisen und zur erneuten Beratung an die Abgeordneten zurückgeben. In der Praxis entwickelte sich die Dritte Republik nicht zuletzt aufgrund der Zerstrittenheit der Konservativen weniger präsidial, als diese Regelungen es zugelassen hätten. Die parlamentarische Version des republikanischen Regimes mit einer starken Volksvertretung setzte sich durch und die Bevölkerung wählte mehrheitlich republikanisch. Abgesehen von der crise du 16 mai (1877) unter dem monarchistischen Präsidenten Marschall Patrice de Mac-Mahon gab es keine weiteren Versuche eines Präsidenten, die Kammer aufzulösen oder ein Gesetz zurückzuleiten41.
Mit der Übernahme von Präsidentschaft und Regierung durch die Republikaner waren knapp zehn Jahre nach der Proklamation der Republik alle Institutionen in republikanischer Hand. Die Freiheitsgesetze (libertés fondamentales) wie die Presse- und Versammlungsfreiheit und die Rechte der Kommunen (1881), die Wiedereinführung der Ehescheidung (1884) sowie die Reform des code pénal und die Revision der Verfassung von 1884 festigten das Regime in seiner demokratischen Ordnung42. Mit der Verankerung der politischen Symbole der neuen Republik ab 1879, der Amnestie für die Verurteilten des Kommuneaufstands und dem Umzug des Parlaments von Versailles nach Paris 1880 nahm, so François Furet, die Französische Revolution von 1789 nach rund 90 Jahren ihr symbolisches Ende und „kehrte in den Hafen ein“. Das Bild einer „République en danger“, die gegen Angriffe von links und rechts verteidigt werden musste, bestand jedoch weiter und wurde zeitgenössisch bis 1914 zu einer verbreiteten Vorstellung, die von den Republikanern bisweilen bewusst geschürt wurde43. Bedrohungen zeigten sich neben den gefürchteten Staatsstreichen durch monarchistische, nationalistische und klerikale Kräfte bei verschiedenen Finanzskandalen wie dem Panamaskandal, in der Boulangerkrise, den anarchistischen Attentaten in den 1890er-Jahren sowie vor allem in der Dreyfusaffäre44. So blieb die innere Geschlossenheit für die junge Republik ein zentrales Thema, das ab der Jahrhundertwende im Zusammenhang mit dem Streben nach außenpolitischem Prestige weiter an Bedeutung gewann. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte sich die Dritte Republik jedoch als funktionierende Demokratie bewiesen, die in der Bevölkerung mehrheitlich Rückhalt genoss. Es war ihr gelungen, republikanische Praktiken und Werte in der Gesellschaft zu verankern, in den Städten genauso wie im ländlichen Raum, der bis dahin stark von der Loyalität zu den traditionellen Eliten geprägt gewesen war. Einst als Subversion und Aufstand gegen die etablierte Ordnung wahrgenommen, stand das republikanische Regime nun selbst für diese Ordnung45. Daneben zeigt die neuere Forschung kritische Aspekte des republikanischen Modells der Integration auf, das durchaus widersprüchlich war: zugleich egalitär und elitär, universalistisch und nationalistisch. So waren Frauen, (streikende) Arbeiter, Einwanderer, Vagabundierende und Kolonisierte in Teilen von republikanischen Partizipationsmöglichkeiten wie Wahlen oder politische Repräsentation ausgeschlossen46.
Integration über Wahlen
Im Deutschen Kaiserreich galt für die Wahlen zum Reichstag das allgemeine, gleiche, direkte und geheime Wahlrecht, das aus der Verfassung des Norddeutschen Bundes übernommen worden war47. Wählen durften deutsche Männer über 25 Jahre. Frauen blieben vom Wahlrecht auf Landes- wie auf Reichsebene ausgeschlossen. Europaweit handelte es sich um ein vergleichsweise modernes und demokratisches Wahlrecht, das in dieser Form nur noch in Frankreich und Griechenland galt48. Jedoch unterschied es sich deutlich von den Wahlrechten in den deutschen Einzelstaaten, die durch soziale Kriterien eingeschränkt oder wie das preußische Dreiklassenwahlrecht ungleich gewichtet waren. Bismarck hatte das moderne Wahlrecht auf Reichsebene eingeführt, um die konservativ eingestellten ärmeren Wählerschichten der ländlichen Regionen als Gegengewicht zu den liberalen Städtern zu gewinnen. Es entwickelte sich wider Erwarten zum Hauptmotor für die politische Partizipation im Kaiserreich49.
Der Reichstag war das „Symbol der politischen Nation“50. Über Reden im Reichstag und über Wahlveranstaltungen wurde ausführlich in der Presse berichtet. Insbesondere die Wahlkämpfe machten „das Reich als politische Einheit erfahrbar“51. Die stark zunehmende Wahlbeteiligung von 51 % bei den ersten Reichstagswahlen 1871 über 77,5 % im Jahr 1887 auf 85 % im Jahr 1912 ist ein Zeichen für die Fundamentalpolitisierung der Bevölkerung während des Kaiserreichs52. Sie entsprach der Wahlbeteiligung in anderen europäischen Ländern wie etwa in Frankreich, wo sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts durchschnittlich zwischen 70 % und 85 % lag. Die Politisierung zeigte sich darüber hinaus in der Herausbildung von Massenparteien und ihren Wahlkampagnen sowie bei demokratischen Praktiken wie Wahlen und der Abwehr von Wahlbeeinflussung, Versammlungen, öffentlichen Reden und Debatten. Ebenso waren die zahlreichen politischen Vereine, Gewerkschaften, Agitationsverbände, industriellen, agrarischen und mittelständischen Interessenverbände sowie Demonstrationen, Proteste, Kundgebungen und die vielfältigen Reformbewegungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts Zeichen für die zunehmende Politisierung und den Wunsch nach politischer Partizipation der Gesellschaft.
In Frankreich galt das allgemeine Wahlrecht für Männer seit 1848, mit bestimmten Einschränkungen während des Zweiten Kaiserreichs53. Zu Beginn der Dritten Republik war daher bereits eine kulturelle Praxis des Wählens verbreitet, auf die der junge Staat aufbauen konnte. Wie im Kaiserreich hatte gerade der Akt des Wählens erhebliche nationsbildende Wirkung. Die landesweit zeitgleich stattfindende Stimmabgabe machte den Wahltag zum gemeinsamen Festtag, bei dem nicht nur die Nation als Ganzes, sondern auch die Bedeutung der eigenen Stimmabgabe erfahrbar wurde54. Das allgemeine Wahlrecht hatte in Frankreich zudem eine erzieherische Funktion: Es sollte die politische und soziale Einheit des Landes symbolisieren. Der deutliche Partizipations- und Erziehungsgedanke findet sich im stärker obrigkeitsstaatlich geprägten Deutschen Kaiserreich von offizieller Seite her nicht55. In Frankreich durften Männer ab 21 Jahren wählen, wählbar waren sie ab 25 Jahren. Frauen hatten in der Dritten Republik kein Wahlrecht und sollten es in Frankreich erst 1944 bekommen. Bei den Männern waren Militärs, Gefangene, Vagabundierende und die Kolonialbevölkerung (mit Ausnahme der älteren Kolonien Antillen, Réunion, Senegal, Cochinchina und Französisch-Indien) ebenfalls vom Wahlrecht ausgenommen. In Algerien, als Siedlungskolonie eine Ausnahme im französischen Kolonialimperium, wählten ansässige französische Staatsbürger ebenfalls, nicht jedoch die durch den code de l’indigénat von 1875 zu französischen Untertanen (sujets) erklärte einheimische Bevölkerung56. Mit Hégésippe Jean Légitimus aus Guadeloupe wurde 1898 erstmals ein schwarzer Abgeordneter in die Kammer gewählt. Die Ausnahme der Militärangehörigen vom Wahlrecht diente dazu, die Armee als unpolitischen Raum zu konstituieren. Darin sowie in der parlamentarischen Kontrolle der Armee unterschieden sich das Deutsche Kaiserreich und die Dritte Republik grundlegend voneinander.
Obwohl sie kein Wahlrecht hatten, nahmen Frauen in beiden Ländern intensiv an politischen Aktivitäten teil: Sie sammelten Spenden für politische Zwecke, organisierten Veranstaltungen und Wohltätigkeitsunternehmungen und verbreiteten Flugblätter und Werbematerialien für die Parteien57. In Preußen war ihnen bis April 1908 die Mitgliedschaft in politischen Vereinen und Parteien verboten. Manche Aktivistinnen setzten sich jedoch über das Mitgliedschaftsverbot hinweg, etwa die Frauenrechtlerin und Publizistin Lily Braun, die per Schlitten zu Wahlveranstaltungen im ostelbischen Gebiet reiste und dort Reden für die SPD hielt58. Aufstrebend war ab der Jahrhundertwende die Frauenemanzipationsbewegung, die sich für Gleichberechtigung, bessere Bildungsmöglichkeiten, Zugang zu qualifizierter Berufstätigkeit und insbesondere für das Frauenwahlrecht einsetzte. Diese Debatten wurden international geführt, bei den sozialistischen Parteien genauso wie in der bürgerlichen Frauenbewegung. In Deutschland dominierten dabei vermögende, gebildete, protestantische Frauen, in Frankreich Frauen aus dem mittleren und dem Kleinbürgertum59. Die Frauenbewegung konnte ihre Ideen im Kaiserreich so erfolgreich verbreiten, dass konservative Kreise sich genötigt sahen, eine antifeministische Gegenbewegung zu initiieren. Eine solche gab es zwar auch in Großbritannien, in dieser Form aber nicht in Frankreich. Dort hatten es Feministinnen trotz Maßnahmen im Erziehungswesen und der Einführung der Schulpflicht für Mädchen schwer, sich Gehör zu verschaffen60. Besonders intensiv wurde das Frauenwahlrecht diskutiert, und Frauen erhielten das Wahlrecht für Einrichtungen wie Handelskammern, berufsständische Vertretungen und Handelsgerichte61. Die Gegnerschaft zur Frauenemanzipation war in Frankreich in der Mitte der Gesellschaft verankert, während sie in Deutschland stärker von der nationalistischen Rechten getragen wurde62. Frauen wurden in der republikanischen Tradition vor allem als Mütter und weniger als Staatsbürgerinnen oder als Individuen gesehen. Die frauenfeindlichen und pronatalistischen Strömungen in Frankreich propagierten daher mit Blick auf den starken Geburtenüberschuss in Deutschland die Erhöhung der Geburtenrate in Frankreich. Der öffentliche politische Raum sollte Männern vorbehalten bleiben, wobei auch hier die Verteidigung der Republik argumentativ ins Feld geführt wurde: Die Republikaner fürchteten, dass Frauen bevorzugt katholische Parteien wählen würden, was das Zurückdrängen der Kirche durch die laizistische Politik unterlaufen hätte63. Die stärkere antifeministische Bewegung im Kaiserreich kann als Zeichen für den größeren Verbreitungsgrad feministischer Ideen in der deutschen Gesellschaft gewertet werden, die in dieser Hinsicht „modernisierungswilliger“64 war als die französische.
Die Parteien in beiden Ländern mussten sich auf den politischen Massenmarkt einstellen, wie er sich um die Jahrhundertwende entwickelte65. Dazu gehörten neue Organisationsformen für Parteien. Der klassische, organisatorisch kaum gebundene Honoratiorenpolitiker war auf dem Rückzug. Neu war die Erfahrung, dass Politiker sich unmittelbar an ihre Wähler wandten und diese um ein Mandat baten66. Parteien in Deutschland und Frankreich reagierten bis 1914 ganz ähnlich – nämlich sehr zögerlich – auf diese Herausforderungen67. Im Kaiserreich existierte durchgängig ein Fünfparteiensystem, bestehend aus Konservativen, Katholiken, Nationalliberalen, Linksliberalen und Sozialisten. Obwohl Splitterparteien zeitweilig Abgeordnete in den Reichstag entsenden konnten, erlangten diese nie Einfluss auf die Mehrheitsbildung im Parlament68. Während es in Frankreich bereits seit 1852 ein staatliches Gehalt für Abgeordnete gab, erhielten Reichstagsabgeordnete bis 1906 keine Diäten. Dadurch konnten sich nur vermögende Personen oder Politiker zur Wahl stellen, die über einen finanziellen Rückhalt durch ihre Partei oder durch Spenden verfügten.
In Frankreich formierte sich ein festes Parteienspektrum in den Jahren 1901 bis 1905 und damit später als im Deutschen Kaiserreich und in anderen europäischen Ländern. Eine restriktive Gesetzgebung im Hinblick auf die Gründung von Verbänden und Organisationen spielte dabei genauso eine Rolle wie eine damit verknüpfte stärker individualistische politische Tradition69. Dennoch kann nicht pauschal von einer instabilen französischen Parteienlandschaft die Rede sein70. Gewerkschaften und Berufsverbände etwa waren seit 1884 zugelassen. Eine sehr wichtige Rolle spielten die Ligue de l’enseignement, die Ligue des patriotes sowie die Freimaurerlogen, allen voran der Grand Orient de France, dem zahlreiche führende Republikaner wie beispielsweise Jules Ferry angehörten71. Das infolge des Vereinsgesetzes von 1901 entstehende Parteienspektrum mit dem Parti radical-socialiste der republikanischen Dreyfusanhänger, der Alliance démocratique (beide 1901) und der Fédération républicaine (1903) der konservativen Republikaner, dem 1905 gegründeten Parti socialiste unifié, section française de l’Internationale ouvrière (SFIO) sowie der Action française (1898) im rechten Lager blieb im Wesentlichen bis 1940 erhalten72.
Die starke Politisierung der französischen Gesellschaft in der Zeit vor 1914 steht außer Frage. Die Epoche gilt als Zeit, in der das Politische – nicht zuletzt wegen der Dreyfusaffäre – das öffentliche und nationale Leben, soziale Dynamiken, künstlerische Bewegungen, intellektuelle Debatten sowie individuelle und kollektive Vorstellungen beherrschte. Anders wurde dagegen von der Forschung die Situation im Deutschen Kaiserreich eingeschätzt: Hier dominierte lange Zeit die Vorstellung eines wirtschaftlich modernen, aber gesellschaftlich und politisch rückständigen Staates, ein Bild, das inzwischen deutlich revidiert wurde73. So war mit der Verfassung zwar ein Rahmen vorgegeben. Wie sich das Kräfteverhältnis jedoch darin entwickeln würde, war im Deutschen Kaiserreich ähnlich wie in Frankreich offen. Verfassungsmäßig beschritt das Kaiserreich in Europa keinen Sonderweg, sondern stellte eine „Variante des zeittypischen monarchischen Konstitutionalismus“74 dar. Die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg spiegelte damit beides: die konstitutionelle Krise des Kaiserreichs einerseits, manifest etwa in der politischen Blockade zwischen Regierung und Reichstag aufgrund fehlender Kontrollbefugnisse, und die weite Akzeptanz des bestehenden politischen Systems andererseits75. So hatte abgesehen von der SPD – die allerdings die stärkste Fraktion war – keine Partei im Kaiserreich ein tatsächliches Interesse an einer Ablösung der konstitutionellen durch eine parlamentarische Monarchie oder gar durch eine Demokratie, wie es sie in Frankreich gab. Gerade die konservativen Parteien erwarteten in diesem Fall einen Stimm- und Einflussverlust76. In enger Beobachtung der Entwicklung der Dritten Republik wurde in politischen Diskussionen im Kaiserreich dem deutschen Rechtsstaat der französische politische Staat gegenübergestellt. Die Korruptionsskandale in Frankreich, das harte Vorgehen gegen die Arbeiterbewegung bei Streiks, fehlende Sozialgesetze, wirtschaftliche Schwäche, politische Instabilität und vor allem das Versagen der Justiz in der Dreyfusaffäre wurden quer durch fast alle politischen Lager im Kaiserreich kritisiert und ließen das deutsche Modell als überlegen erscheinen. Selbst Teile der deutschen Sozialisten waren gegen die Republik eingenommen, in deren Staatsform sie keine wirkliche Alternative zum Kaiserreich sahen77. Erstaunlich ist die große Häufigkeit, mit der im Kaiserreich auf die ausländischen parlamentarischen Systeme in Frankreich und Großbritannien Bezug genommen wurde. Sogar Ende des Jahres 1908 auf dem Höhepunkt der Daily-Telegraph-Affäre aufgrund eines umstrittenen Interviews von Kaiser Wilhelm II. fand noch die Hälfte der Abgeordneten während der Reichstagsdebatten Zeit, das deutsche politische System mit den Systemen anderer europäischer Länder zu vergleichen78. Die Genugtuung vieler Deutscher über die vermeintliche Überlegenheit der eigenen staatlichen Institutionen im internationalen Vergleich ist ein Hinweis darauf, dass es neben kulturellen und sprachlichen genauso politische Komponenten gab, die sich einigend auf das deutsche Nationalgefühl ausgewirkt haben79. Die zeitgenössische deutsche Kritik an der décadence und der scheinbaren Instabilität der Dritten Republik hat sich interessanterweise in Teilen der deutschen Geschichtsschreibung bis Ende des 20. Jahrhunderts gehalten80.
In Frankreich herrschte umgekehrt eine gewisse Faszination für die eigene Sonderstellung als Republik. Ein Großteil der Bevölkerung sah Frankreich in einer überlegenen Position als demokratische Insel in einem monarchistischen Europa81. Mit Blick auf das Deutsche Kaiserreich wurden vor allem dessen autoritäre Züge kritisiert. So hatte die Affäre um den „Hauptmann von Köpenick“ 1906, bei der ein vorbestrafter Schuster in der Uniform eines Hauptmanns das Rathaus von Köpenick stürmte und dort die Stadtkasse entwendete, die Franzosen stark amüsiert. Sie galt als Bestätigung der marionettenhaften Hörigkeit der Deutschen gegenüber Militär und Autoritäten82.
Geschichtswissenschaft und Schulerziehung
Historikern kam in beiden Ländern eine zentrale Rolle für die Entwicklung einer nationalstaatlichen Traditionspflege und Erinnerungskultur zu83. Preußische Historiker stellten die Reichsgründung 1871 in eine Linie mit den napoleonischen „Befreiungskriegen“84. Französische Historiker zogen republikanische Verbindungslinien zurück zur Französischen Revolution. Sie hatten überdies die Aufgabe, die Niederlage Frankreichs 1871 sowie den Aufstieg Preußens aus der Geschichte zu erklären und eine geistige Regeneration einzuleiten85. Als eine der Ursachen wurden das schlechte schulische und universitäre Ausbildungssystem sowie die im Vergleich zu Preußen „unwissenschaftliche“ und unpatriotische Geschichtsschreibung identifiziert86. Historiker wie Gabriel Monod und Ernest Lavisse setzten sich dafür ein, die französische Geschichtswissenschaft nach deutschem Vorbild zu professionalisieren und zu standardisieren, ein Prozess, der in Teilen bereits in den 1860er-Jahren eingesetzt hatte. Nach dem verlorenen Krieg 1870/71 wurde aus dem bis dahin primär intellektuellen ein patriotisches Anliegen, wodurch das Vorhaben deutlich an Vehemenz gewann87. Von einem kritiklosen Transfer des „deutschen Modells“ nach Frankreich kann jedoch nicht die Rede sein88. Spätestens um 1900 hatte Deutschland seine Vorbildfunktion für die französische Geschichtswissenschaft verloren, obgleich die gegenseitige Wahrnehmung und der Austausch weiterhin eng blieben89. Die internationalen Historikerkongresse ab 1898 waren Orte des Austauschs und der Konkurrenz, bei denen die Notwendigkeit einer gemeinsamen Dokumentation von Quellen genauso deutlich wurde wie Deutungskämpfe und Dominanzstreit über Richtungen und Methoden90.
Wegen seiner Breitenwirkung wurde dem Schulunterricht noch größere Bedeutung als der universitären Ausbildung beigemessen. In einer Serie von Gesetzen wurden in Frankreich in den 1880er-Jahren unter Jules Ferry Reformen durchgeführt: Allgemeine Schulpflicht, Laizismus und kostenloser Unterricht waren deren Eckpfeiler91. Die pädagogische Ausrichtung war dabei eng mit der innenpolitischen, laizistischen Festigung der Republik verbunden, was die teils heftigen Diskussionen rund um die Gesetzesinitiativen erklärt. Schon in der Grundschule, für die zahlreiche standardisierte Neubauten in Ortsmitte entstanden, sollten die Kinder zu loyalen, von der Kirche unabhängigen Bürgern erzogen werden, die bereit waren, die Republik zu verteidigen. Der Volksschullehrer, vor dem Krieg mit einem eher schlechten Image ausgestattet, avancierte zur Symbolfigur der Republik: Als hussard noir in seinem schwarzen Rock stellte er das Gegenstück zum katholischen Priester dar und verkörperte die antiklerikale Idee. In der deutschen pädagogischen Fachpresse wurden diese Reformen mit „Sympathie, Respekt und Bewunderung“92 aufgenommen.
In Deutschland lag die Kultushoheit bei den einzelnen Ländern, die unabhängige Entscheidungen trafen. Zwar war die allgemeine Schulpflicht in den deutschen Ländern bereits im 17. und 18. Jahrhundert eingeführt worden, vollständig umgesetzt wurde sie jedoch erst nach 1871. Der Hauptauftrag der preußischen Volksschulen lag darin, über die Erziehung die nationale Idee zu stärken und der neuen kaiserlichen Monarchie die Loyalität der Massen zu sichern und sie gegen innere „Reichsfeinde“ zu immunisieren93. Der deutschen Industrie sollten kaisertreue Arbeiter zugeführt werden, um sie auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu halten94.
Im Militärkult trafen sich die Erziehungspolitiken beider Länder. In Frankreich erhielten die Kinder ab 1882 in den sogenannten Schulbataillonen (bataillons scolaires) eine militärische Ausbildung, was die deutsche Regierung beunruhigt zur Kenntnis nahm95. Dem stand im Deutschen Kaiserreich neben der Verherrlichung von Krieg und Militär die „körperliche Wehrhaftmachung“ gegenüber, die im Turn- und Sportunterricht sowie in der „Heereserziehung“ gepflegt wurde. Ergänzend kamen das Erlernen von Kriegsliedern und Gymnastik- und Schießübungen hinzu sowie die vormilitärische Jugenderziehung, wie sie der preußische Jugendpflegeerlass von 1913 festschrieb. Die Presse kritisierte am jeweils anderen Land die chauvinistische Schulerziehung, in der man eine Gefahr für den Frieden in Europa sah96.
Gleichzeitig wurde die Sprache des Nachbarlandes gelehrt, um die Verständigung vor allem in der Wissenschaft oder in möglichen Kriegszeiten zu ermöglichen. Französisch stand bei den modernen Fremdsprachen im Kaiserreich an erster Stelle. Da Lehrer jedoch die deutsche Staatsangehörigkeit haben mussten, bot der Sprachenunterricht an den Schulen keine Einsatzmöglichkeit für französische Lektoren97. Lehramtsassistenten konnten dagegen im anderen Land hospitieren. Kontakte wurden ebenso durch Auslandsaufenthalte während des Studiums ermöglicht und es gab ein „Handbuch für einen Studienaufenthalt im französischen Sprachgebiet“, das 1911 in vierter Auflage erschien. Kontakte der deutschen und französischen Jugend existierten außerdem durch deutsch-französische Schülerbriefwechsel98. Trotz überwiegend positiver Erfahrungen bei Aufenthalten von Schülern im anderen Land wurde häufig gegenseitig die nationalistische Einstellung des anderen kritisiert. Um die Jahrhundertwende kam es vor allem in Frankreich zu einer Krise des Patriotismus an der Schule, die bis zum Ersten Weltkrieg anhielt. Die chauvinistische und paramilitärische Erziehung wurde in beiden Ländern zum Ziel der Kritik durch Sozialdemokraten, Pazifisten und linke Presse. In den pädagogischen Reformbewegungen kam es zu Ideentransfers über Zeitschriften, Vereine und Tagungen99.
Nationalstaat und Symbole
Zur Schaffung einer kollektiven, einheitlichen und systemstabilisierenden Vorstellung der Nation wurden nationale Traditionen und Mythen über Riten, Feiern, Denkmäler und politische Symbole im Bewusstsein der Massen verankert100. Die nach 1870 entworfenen Nationsdeutungen waren in Deutschland und Frankreich innenpolitisch stark umstritten. Sie wurden nicht nur von staatlicher Seite vorgegeben, sondern auch von unterschiedlichen politischen und sozialen Gruppen eingefordert und aktiv verhandelt.
Bei Auswahl und Etablierung seiner nationalen Symbole tat sich das Deutsche Kaiserreich schwerer als die Dritte Republik. Es galt, einen Ausgleich zu finden zwischen dem neu geschaffenen monarchischen Staat, den Fürsten der Einzelstaaten sowie den Vorstellungen der liberal-freiheitlichen bürgerlichen Nationalbewegung. Dies gelang erst unter Wilhelm II., und selbst dann nur in Teilen, blieb doch die „Spannung zwischen nationalen und föderalen Symbolen“101 erhalten. In Fahne, Wappen und Kaiserhymne des Reichs zeigte sich die Dominanz Preußens. Eine Nationalflagge gab es zunächst nicht. Als Handelsflagge wurde die schwarz-weiß-rote Flagge des Norddeutschen Bundes übernommen, die 1892 zur Nationalflagge deklariert wurde. Dass bei der dreifarbigen Flagge formal die französische Trikolore Pate gestanden hatte, wurde mit einer eigenen geschichtlichen Herleitung verschleiert102. Eine offizielle Nationalhymne wurde nicht festgelegt. Als Monarchenhymne wurde „Heil Dir im Siegerkranz“ gesungen, eine preußische Volkshymne, die in den Freiheitskriegen gegen Napoleon als Vaterlandslied umgedeutet worden war. Die Melodie war die der englischen Hymne „God Save the King“, was auch in Preußen auf Unmut stieß103. Bei bürgerlichen Veranstaltungen wurde das 1840 während der „Rheinkrise“ entstandene Lied „Die Wacht am Rhein“ oder das protestantische „Ein feste Burg“ angestimmt. Ab den 1890er-Jahren gewann das „Deutschlandlied“ an Beliebtheit104.
Einen offiziellen Nationalfeiertag gab es nicht. Die Sedanfeiern am 2. September, mit denen der siegreichen Schlacht gegen Frankreich 1870 gedacht wurde, richteten die Kriegervereine mit regionalen und konfessionellen Unterschieden als populäres Volksfest mit Umzügen, Paraden und Schützenfesten aus. Als Nationalfeiertag konnte der Sedantag sich nicht durchsetzen und nach der 25-Jahrfeier 1895 ebbte das Interesse an der Kriegserinnerung ab105. Katholiken, Sozialdemokraten und süddeutsche Demokraten blieben den Feierlichkeiten fern. Beliebter als der Sedantag und die formellen Kaisergeburtstage waren die „Kaiserparaden“. Darin präsentierte der Kaiser jeden Herbst im Wechsel einer Region stellvertretend für die gesamte Nation die Kampfkraft der Truppen. Diese Paraden waren kein Ausdruck einer Sonderstellung des Kaiserreichs, sondern ein zeittypisches Phänomen, das sich in ähnlicher Form in Frankreich und in anderen europäischen Ländern zeigte106. Dennoch wurde in Frankreich der militärische Charakter der Feste kritisiert, etwa beim hundertjährigen Gedenken an die Völkerschlacht bei Leipzig 1913107.
In ihrer politischen Symbolik knüpfte die Dritte Republik nach ihrer Festigung an das revolutionäre Erbe Frankreichs an und legte die Marseillaise als Hymne (1879), den 14. Juli als Nationalfeiertag (1880) und die Trikolore als Flagge (1880) fest108. Doch ging der Rückgriff auf republikanische Symbole nicht konfliktfrei vor sich: Für die einen stand der Bezug auf die Revolution von 1789 für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, während die anderen an Klassenkampf, Terror und die Hinrichtung von König, Adligen und Priestern erinnert wurden109. Wie die „Kaiserparaden“ in Deutschland hatten die Besuche der französischen Präsidenten eine wichtige Funktion für die Inklusion der Regionen, wobei die lokalen Akteure stärker als in Deutschland gestaltend auf den Ablauf der Besuche einwirken konnten110. Ähnlich ritualisiert, aber ohne militärische Aspekte, waren sie darüber hinaus ein wichtiges Mittel zur Republikanisierung des Landes111. Stand bei den Reisen zunächst die Funktion des Präsidenten im Mittelpunkt, ging es ab der Jahrhundertwende stärker um die Glorifizierung der jeweiligen Person im Amt112.
Die neuere Forschung hat für die Dritte Republik nicht nur die Kontinuitäten mit den Festen des Second Empire nachgewiesen, sondern auch gezeigt, dass die Regionen bei der Ausgestaltung der Feste und der Aneignung der Symbole aktiv und selbstständig mitwirkten. So bestellten viele Bürgermeister, örtliche Komitees und Deputierte ihre Mariannebüsten aus eigenem Antrieb. Ebenso planten sie die Aktivitäten für den Nationalfeiertag mit lokalen Varianten weitgehend autonom, wobei die Organisation oftmals mit politischen Auseinandersetzungen und klerikalem Widerstand einherging113. Auch der im Jahr 1880 gefasste Beschluss, öffentliche Gebäude mit der Inschrift „Liberté égalité, fraternité“ zu versehen, erfuhr lokale Anpassungen, die von komplexen Aushandlungsprozessen und leidenschaftlichen Debatten zeugten: Das neue Rathaus in Les Lilas etwa war mit den Worten „Liberté, égalité, fraternité, vote“ geschmückt, während auf dem Rathaus in La Celle im Departement Var die Inschrift „Liberté, égalité, science“ angebracht wurde114.
Eine „symbolpolitische Offensive der Republikaner“115 bot die Einhundertjahrfeier der Französischen Revolution 1889, die seinerzeit heftig umstritten war. Neben der Weltausstellung mit dem neugebauten Eiffelturm, den zahlreichen Publikationen, Kongressen und Feierlichkeiten wurde das jährliche Bankett der Bürgermeister auf dem Champ de Mars abgehalten. Rund 11 250 französische Bürgermeister überwiegend ländlicher Herkunft nahmen daran teil, beobachtet von über 800.000 Schaulustigen116. Eine offizielle deutsche Beteiligung an der Weltausstellung 1889 und an den republikanischen Feierlichkeiten gab es nicht, im Gegenteil: Genau wie ihre Kollegen aus den Monarchien Österreich-Ungarn, England und Russland verließen die deutschen Diplomaten in dieser Zeit Paris117. Dafür reisten die deutschen Sozialdemokraten an die Seine, um am zeitgleich stattfindenden Gründungskongress der Zweiten Internationalen teilzunehmen. Umgekehrt wurden 1895 zur 25-Jahrfeier des deutschen Siegs in Sedan die französischen Militärattachés aus Berlin abgezogen, um ihnen den Anblick der militärischen Feiern zu ersparen und die nationale Würde Frankreichs zu wahren118.
Der französischen „statuomanie“119 nach 1870, die das Land mit Statuen von republikanischen Politikern, Philosophen, Militärs sowie mit Mariannebüsten in den Rathäusern und anderen Republik-Darstellungen auf öffentlichen Plätzen überzog, entsprach die deutsche „Denkmalsflut“120 mit Statuen von Bismarck, Wilhelm I. und von führenden Militärs sowie mit nationalen Denkmälern wie dem Kyffhäuserdenkmal für Barbarossa und dem Denkmal zur Erinnerung an die Völkerschlacht bei Leipzig. Während in Deutschland der Sieg von 1870/71 inszeniert wurde, zeigten die Denkmäler in Frankreich heroische Gesten, die die Niederlage transzendierten121. Zwischen Hermannsdenkmälern in Deutschland und Vercingetorixstatuen in Frankreich gab es „frappierende Ähnlichkeiten“122. Beide huldigten antiken Persönlichkeiten, die jeweils für ihr Land gegen die römische Invasion gekämpft hatten. Unterschiedlich waren die Religionsbezüge: Dem französischen Laizismus stand der deutsche Nationalprotestantismus gegenüber, wobei in beiden Ländern katholische Kräfte ihre Sinnstiftungen ebenso verbreiten konnten. Unterschiedlich verlief überdies die Einweihung von Denkmälern für republikanische Staatsmänner, fehlten in Frankreich doch die militärischen Aspekte, die im Kaiserreich gerade bei der Ehrung von Militärs stark im Vordergrund standen123. Zeitgenössisch waren in beiden Ländern sowohl die Denkmalsflut als auch einzelne Projekte aufgrund politischer Vorbehalte verschiedener Akteure und Gruppen umstritten. Trotz der Unterschiede in den politischen Botschaften zwischen Monarchie und Republik ist in den Bereichen politische Symbolik, Militärfeiern und Denkmäler kein starker Antagonismus auszumachen. Vielmehr dominierten Ähnlichkeiten bei Inszenierung und Repräsentation des Nationalen zwischen beiden Ländern wie auch im europäischen Vergleich124.
Begegnungen auf internationaler Bühne
Nach dem Krieg von 1870/71 waren die außenpolitischen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich überwiegend von Rivalität geprägt, auch wenn es immer wieder Bemühungen um Annäherung sowie Phasen der Kooperation und Entspannung gab125. Dabei war die Ambivalenz von Konkurrenz und Zusammenarbeit, Bewunderung und Abneigung nicht ausschließlich auf das deutsch-französische Verhältnis beschränkt, sondern prägte generell die außenpolitischen und außenwirtschaftlichen Beziehungen in einer zunehmend verflochtenen und multizentrischen Welt. Im deutsch-französischen Fall blieb das Verhältnis außenpolitisch jedoch unversöhnlich, da Frankreichs Tabu Deutschlands Grundvoraussetzung für eine Verständigung darstellte: die endgültige Anerkennung des Frankfurter Friedens und damit des Verlusts der Provinzen Elsass und Lothringen. Eine tatsächliche Bündnispolitik oder Entente zwischen beiden Ländern wurde durch die „Wunde von 1871“ verhindert. Kooperationen in Einzelfragen oder bei bestimmten Projekten ließen sich leichter umsetzen, weil von französischen Regierungsvertretern dafür eher Verständnis in der Öffentlichkeit erwartet wurde. Von deutscher Seite wiederum wurde das Fehlen einer öffentlichen Verzichtserklärung Frankreichs auf die verlorenen Gebiete als Zeichen für die dauerhafte Unversöhnlichkeit des Nachbarn und als Revanchismus interpretiert. Frankreich wurde daher als einzige Macht immer als Feind angesehen, während die anderen Großmächte mit wechselnden Konjunkturen als politische Partner und potenzielle Verbündete infrage kamen126. Dabei verfolgte Frankreich zu keinem Zeitpunkt eine offene Revanchepolitik, das heißt die Rückgewinnung der annektierten Gebiete unter Einsatz von militärischer Gewalt. Die militärische Revanche war überwiegend ein Mythos, der für die Öffentlichkeit beibehalten wurde, zumal man die mit der Annexion einhergehende Erniedrigung nicht vergessen konnte127. Elsass-Lothringen war aber keineswegs das beherrschende Thema der Zeit von 1870 bis 1914, weder innen- noch außenpolitisch.
Durch die Gründung des Deutschen Kaiserreichs hatte sich in Europa das Gleichgewicht der Mächte grundlegend verschoben128. Mit dem „halbhegemonialen“ deutschen Nationalstaat war in der Nachfolge Preußens neben Großbritannien, Russland, Österreich-Ungarn und Frankreich eine fünfte Großmacht entstanden, die Frankreich von seinem ersten Rang auf dem Kontinent verdrängt hatte. Innerhalb des europäischen Mächtesystems wurden nach 1870/71 der deutsch-französische Gegensatz sowie die wiederkehrenden Drohungen Deutschlands gegen Frankreich zu einer Konstante. Bei mehreren Gelegenheiten machten die Großmächte jedoch deutlich, dass sie sich einer weiteren Schwächung Frankreichs und damit einem Ausbau der militärischen und diplomatischen Vorherrschaft Deutschlands widersetzen würden129. Dies war etwa bei der „Krieg-in-Sicht-Krise“ im April/Mai 1875 der Fall, als ein – vermutlich von Bismarck lancierter130 – Presseartikel mit der Überschrift „Ist Krieg in Sicht?“ Frankreich kriegsvorbereitende Maßnahmen unterstellte und unverhohlen mit einem Präventivschlag drohte. Europa wolle „ein Frankreich auf der Karte sehen“131, ließ der damalige russische Außenminister Alexander Gortschakow den deutschen Reichskanzler wissen.
Deutsch-französische außenpolitische Begegnungen, ob bilateral oder auf internationalem Parkett, fanden im Spannungsfeld dieser grundlegenden und vom Imperialismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts schubweise gesteigerten Rivalität statt bei gleichzeitiger Verflechtung und Kooperation auf verschiedenen Ebenen. Trotz der häufigen Zwischenfälle an der elsass-lothringischen Grenze, der Friktionen mit deutschen Reisenden in Frankreich, der übersteigerten Angst vor Spionen, der Presseattacken und der periodisch wiederkehrenden Spannungen zwischen beiden Ländern kam es zu Absprachen vor allem in der Kolonialpolitik und in den Handels- und Finanzbeziehungen.
Neben dem Erreichen einer stabilen inneren Ordnung stand die neu gegründete Dritte Republik vor der Aufgabe, eine adäquate neue Außenpolitik zu entwickeln132. Frankreich war die erste europäische Großmacht, die Außenpolitik „unter republikanischen Bedingungen“133 betrieb und damit in einem Spannungsverhältnis zu den Monarchien im europäischen Staatensystem stand. So brachten die monarchischen Großmächte Frankreich überwiegend Misstrauen entgegen und zweifelten an seiner Bündnistreue und -fähigkeit. Der Republik wurde eine fatale Abhängigkeit von der öffentlichen Meinung und von revolutionären Umtrieben attestiert, wie sie sich in der Pariser Kommune gezeigt hatten. Die häufigen Regierungskrisen schienen dieses Vorurteil zu bestätigen. Innenpolitisch hatte die Dritte Republik mit Kritik aus den Reihen der Royalisten und der nationalen Rechten zu kämpfen, aus deren Sicht eine machtvolle Außenpolitik ohne Anerkennung durch die Monarchien kaum möglich war. Eng mit dieser Auseinandersetzung verknüpft war die innenpolitische Diskussion in Frankreich über die Gründe für die Kriegsniederlage und insbesondere darüber, ob im Krieg 1870/71 die Monarchie oder die Republik versagt habe. Zeitgenössisch wurde in Frankreich wie in Deutschland die Debatte geführt, ob ein republikanisches Land überhaupt klassische Großmachtpolitik betreiben könne134. Demgegenüber sahen die Republikaner die Stärke einer Außenpolitik unter demokratischen Vorzeichen in ihrer Transparenz und Friedfertigkeit. Das Hauptinteresse der Republikaner galt jedoch der Innenpolitik, auch weil sie in der Opposition während des Second Empire überwiegend innen- und verfassungspolitische Fragen verhandelt hatten135. Außenpolitische Themen trafen dann auf Interesse, wenn sie wie bei der Zoll- oder Rüstungspolitik das nationale Prestige oder die wirtschaftliche Stellung Frankreichs betrafen. Das entsprach den Schwerpunkten der öffentlichen und veröffentlichten Meinung. Das relative Desinteresse der Zeitgenossen an der Außenpolitik zieht sich bis in die heutige französische Historiografie, die sich innenpolitischen Themen der Dritten Republik weitaus intensiver gewidmet hat und widmet.
Zu den Hauptzielen der frühen französischen Außenpolitik gehörten die Bezahlung der Reparationen und damit die Beendigung der deutschen Besatzung in Nordfrankreich, die Überwindung der von Bismarck betriebenen Isolierung der Republik im internationalen Mächtesystem und die Wiederherstellung der außenpolitischen Großmachtstellung Frankreichs. In der ab 1881 einsetzenden Phase der „Expansion“136 standen die Festigung und Ausdehnung des Kolonialreichs sowie die Ausweitung der Außenwirtschaft und der Finanzbeziehungen im Mittelpunkt der Bemühungen. Im Zusammenhang mit der französischen Kolonialpolitik kam es mit aktiver Unterstützung Bismarcks 1884/85 zu einer Annäherung137. Durch die Schnaebelé-Affäre138, die Entführung des französischen Grenzbeamten Guillaume Schnaebelé wegen Spionageverdachts nach Deutschland 1887, und die Boulangerkrise im selben Jahr wurde diese Annäherung jedoch Makulatur und ein erneuter deutsch-französischer Krieg schien unausweichlich. In den 1890er-Jahren betrieb Frankreich eine zunehmend offensivere Politik und verfolgte eine Allianzbildung vorwiegend mit Russland und Großbritannien. Diese trug im Falle Russlands ab den 1890er-Jahren, bei Großbritannien nach Beilegung der kolonialen Streitigkeiten mit der Entente cordiale 1904 Früchte139.
Das Deutsche Kaiserreich entwickelte sich nach 1871 zu einer Großmacht, die wirtschaftlich, demografisch und militärisch eine herausragende Stellung in Europa und der Welt einnahm140. Bismarcks Außenpolitik, zu der es im Gegensatz zur französischen Außenpolitik jener Jahre eine kaum zu bewältigende Fülle an Literatur gibt141, lässt sich mit folgenden Stichpunkten grob umreißen: Sicherung der durch seine Mittellage als prekär wahrgenommenen Großmachtstellung Deutschlands; gleichzeitige Isolierung Frankreichs; Verlagerung von Spannungsherden an die europäische Peripherie; Vermeiden einer Bündnisentscheidung des Kaiserreichs zwischen Russland und Österreich-Ungarn, die auf dem Balkan Konkurrenten waren. Vielfach beschrieben ist das Bündnissystem Bismarcks, ein abgestuftes „System der Aushilfen“, das mehrere Phasen durchlief. Mit Dreibund, Orientbund und Rückversicherungsvertrag band er alle Mächte außer Frankreich vertraglich an Deutschland, hielt Frankreich damit in Isolation und nutzte Gegensätze zwischen den anderen Mächten. Mit der Losung der territorialen Saturiertheit des Reiches, wie er sie als „ehrlicher Makler“ während des Berliner Kongresses 1878 zur Lösung der Orientalischen Frage vertrat, wehrte Bismarck den außenpolitischen Expansionsdruck ab, der in Teilen der deutschen Bevölkerung stark präsent war.
Gegenüber Frankreich führte Bismarck eine Politik der abwechselnden Drohungen und Annäherungsangebote. Er zeigte eine „antifranzösische Nervosität“142 und eine „höfliche Feindschaft”143, die vor allem auf der Annahme einer unversöhnlichen Einstellung Frankreichs infolge der Annexion von Elsass und Lothringen basierte. Die aus der monarchischen Solidarität resultierende außenpolitische Isolation der französischen Republik bis in die 1890er-Jahre entsprach ganz Bismarcks politischer Absicht. Wiederholt sprach er sich für die republikanische Staatsform in Frankreich aus, da er sie als nachteilig für die Innenpolitik des Nachbarlands ansah144. Bismarck nutzte die Presse, um bestimmte außenpolitische Wirkungen zu erzielen und Einfluss auf Wahlen oder auf die französische Innenpolitik auszuüben, beispielsweise während der „Krieg-in-Sicht-Krise“ 1875 oder während der Boulangerkrise 1887145. In gleicher Weise versuchte Bismarck nach seiner Entlassung, die außenpolitische Linie des Kaiserreichs mittels Pressearbeit zu beeinflussen. Vor allem französischen Journalisten gegenüber zeigte er sich „gesprächsbereit“146, wobei er mit seinen Äußerungen die deutsch-französischen Beziehungen nachhaltig beschädigte. Durch seine harsche, öffentlich geäußerte Kritik an der Außenpolitik seiner Nachfolger trug er zugleich zur tiefen Spaltung der öffentlichen Meinung und zur zunehmenden „inneren Auskreisung“147 Wilhelms II. im Kaiserreich bei.
Die deutsche Außenpolitik nach der Entlassung Bismarcks 1890 war „ohne festes Ziel“148 und es mangelte an Homogenität. Der „neue Kurs“ unter Wilhelm II. legte den Fokus auf Erhalt und Ausbau des internationalen Prestiges des Reichs, auf den Erwerb von Territorien und auf den Schutz von Handelsmärkten149. Er markierte die Abkehr von der relativen Selbstbeschränkung der Bismarckzeit und den Beginn einer deutschen „Weltpolitik“ auf der Suche nach Rohstoffen, Absatzmärkten und kolonialen Einflussgebieten. Der Aufbau einer eigenen Schlachtflotte ab 1898, die als unumgängliche Voraussetzung für die deutsche Weltmachtgeltung angesehen wurde, entwickelte sich durch geschickte Vermarktungsstrategie des Flottenvereins zu einem in der deutschen Öffentlichkeit bis in die Arbeiterkreise hinein viel bejubelten Prestigeobjekt mit Integrationswirkung. Das Flottenprogramm zeigte das Kaiserreich nicht nur als Industriemacht, sondern brachte Deutschland zugleich in Konkurrenz zu Großbritannien, mit dem dennoch immer wieder ein Ausgleich gesucht wurde. Bündnispolitisch ließen Bismarcks Nachfolger die Allianz mit Russland auslaufen und setzten vor allem auf den Zweibund mit Österreich, der zu einem festen Block in Mitteleuropa wurde. Zugleich zeigte die Außenpolitik des Kaiserreichs um die Jahrhundertwende eine große Offenheit. Die französische Isolation verschwand aus dem Fokus, eine deutsch-französische Annäherung avancierte sogar zum „Tagesgespräch des politischen Europa“150. In Frankreich wurde die Idee einer Annäherung zwischen Paris und Berlin ebenso als Option anerkannt, nicht zuletzt, da in der französisch-britischen Faschodakrise 1898 die französische Presse das „perfide Albion“ als noch älteren „Erbfeind“ jenseits des Kanals wiederentdeckt hatte151. So wurde in der Januar-Ausgabe 1900 der französischen Zeitschrift „Questions diplomatiques et coloniales“ das deutsche Flottenprogramm begrüßt, sah man darin doch ein „nützliches Gegengewicht“152 zum britischen Imperialismus. Neben Annäherungen auf symbolischer Ebene wie der deutschen Teilnahme an der Weltausstellung 1900 in Paris, der Verleihung der Medaille des grand officier de la Légion d’honneur für Richard von Helmholtz und der Teilnahme des Kaisers am Botschaftsdiner in der französischen Botschaft Berlin kam es 1900 zu einer militärischen Kooperation: Unter dem Kommando des deutschen Generals von Waldersee kämpften Truppen beider Länder im Rahmen des internationalen Expeditionskorps, das eine antiimperialistische Aufstandsbewegung in China niederschlug, den im Westen sogenannten Boxeraufstand153. Aus Rücksicht auf Frankreich wurden in diesem Jahr fast überall in Deutschland die Sedanfeiern abgesagt154. Letztlich wurden die Chancen zur Annäherung von beiden Seiten jedoch nicht konsequent genutzt und die Möglichkeiten für eine tatsächliche Verständigung verstrichen.
Die wilhelminische Außenpolitik war zu Beginn des neuen Jahrhunderts geprägt von Zwängen und Befürchtungen, unter denen an erster Stelle die Vorstellung stand, von feindlichen Mächten eingekreist zu sein. Diese breitete sich nach der ersten Marokkokrise 1905/06 in Politik und Presse aus155. „Einkreisung“ wurde zum meist verwendeten politischen Schlagwort in Deutschland. Das Deutungsmuster provozierte „Sehnsüchte nach einer aggressiven Flucht nach vorn“156, die einen Präventivkrieg miteinschlossen. Diese subjektive Wahrnehmung der internationalen Situation übersah die zahlreichen Möglichkeiten zur Détente vor 1914, insbesondere zwischen Berlin und London, und brachte eine eigene Realität hervor. In der Forschung wird die „Einkreisung“ als „Selbst-Auskreisung“ dargestellt und – in Verlängerung zeitgenössischer Debatten – thematisiert, ob die wilhelminische Außenpolitik offensiv oder defensiv einzuschätzen sei157. Ihre Bewertung fällt in der Forschung mittlerweile deutlich günstiger aus als in früheren Jahren. Genauso wird die Außenpolitik Bismarcks neu betrachtet und auf die schwierige Ausgangslage der deutschen Diplomatie nach 1871 hingewiesen, da die geopolitische Mittellage sowie die dauerhaften und für alle anderen Mächte offensichtlichen deutsch-französischen Gegensätze die Handlungsspielräume begrenzten158.
Symbolische Politik: Staats- und Flottenbesuche
Die diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich waren durch die unterschiedlichen Verwaltungs- und Staatskulturen belastet. Einer juristisch geprägten Verwaltung auf deutscher Seite stand eine stärker klassisch-geisteswissenschaftlich ausgerichtete Verwaltung auf französischer Seite gegenüber159. Immer wieder kam es zu Protokollstreitigkeiten zwischen Monarchie und republikanischem Regime, zum Beispiel in Bezug auf die Frage, ob bei einem Wechsel des Präsidenten die französischen Diplomaten erneut akkreditiert werden müssten, worauf Bismarck 1873 im Zuge des Amtsantritts von Mac-Mahon bestand. Ähnliche Auseinandersetzungen gab es in Bezug auf die Reihenfolge der Besuche bei Amtswechseln, stand die Republik doch auf dem Standpunkt, dass ein neuer Präsident als unpersönlicher Vertreter der Republik immer als Dienstältester im Vergleich zu den Monarchen anzusehen sei. Letztlich ging es um unterschiedliche Auffassungen, wer einen Staat vertreten konnte: Ein gewählter Politiker war ein Repräsentant von Volk und Republik, ein Monarch „von Gottes Gnaden“ war selbst der Souverän. In der Verlängerung ihrer Kritik an der Republik, die sie durch einen korrupten Clan geführt sahen, warfen deutsche Diplomaten ihren französischen Kollegen die Nähe zu Parlament und Parlamentariern vor160. Umgekehrt zeigten die französischen Diplomaten und Politiker eine „tiefgründige Abneigung“161 gegenüber der stark aristokratischen und militaristisch geprägten herrschenden Klasse des preußisch-deutschen Kaiserreichs.
Aufgrund der Instabilität der französischen Regierungen während der Dritten Republik wurden Diplomaten zu Garanten einer außenpolitischen Kontinuität Frankreichs, was ihnen großen Einfluss verlieh162. Präsident Adolphe Thiers wählte in den Anfangsjahren der Republik vor allem Diplomaten adeliger Herkunft aus, in der Hoffnung, dass diese aufgrund ihrer Kenntnisse der adeligen Gepflogenheiten eher auf Anerkennung in den monarchischen Staaten treffen und damit das Ansehen Frankreichs positiv beeinflussen würden. Mit der Einführung der Aufnahmeprüfungen (concours) für die Auswahl der Diplomaten traten ab 1895 Bürgerliche in den diplomatischen Dienst Frankreichs. Zumeist wurden bürgerliche Diplomaten jedoch nicht in exponierten Auslandsvertretungen als Botschafter eingesetzt163. Da die französischen Diplomaten das republikanische Regime vertraten, fanden sie in Berlin, selbst wenn sie adeliger Herkunft waren, nur schwer Aufnahme in die Salons. Für den ersten „bürgerlichen“ französischen Botschafter in Berlin, Jules Herbette, den die deutsche Presse abfällig als „Herr Bête“ („Herr Dummkopf“) bezeichnete, war es fast unmöglich164. Sein Nachfolger, der Marquis de Noailles, ab 1896 in Berlin als Botschafter akkreditiert, fand dagegen aufgrund seines klangvollen Namens problemlos Zugang zur Berliner Gesellschaft.
Während der gut 40 Jahre zwischen Frankfurter Frieden und Ausbruch des Ersten Weltkriegs kam es weder zu einem offiziellen noch zu einem privaten Besuch eines deutschen oder französischen Staatsoberhaupts im jeweils anderen Land. Außer der Teilnahme des französischen Außenministers William Henry Waddington beim Berliner Kongress 1878 ist überdies kein offizieller Aufenthalt eines deutschen oder französischen Außenministers im anderen Land zu verzeichnen. Théophile Delcassé reiste in seiner Zeit als französischer Außenminister zwischen 1898 und 1905 zwar mehrfach über Berlin nach St. Petersburg, ließ in der deutschen Hauptstadt aber nicht einmal seine Karte an den deutschen Kollegen übergeben. An dynastischen Ereignissen wie der Beerdigung Wilhelms I. 1888 oder der Verlobungsfeier des Kronprinzen 1905 in Berlin nahmen französische Delegationen allerdings teil. Ebenso kam es in Drittländern zu deutsch-französischen Zusammenkünften: Wilhelm II. traf am 23. Mai 1910 in London bei den Feierlichkeiten zur Beisetzung von Eduard VII. auf den französischen Außenminister Stéphen Pichon. Darüber hinaus fanden mehrere Besuche in den jeweiligen Botschaften statt und mehrfach kam es zu Inkognito-Besuchen von Mitgliedern deutscher Fürstenhäuser in Paris. So reiste 1890 die als Kaiserin Friedrich bezeichnete Victoria, die Mutter von Wilhelm II., nach Paris und löste aufgrund ihres als Provokation empfundenen Besuchs des Schlosses von Versailles eine antideutsche Kampagne in Teilen der rechten Presse Frankreichs aus165.
Staatsbesuche in Drittländern spielten eine wichtige symbolische Rolle für die beiderseitigen Beziehungen. In der Auswahl der Einladungen, in Inszenierungen und im Ringen um diplomatische Abläufe zeigte sich, wie stark die deutsche und die französische Besuchspolitik aufeinander bezogen waren166. So hielt sich der russische Zar Alexander II. 1872 zur gleichen Zeit wie der österreichische Kaiser Franz Joseph in Berlin auf. Die Besuche wurden aufwendig inszeniert und sollten neben der monarchischen Solidarität gleichzeitig die internationale Isolation Frankreichs deutlich machen167. Die Besuchspolitik des Kaiserreichs entsprach somit der generellen außenpolitischen Linie und war darüber hinaus gezielt auf eine Demütigung Frankreichs angelegt. Ein weiteres Beispiel dafür ist die Reise des spanischen Königs Alfons XII. ins Elsass 1883. Für die Rückreise – aber eben erst an zweiter Stelle – war ein Empfang in Paris geplant. Die gezielte Provokation, den spanischen Monarchen in Straßburg zum Ehrenkommandeur eines der elsässischen Regimenter der preußischen Armee zu ernennen, ging auf: In Paris erwartete ihn eine aufgebrachte Menschenmenge und er musste seinen Besuch in der französischen Hauptstadt vorzeitig abbrechen168.
Umgekehrt war die französisch-russische Annäherung, die sich in den gegenseitigen Flottenbesuchen 1891 in Kronstadt und 1893 in Toulon sowie im Parisbesuch des Zaren 1896 zeigte, für die Dritte Republik nicht nur ein Schritt aus der außenpolitischen Isolierung, sondern zugleich eine Geste gegen das Kaiserreich. Alfred von Bülow, deutscher Geschäftsträger vor Ort in Kronstadt, berichtete an das Auswärtige Amt, dass der Zar einen Toast auf den französischen Präsidenten ausgebracht und sogar die Marseillaise, die als Revolutionshymne bis dahin als nicht vereinbar mit dem diplomatischen Protokoll gegolten hatte, „stehend und mit entblößtem Haupt“169 angehört hatte. Die Sympathiebekundungen einer Monarchie kamen einer „spektakulären Anerkennung der Dritten Republik“170 gleich, was selbst im Lager ihrer innenpolitischen Gegner als Erfolg verbucht wurde. Mit der Annäherung an Russland, dem autokratischsten Regime in Europa, wurden jedoch republikanische Prinzipien übertreten. Hier zeigte die französische Außenpolitik eine „imperiale Logik“171, die gegen ihre moralische Definition der Allianzen verstieß. In der deutschen Öffentlichkeit löste die französisch-russische Annäherung einen „regelrechten Schock“172 aus. Presse und Öffentlichkeit verfolgten die gegenseitigen Besuche sehr genau und trugen zur Interpretation der symbolischen Handlungen bei. So hatte ein französischer Geschäftsmann zum Empfang des Zaren in Paris 1896 ein Spielzeug mit dem sprechenden Namen „Le coup de pied à Guillaume“ auf den Markt gebracht, das Nikolaus II. zeigte, wie er seinem Cousin Wilhelm II. einen Fußtritt verpasste173.
Doch auch in der symbolischen Politik gab es Momente der Aussöhnung zwischen beiden Ländern, die gleichwohl zahlreiche Hindernisse überwinden mussten. So sorgte die Einladung an die französische Flotte, an der Eröffnung des Kaiser-Wilhelm-Kanals (ab 1948 Nord-Ostsee-Kanal) im Juni 1895 teilzunehmen, in Frankreich für Diskussionen. Politiker und Presse fürchteten, Kaiser Wilhelm II. würde die Annahme der Einladung als politisches Zeichen der Annäherung überinterpretieren und es könnte vom Protokoll auferlegte erniedrigende Zeremonien während der Feierlichkeiten geben. Zudem war man um das sich gerade anbahnende freundschaftliche Verhältnis zu Russland besorgt174. Der Besuch fand schließlich statt, wobei Frankreich die Geste symbolisch durch ein gemeinsames Einlaufen seiner Schiffe mit der russischen Flotte absicherte. Zudem ankerten beide Flotten Seite an Seite im Kieler Hafen. Von deutscher Seite hatte man der französischen Forderung nachgegeben, der zufolge kein nach einer Schlacht des Deutsch-Französischen Kriegs benanntes Schiff an den Manövern teilnehmen sollte.
Eine Möglichkeit zum Besuch der französischen Hauptstadt ergab sich für Wilhelm II. im Jahr der Weltausstellung 1900. In der Tageszeitung „Gaulois“ wurde im Vorfeld eine Umfrage unter Intellektuellen und Politikern durchgeführt. Die Antwort auf die Frage „Peut-il venir?“ („Kann er kommen?“) war ein einvernehmliches „Non“, dem bisweilen Drohungen in den Antworten folgten175. Französische Regierungskreise standen einem Besuch des Kaisers ebenso ablehnend gegenüber, wollte man doch keinesfalls den Eindruck einer symbolischen Anerkennung der Abtretung des Elsass und Lothringens entstehen lassen. Wenn es zu keinen offiziellen Staatsbesuchen zwischen beiden Ländern kam, so auch, weil man auf französischer Seite der Meinung war, „dass sich das innenpolitische Risiko außenpolitisch gar nicht bezahlt machen werde“176. Außerdem wollte die französische Politik gerade durch die Tatsache, dass andere Staatsoberhäupter regelmäßig nach Paris kamen, Deutschland eine diplomatische Niederlage zuführen: Denn während Frankreich um 1905 seinen Platz in den internationalen Beziehungen wieder voll und ganz eingenommen hatte, hatte sich das Deutsche Kaiserreich zum selben Zeitpunkt in eine außenpolitische Isolation manövriert, die sich auch an der zurückgehenden Anzahl an Staatsbesuchen zeigte177.
Außenpolitik im Imperialismus
Der Wetteifer der Großmächte um weltweiten Einfluss und Kolonien rückte ab den 1890er-Jahren immer stärker in den Vordergrund. Von „Prestigetaumel und Raumwahn“178 ergriffen, galt den imperialen Mächten ein Platz an der Spitze der Rangliste der Nationen als oberstes Ziel, ein Rang, der sich in vermeintlich objektiven Leistungsstatistiken wie Handelsbilanzen und Produktionszahlen, Bruttoregistertonnen sowie Geburtenquoten messen und vergleichen ließ. Der Dualismus von französischer décadence einerseits und deutschem Wachstum und Stärke andererseits bestimmte in beiden Ländern gleichermaßen die Vorstellungswelt von Politikern und Öffentlichkeit. Ein stark expandierendes Deutschland stand in diesen Bilanzen einem stagnierenden Frankreich gegenüber. Während die Bevölkerung zwischen 1880 und 1900 in Deutschland um 25 % und in Großbritannien um 23 % anstieg, betrug das Wachstum in Frankreich im selben Zeitraum nur 5 %. Der Außenhandel stieg in Deutschland um 53 %, in Großbritannien um 18 % und in Frankreich um 6 %. Frankreich war zwar international nicht völlig abgehängt, litt aber im Spiegel dieser Vergleiche179. Klagen über den eigenen Niedergang wurden in Frankreich vor allem im rechten Lager sowie in der republikanischen Mitte geführt, die Warnungen dabei stets mit Kritik am Regime und seiner Politik verbunden. Umgekehrt hatte das rasche wirtschaftliche Wachstum im Kaiserreich ab den 1890er-Jahren ein übersteigertes Überlegenheitsgefühl zur Folge, das sich grundlegend auf die Politik gegenüber Frankreich auswirkte180. In Politik und Presse sah man – ähnlich der französischen antirepublikanischen Rechten – die Schuld für die angebliche französische décadence beim republikanischen System181.
Die zunehmende Einflussnahme von Presse und Öffentlichkeit hatte beiderseits des Rheins die „Medialisierung der auswärtigen Politik“182 zur Folge, die bereits zeitgenössischen Beobachtern unheimlich war. Die Presse spiegelte nicht nur Meinungen, sondern entwickelte sich zu einem selbstständigen Meinungsmacher und damit zu einem politischen Akteur. Medien spielten eine wichtige Rolle als Informationslieferant für Politiker, etwa wenn es um Stimmungen in anderen Ländern ging, da Presseerzeugnisse vielfach unterschiedslos als offiziöse Organe der Regierungen galten. Daneben zeigte sich eine zunehmende Militarisierung der Außenpolitik bei den europäischen Kräften. Indizien dafür waren das verschärfte Wettrüsten, die Erhöhung der Mannschaftsstärke des Heeres im Kaiserreich 1913 und die innenpolitisch umstrittene Verlängerung der Militärdienstzeit von zwei auf drei Jahre im Juli desselben Jahres in Frankreich, die ansteigenden Militärhaushalte und die regelmäßigen Vergleiche der Truppenstärken183. Zunehmend verbreitete sich die Vorstellung von der Unvermeidbarkeit eines Krieges, die nach 1911 durch die immer schnellere Abfolge von internationalen Krisen weiter verstärkt wurde184. Politiker und Journalisten beider Länder waren der Ansicht, die Aufrüstung erhalte das europäische Gleichgewicht, wobei sie die eigenen Rüstungen als Reaktion auf die Bedrohung durch die anderen Mächte rechtfertigten. Der bewaffnete Frieden, die paix armée, diente vor allem dazu, den Gegner abzuschrecken. Militärstrategische Planungen und Mobilisierungspläne gewannen bis 1914 stark an Gewicht. Die verbreitete Kriegsfatalität gipfelte in der Vorstellung vom revitalisierenden Präventivkrieg als Mittel der Politik. In „Deutschland und der nächste Krieg“ beschrieb Friedrich von Bernhardi Krieg als „biologische Notwendigkeit, ein Regulator im Leben der Menschheit“185. Unverhohlen riet der General a. D. zu einem Präventivkrieg gegen Frankreich. Das Buch wurde zwar von der kaiserlichen Regierung, von der Sozialdemokratie und von liberalen Zeitungen kritisiert, erfuhr in Deutschland jedoch mehrere Auflagen und wurde bereits im folgenden Jahr ins Englische, Französische, Italienische und Japanische übersetzt. Demgegenüber stand die Vorstellung der Pazifisten, der zufolge ein Krieg zwischen großen Industrienationen gar nicht möglich sei, eine Vorstellung, wie sie etwa der Russe Ivan Bloch in einem internationalen Bestseller vertrat, dessen Auflagenzahlen die von Bernhardi bei Weitem übertrafen186.
Nach 1905 erschütterten mehrere internationale Krisen Europa. Bewaffnete Konflikte blieben jedoch regional begrenzt und fanden nur an der Peripherie Europas statt. Mit der multilateralen Konferenzdiplomatie, die ihre Hochzeit zwischen 1900 bis 1913 hatte, und den Schiedssprüchen des internationalen Gerichts in Den Haag konnten Konflikte eingehegt und bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen den Großmächten vermieden werden187. Die Beilegungen der Krisen stellen nicht nur die Zwangsläufigkeit der Entwicklungen zu einem Weltkrieg infrage, sondern machen darüber hinaus deutlich, dass sich die internationalen Beziehungen nicht in einem einfachen Gegensatz beschreiben lassen. So konnte die erste Marokkokrise 1905/06, der erste deutsch-französische Konflikt nach mehr als 15 Jahren, auf der Konferenz von Algeciras gelöst werden. Dessen ungeachtet beeinflusste die Krise die öffentlichen Debatten in Parlament und Presse beider Länder für die folgenden Jahre, die von nationalistischen Tönen, Misstrauen und wachsenden Bedrohungsvorstellungen geprägt waren188. Gleichzeitig wurde deutlich, dass das Deutsche Reich auf der internationalen Bühne nur noch von Österreich-Ungarn unterstützt wurde. Die mit der Annäherung Frankreichs, Russlands und Großbritanniens einhergehende Verschiebung der internationalen Ordnung zu zwei relativ festen Blöcken zog zunehmend den Eindruck einer außenpolitischen und militärischen Alternativlosigkeit nach sich189. Gleichwohl bestand bis in die Julikrise hinein die Hoffnung, die Blockbildung würde sich nicht realisieren und manche Länder könnten aus einem Krieg herausgehalten werden. Die zweite Marokkokrise 1911 wird in der Forschung vielfach als Beginn der Vorkriegszeit interpretiert. Die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich verschlechterten sich zunehmend, auch wenn ein bilateraler Vertrag die Zwistigkeiten noch einmal friedlich beilegte190. Die für Frankreich günstige Vereinbarung, mit der das Land freie Hand in Marokko erhielt und dafür einen Teil seiner Gebiete im Kongo dem Kaiserreich überließ, löste im Deutschen Reich einen „innenpolitischen Proteststurm aus, wie ihn die deutsche Öffentlichkeit noch nicht erlebt hatte“191. Doch auch in Frankreich wurde die Vereinbarung als erniedrigend kritisiert192. Insgesamt stellten vor allem Presse und Öffentlichkeit die Verschlechterung der beiderseitigen Beziehungen und den Anstieg eines lärmenden Nationalismus fest, weniger die regierenden Politiker193. Die Balkankriege 1912/13, von denen die deutsch-französischen Beziehungen nicht direkt betroffen waren, erschwerten den Dialog und trugen damit zu einer weiteren Zuspitzung der Lage bei. Dennoch kam es selbst in den Jahren von 1911 bis 1914 zu deutsch-französischen und deutsch-britischen Kooperations- und Ausgleichsbemühungen im internationalen Rahmen. Krisenverschärfung einerseits und Kriegsprävention mit verschiedenen Kommunikations- und Deeskalationsmechanismen andererseits existierten nebeneinander194.
Ökonomische Rivalität und Kooperation
Bei den außenwirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich sind wie generell bei anderen Ländern in gleicher Weise sich überlagernde Prozesse von Rivalität und Verflechtung in einem zunehmend globalisierten und multizentrischen Weltmarkt zu beobachten195. Der innere Strukturwandel und die Nationalisierung der Ökonomien ab 1871 verliefen parallel zur Einbindung beider Länder in die Weltwirtschaft, was nicht immer konfliktfrei vor sich ging196. Beispiele dafür finden sich vor allem in der Landwirtschaft, wo die Globalisierung des Agrarmarkts zwar Reformen und Modernisierung, aber auch die Forderung nach Protektionismus hervorrief197. Parallel dazu nahm ein multilateraler Informationsaustausch über Konferenzen und neue Organisationsstrukturen zu. So wurden internationale Regelungen und Konventionen in Bereichen wie Post, Telegrafie, Patenten und Wechselrecht getroffen.
Nach dem Krieg 1870/71 gab es einen Einbruch in den beiderseitigen Handelsbeziehungen. Die Annexion Elsass und Lothringens bedeutete für Frankreich einen wirtschaftlichen Verlust vor allem in der Textil-, Metall-, Keramik- und Holzindustrie und hatte eine Umstrukturierung bei den im- und exportierten Gütern zur Folge198. Artikel 11 des Frankfurter Friedenvertrags bildete die Grundlage für den deutsch-französischen Handel: Die „Meistbegünstigungsklausel“ legte fest, dass mit anderen Ländern ausgehandelte Vergünstigungen zugleich auf das deutsch-französische Verhältnis anzuwenden waren, eine Regelung, von der vor allem Deutschland profitierte199. Für eine positive Entwicklung der deutsch-französischen Finanz- und Handelsbeziehungen sorgte trotz der Schutzzollpolitik die teilweise komplementäre Ausrichtung der Volkswirtschaften beider Länder200. So stand ein hauptsächlich auf Handels- und Industriekapitalismus ausgerichtetes Deutschland einem stärker auf Finanzkapitalismus ausgerichteten Frankreich gegenüber, wobei beide Volkswirtschaften sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts anglichen. Eine gegenseitige Abhängigkeit von Rohstoffen bestand im Bereich der Schwerindustrie. Während Deutschland in großem Umfang Eisenerze für die Stahlproduktion einführen musste, war Frankreichs Schwerindustrie auf Koks- und Kohleimporte angewiesen. Folglich erwarben einige deutsche Schwerindustrieunternehmen offen oder verschleiert Konzessionen und Beteiligungen an französischen Firmen, „misstrauisch beäugt von der französischen Presse“201. Zu den Unternehmern, die sich in Frankreich besonders engagierten, gehörte August Thyssen, der mit Blick auf die Erzvorkommen in der Normandie und vor allem im französischen Teil Lothringens aufgrund der kurzen Transportwege Konzessionen ankaufte. Analog dazu versuchten französische Unternehmen, Konzessionen an Kohlegruben in Deutschland zu erwerben. So besaß die Firma de Wendel im annektierten Teil Lothringens Kohlehütten und kaufte weitere Hütten in Westfalen dazu202.
Der deutsche Handel mit Frankreich wuchs ab 1890 im Vergleich zum Handel mit dem übrigen europäischen Ausland überproportional an. Die Steigerungsraten übertrafen sogar den Handel mit dem verbündeten Österreich-Ungarn. Insgesamt belegte Frankreich als Außenhandelspartner bei der Einfuhr jedoch nur Platz fünf, bei der Ausfuhr Platz vier. Umgekehrt war das Kaiserreich für Frankreich nach Großbritannien der zweitwichtigste Lieferant und der drittgrößte Absatzmarkt203. Dennoch war Deutschland als Handelspartner Frankreichs bis zum Ersten Weltkrieg im Vergleich zu den Jahren vor 1870 unterrepräsentiert204. Deutsche Unternehmen dominierten ab Ende des 19. Jahrhunderts in der Elektro-, Chemie- und Metallindustrie. Ein Wissenstransfer erfolgte dabei über die vor allem im Kaiserreich engen Bindungen der Industrie an die wissenschaftliche Forschung und über internationale Ausstellungen und Kongresse, bei denen Technik, Produkte und wissenschaftliche Innovationen vorgestellt wurden205. Aufgrund der unternehmerischen Rivalitäten waren diese Kongresse gleichzeitig Orte der Konkurrenz, die bisweilen auf eine „erbarmungslose Konfrontation“206 hinauslief. Unternehmen wie Hoechst, Bayer und BASF, die sich zu multinationalen Firmen entwickelten, kauften französische Chemiefabriken auf, um in Frankreich die Fertigstellung ihrer Produkte vornehmen und darüber die Einfuhrzölle umgehen zu können207. In Frankreich bestand neben dem Kohlebergbau Interesse am deutschen Absatzmarkt für landwirtschaftliche Erzeugnisse, Rohmaterialien, Spiegelglas, Textil-, Luxus- und Kolonialprodukte. Die französischen Unternehmen waren vor allem in Elsass-Lothringen ansässig, wo sich insgesamt 192 Firmen in französischem Besitz befanden. Daneben verfügten sie im Rheinland und in Großstädten wie Berlin, Hamburg oder Leipzig über Filialen. Alles in allem waren deutsche Unternehmen in Frankreich stärker präsent als französische in Deutschland208. Das gilt genauso für die Arbeitsmigration von einzelnen Personen wie etwa Kaufleuten, gelernten und ungelernten Arbeitern sowie Lehrerinnen, Gouvernanten und Dienstmädchen aus Deutschland, die zumeist begrenzt auf einige Jahre in die französische Hauptstadt zogen209. Nicht selten waren Geschäfts- und wirtschaftliche Studienreisen, die bisweilen Industriespionage miteinschlossen210. Insgesamt war die Zahl französischer zeitgenössischer Studien über die deutsche Wirtschaft sehr viel höher als umgekehrt211.
Die Unternehmen verfolgten klar gewinnorientierte Interessen und waren nicht – oder nur selten – vom Wunsch nach einer Annäherung auf politischer Ebene geleitet212. Mit ihrer Lobbyarbeit und den Versuchen der politischen Einflussnahme zur Erleichterung von Wirtschaftsbeziehungen wirkten sie dennoch ausgleichend auf die bilateralen Beziehungen. Wiederholt wurde als Antwort auf die Erhöhung der Schutzzölle 1879 in Deutschland oder 1881 und 1884 in Frankreich sowie 1891/92 in beiden Ländern von Einzelpersonen oder Interessenverbänden eine bilaterale oder eine mitteleuropäische Zollunion unter Einschluss von Deutschland und Frankreich gefordert213. Auf den internationalen Landwirtschaftskongressen ab 1889 war immer wieder von einem deutschfranzösischen, auf den Agrarmarkt beschränkten Zollverbund die Rede214. Ein solches Projekt des Elsässers Paul de Leusse von 1888 und 1890 wurde in Frankreich von Teilen der Presse zunächst befürwortet, von der Öffentlichkeit jedoch abgelehnt. Das Vorhaben konnte nicht umgesetzt werden, wäre eine Unterstützung der Initiative durch französische Politiker doch ihrem „politischen Selbstmord“215 gleichgekommen. Das Ziel einer Förderung der beiderseitigen Beziehungen auf wirtschaftlichem Gebiet verfolgten die beiden 1908 gegründeten Organisationen Deutsch-Französischer Wirtschaftsverein (DFW) und Comité commercial franco-allemand (CCFA)216. Über Lobby- und Pressearbeit, Austausch von Kontakten und Mitarbeit bei Zollfragen sowie bei der deutschfranzösischen Zollkonferenz 1913 engagierten sich die Mitglieder der Vereine, die in Wirtschaft und Politik tätig waren. Der CCFA reagierte außerdem ausgleichend auf die 1912 von einigen Intellektuellen ins Leben gerufene Kampagne in „Le Matin“ und anderen nationalistischen Zeitungen gegen die als „Invasion“ dargestellte starke Präsenz deutscher Produkte und Unternehmen in Frankreich217. Eine noch offensivere Kampagne gab es 1888 allerdings in Großbritannien mit der gesetzlichen Einführung des Labels „Made in Germany“, das, anders als intendiert, bald zu einem Gütesiegel für deutsche Produkte wurde. Die wirtschaftliche und demografische Dynamik Deutschlands ließ in Frankreich Unmut gegenüber der Industrie- und Handelsmacht des Nachbarn entstehen. Vor allem die kleineren und mittleren Unternehmen fürchteten die Konkurrenz aus Deutschland. Als „wirtschaftliches Sedan“ bezeichnete der französische Handelsminister 1886 das Ansteigen der deutschen Importe, eine Klage, die periodisch von verschiedener Seite geführt wurde218. Dass sich dennoch auch in „Le Matin“ Anzeigen deutscher Produkte wie Osram, Odol, Maggi, Benz oder Berlitz finden ließen, zeigt die Gleichzeitigkeit von Ablehnung und Geschäftsinteresse bis in die Presse hinein219.
Parallel zum Außenhandel nahm zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Umfang der Finanzbeziehungen zu, da die Banken die Kaufleute im Auslandshandel über Korrespondenzbanken unterstützten. Der Kapitalüberschuss in Frankreich und umgekehrt der hohe Kapitalbedarf in Deutschland ergänzten sich. Frankreich gehörte nach Großbritannien zu den wichtigsten Finanzgebern der Welt: 1914 waren rund 43 Milliarden Goldfrancs im Ausland platziert, eine Summe, die neunmal so hoch war wie das jährliche französische Staatsbudget220. Umgekehrt fehlte es im Kaiserreich an Kapital, um das im Zuge der „Weltpolitik“ politisch gewünschte weltweite Engagement deutscher Unternehmen zu unterstützen. Die privatwirtschaftlichen Interessen an funktionierenden globalen Finanzbeziehungen waren mithin so hoch, dass der Bankier Carl Fürstenberg von „natürlichen Assoziationen“ sprach, die sich gegen eine Politik der Nationalisierung sträubten221. In ihren Tätigkeiten ließen sich die Bankiers von Profit- und Kostenkalkulationen, nicht aber von patriotischem Denken leiten. Entsprechend komplex und vielfältig waren die beiderseitigen Finanzbeziehungen vor 1914. Einschränkungen erfuhr die Zusammenarbeit in der Hochfinanz durch das Verbot für französische Banken, deutsche Anleihegeschäfte sowie Industrie- und Bauprojekte deutscher „Weltpolitik“ zu finanzieren222. Zudem hatten deutsche Aktien und Anleihen keine Chance auf Zulassung zum amtlichen Handel an der Pariser Börse, was aber traditionell durch den informellen Kulissenhandel ausgeglichen wurde. Mit einer „diplomatie du franc“223 wollte Frankreich den eigenen Einfluss in der Welt erhöhen. Gleichzeitig galt es zu verhindern, mit französischem Kapital die ohnehin starke deutsche Industrie zu fördern und damit die militärische Macht und die Position des Kaiserreichs in der Welt zu stärken224.
Im Zuge des ausgreifenden Wirtschaftsimperialismus der Großmächte wurden Investitionen zumeist im Bereich Infrastruktur wie Transport, Telekommunikation, öffentliche Bauvorhaben und Minen sowie Staatsanleihen getätigt, die bisweilen eine staatliche Garantieübernahme der jeweiligen Großmächte notwendig machten225. Botschaften, Konsulate und Verwaltungseinheiten vor Ort fungierten als Vermittler zu den Banken bei der Vergabe von Aufträgen der öffentlichen Hand, sodass oftmals die Grenzen zwischen staatlichen und privatwirtschaftlichen Interessen verschwammen. Die Anzahl der von deutschen und französischen Banken gemeinsam durchgeführten imperialistischen Projekte war hoch: Rund 5,5 Milliarden Francs wurden von deutschen und französischen Banken zwischen 1890 und 1906 in gemeinsame Fonds oftmals mit britischen und amerikanischen Banken investiert. Gerade auf dem Balkan und in der Türkei waren die Interessen stark miteinander verknüpft und zumindest in Teilen komplementär. Darüber hinaus gab es Finanzkooperationen u.a. in China, Ägypten, Skandinavien sowie in mehreren lateinamerikanischen Ländern226. Nicht immer deckten sich politische Strategien der einzelnen Länder und Interessen ihrer Hochfinanz, wie etwa der umfangreiche Kapitalexport französischer Banken ab 1887 nach Russland zeigte, als das Zarenreich noch zu den Bündnispartnern Deutschlands gehörte. Über die Finanzpolitik ließ sich eine Annäherung erreichen, die diplomatisch zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich war.
Ein Beispiel für die politischen Unwägbarkeiten der internationalen Kooperation stellt der Bau der Bagdadbahn dar, einer Eisenbahnstrecke durch das Osmanische Reich bis nach Bagdad, die planerisch und finanziell federführend von deutschen Akteuren verantwortet wurde. Die französische Regierung stand einer Beteiligung französischer Banken ablehnend gegenüber und verbot der Banque impériale ottomane, die mehrheitlich von französischen Banken kontrolliert wurde, Aktien und Anleihen der Gesellschaft an der Pariser Börse zu emittieren. Dennoch kam es 1903 zur Gründung der Bagdadbahngesellschaft unter internationaler Beteiligung. Im Februar 1914 wurde die deutsch-französische Finanzentente zwar formell aufgelöst. Doch fanden die Banken Mittel und Wege, um eine finanzielle und informelle Beteiligung weiterzuführen. Auf diese Weise flossen französische Gelder weiter in den Bau, zum Teil verschleiert unter Mithilfe der Deutschen Bank227. Deren Hauptgegner im Osmanischen Reich kam mithin nicht aus Frankreich, sondern mit der Deutschen Orientbank, einer von der Dresdner Bank vor Ort gegründeten Filiale, aus Deutschland. Auf der Seite der Unternehmen und Banken war das Verhältnis von Kooperation und Konkurrenz also komplex. Auf der Seite der Politik war es dagegen eindeutig: Die deutsche Seite trat gegenüber Großbritannien konzessionsbereiter auf als gegenüber Frankreich, da mit London gleichzeitig ein „langfristig besseres Verhältnis angestrebt“228 wurde und man sich gegenüber Paris mit der Einigung in Sachfragen zufriedengab. Die französische Regierung tat umgekehrt alles, um Kapitalflüsse ins Kaiserreich zu begrenzen. Während die Geschichtsschreibung des Imperialismus vor allem die deutsch-französische politische Konkurrenzsituation beleuchtet, wird übersehen, dass die Bagdadbahn aus finanzhistorischer Sicht ein von „Erfolg gekröntes deutsch-französisches Joint Venture“229 war. Fast die Hälfte der Finanzierung für deren Bau kam aus dem Ausland, allen voran aus Frankreich. Der Anteil dürfte sogar noch höher liegen, doch die Herkunft des Geldes lässt sich aufgrund der verschiedenen Zwischentransaktionen nicht mehr in allen Fällen nachvollziehen.
In anderen Regionen war das wirtschaftliche Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Frankreich konflikthafter. Industrielle Rivalität gab es etwa in Bulgarien, wo 1904 Krupp und Schneider jeweils um Aufträge für Rüstungsgüter konkurrierten230. In Marokko widersetzte sich die französische Regierung 1909 trotz des internationalen Abkommens zur wirtschaftlichen Offenheit des Landes der Vergabe von Konzessionen für den Bau von Eisenbahnen an deutsche Firmen. Zudem wurden deutsche und italienische Banken nach 1911 von einer Beteiligung an der Emission von Staatsanleihen und vom Aufbau der marokkanischen Staatsbank ausgeschlossen231. So blieben die Verbindungen zwischen den Banken nach der Agadirkrise 1911 von den politischen Spannungen nicht unberührt und eine Tendenz zur Politisierung der internationalen Kapitalströme zeichnete sich ab. Die französischen Banken sahen sich gegen ihren Willen gezwungen, ihre finanzielle Beteiligung an weltweiten gemeinsamen Projekten zu reduzieren. In der Folge kamen verschiedene Vorhaben nicht mehr zustande232. Stärker als die deutschen widersetzen sich die französischen Banken den beschränkenden Vorgaben ihres Außenministeriums. Eine tatsächliche Nationalisierung der Finanzbeziehungen gelang vor 1914 jedoch weder der deutschen noch der französischen Regierung233.
Ungeachtet der Einschränkung der finanziellen Zusammenarbeit, der verschärften Zollschikanen ab 1912/13 sowie der „Vervielfachung der Schwierigkeiten bei der wechselseitigen Interessenverflechtung“234 kamen die deutschfranzösischen Wirtschaftsbeziehungen nach 1911 nicht zum Erliegen. So störten Zollerhöhungen vor 1914 zwar den deutsch-französischen Handel, führten aber kaum zu Rückgängen. Vielmehr verzeichnete der Handel zwischen beiden Ländern aufgrund von sinkenden Transportkosten einen Aufschwung235. Die Intensivierung der weltweiten und auch deutsch-französischen Wirtschafts- und Finanzverflechtungen verlief nicht parallel zu den wechselhaften politischen Beziehungen. Noch bis zum Sommer 1914 war ein Großteil der Bankiers und Wirtschaftsakteure der Meinung, dass ein Krieg aufgrund der starken Handels- und Finanzverflechtung in Europa für die Politik keine Option sein könne, was sich als fatale Täuschung erwies236. Zugleich zeigt ein um finanz- und handelspolitische Fragen erweiterter Blick auf die internationale Diplomatie vor 1914 die Komplexität der Beziehungen, die sich nicht auf einen einfachen Antagonismus reduzieren lassen.
Provinces perdues: das Reichsland Elsass-Lothringen
Die nach dem Krieg 1870/71 vom Deutschen Kaiserreich annektierten französischen Regionen Elsass (ohne Belfort) und ein Teil Lothringens stellten in der Folgezeit das stärkste Konfliktfeld für die deutsch-französischen Beziehungen dar. Insgesamt vier Mal mussten Elsässer und Lothringer in der Zeit von 1871 bis 1945 die Nationalität wechseln, ein Thema, das bis heute in Literatur und Kino in Frankreich eine große Rolle spielt237. Die Folge waren scharfe politische Divergenzen, deutsch-französische Brüche bis in die Familien hinein sowie das Entstehen eines regionalen Partikularismus238. Dabei hatte die geografische Lage den Grenzgebieten, die erst nach der Annexion 1871 von deutscher Seite zu einer Einheit „Reichsland Elsass-Lothringen“ definiert wurden, eine Brückenfunktion zwischen beiden Ländern gegeben. Daraus resultierte ein verflochtenes kulturelles Erbe, politisch jedoch belastet durch wechselseitige territoriale Ansprüche seit der Eingliederung des Elsass in Frankreich im 17. Jahrhundert. Die neuere Forschung hat mit Blick auf sprachliche, kulturelle, politische, religiöse und soziale Aspekte auf die komplexe Identität im Elsass und in Lothringen hingewiesen. So sprach zwar die Mehrheit der Bevölkerung der annektierten Gebiete um 1871 Deutsch und einen elsässischen Dialekt. Im Hinblick auf ihre nationale Zugehörigkeit tendierte sie jedoch seit der Französischen Revolution nach Frankreich239. Diese Ambivalenz stellte das Deutsche Kaiserreich vor eine Herausforderung. Mit politischen Maßnahmen wurde versucht, für eine größere Eindeutigkeit und für die Germanisierung der Gebiete zu sorgen. Die Dritte Republik dagegen hielt mit konjunkturell schwankender Intensität die Erinnerung an die „verlorenen Provinzen“ wach. Trotz der Bemühungen von deutscher Seite, die Spuren der französischen Zugehörigkeit auszulöschen und die Kontakte nach Frankreich zu unterbinden, war Elsass-Lothringen nach 1871 der Ort, an dem die Gleichzeitigkeit von Verfeindung und Verflechtung zwischen Deutschland und Frankreich am deutlichsten zutage trat.
Option und Migration
Artikel 2 des Frankfurter Friedensvertrags vom 10. Mai 1871 sah für die Bewohner in Elsass und Lothringen die Möglichkeit vor, für die französische Nationalität zu „optieren“. In diesem Fall mussten sie die annektierten Gebiete bis zum 1. Oktober 1872 verlassen. Die Mehrheit der Elsässer und Lothringer war gegen die Annexion und für einen Verbleib bei Frankreich240. Für sie bedeutete die Annexion ein schwerwiegendes Dilemma: Einerseits wollten sie die französische Nationalität nicht verlieren, andererseits ebenso wenig ihre Heimat verlassen und ins Exil gehen. Überdies gab es Unsicherheiten in Bezug auf die Verwaltungsabläufe bei der Option, die komplex und für den Einzelnen schwer verständlich waren. Viele dachten – nicht zuletzt aufgrund der profranzösischen Agitation der Ligue d’Alsace –, sie könnten nach der Option und einem kurzen Aufenthalt in Frankreich in ihre Heimat zurückkehren. Die Debatten über das Für und Wider von Option und Emigration zeigten die Vielschichtigkeit der Gründe sowie die große Betroffenheit der Einzelnen241. Für die Entscheidung waren weniger anti-deutsche Gefühle maßgeblich als eine generelle nationale Präferenz für Frankreich und für das republikanische Regime242. Denn mit der Option entschied man nicht nur über die nationale Zugehörigkeit, man wählte zugleich zwischen Republik und Monarchie. Neben persönlichen, politischen und wirtschaftlichen Gründen spielte die religiöse Zugehörigkeit, die eng verbunden mit den politischen Überzeugungen war, eine große Rolle bei der Entscheidung für oder gegen die Option. So war in den katholischen Gebieten die Anzahl der Optionen weitaus höher als in den protestantischen, erwarteten sich Lutheraner und Kalvinisten von der Zugehörigkeit zum preußischprotestantisch geprägten Deutschen Kaiserreich doch eher Vorteile, während Katholiken und Juden eine Einschränkung ihrer Rechte befürchteten. Besonders hoch war die Anzahl der optierenden und emigrierenden jungen Männer, die dem deutschen Militärdienst entgehen wollten243.
Rund 161.000 Personen optierten für Frankreich, wobei viele das Land nicht verließen, sodass ihre Option später aberkannt wurde. Mit etwa 128.000 Personen wanderten in den ersten Jahren 8,5 % der Bevölkerung aus Elsass und Lothringen aus. Überwiegend handelte es sich dabei um junge Leute zwischen 17 und 20 Jahren sowie um frankophile Notabeln, Führungskräfte, Arbeiter und Handwerker244. Der Großteil von ihnen stammte aus den Städten. Viele ließen sich kurz hinter der Grenze nieder, um den Kontakt zu ihrer Heimat aufrechterhalten zu können. Der grenzüberschreitende Arbeitsmarkt funktionierte nach 1871 weiterhin sehr gut245. Auch die Wirtschaftselite verließ zu großen Teilen die annektierten Gebiete und eröffnete neue Produktionsstätten in Frankreich. Der unmittelbare Verlust an Kapital und Wissen durch das Abwandern von Unternehmern und Industriellen war erheblich246. Spezialisierte Agenturen vermittelten vor allem im Norden des Elsass Verträge für eine Auswanderung in die USA. Algerien zog ebenso zahlreiche Elsässer und Lothringer an, stellte diese französische Kolonie doch seit dem Second Empire ohnehin ein traditionelles Auswanderungsziel dar247. Die Emigration, die in Teilen auch ohne die Annexion stattgefunden hätte und nach 1871 weiter anhielt, war nur der eine Aspekt der demografischen Umwälzung in der Region: Den anderen stellte die Zuwanderung aus dem Deutschen Reich dar. Vor allem Verwaltungsbeamte, Lehrer und Angehörige des Militärs migrierten nach der Annexion in die Städte Elsass-Lothringens. 41,5 % davon kamen aus Preußen. Im Zuge der Industrialisierung zogen in den Folgejahren zudem Unternehmer und Arbeiter ins Reichsland. Diese sogenannten „Altdeutschen“ (vieux-allemands) stellten 1910 rund ein Sechstel der Bevölkerung248.
Mit regionalen Nuancen kam es in Elsass-Lothringen wie im Kaiserreich zu einer starken Verstädterung im Zuge der Industrialisierung. Insgesamt waren im Jahr 1907 48 % der Bevölkerung in der Industrie und 31 % in der Landwirtschaft tätig, ein Verhältnis, das eher der Aufteilung in Deutschland als der in Frankreich zur selben Zeit entsprach249. Während die Gesamtzahl der Einwohner durch die Migrationsbewegungen gleich blieb, änderte sich die soziale Schichtung der Bevölkerung: Die Gruppen der Angestellten in Handel, Industrie, Banken und Verwaltung sowie die Lehrenden nahmen am stärksten zu250.
Verwaltung: Zwischen Fremdherrschaft und Integration
Die annektierten Gebiete wurden von Bismarck als „Reichsland“ in das neu gegründete Deutsche Kaiserreich integriert251. Damit gehörte es gleichzeitig allen deutschen Staaten und unterstand direkt dem Kaiser. Verwaltet wurde das Reichsland zunächst von einem Oberpräsidenten, mit der Verfassung von 1879 dann von einem Statthalter als jeweils direktem Vertreter des Kaisers. Der Status als nicht selbstständiger Bundesstaat wies Elsass-Lothringen im Vergleich zu den anderen deutschen Staaten nicht nur eine untergeordnete Rolle zu. Er passte auch nicht in die Verwaltungsstruktur des Kaiserreichs. Dies führte vor allem in den Jahren von 1871 bis 1879 häufig zu Änderungen und Experimenten in Politik und Verwaltung. Eine Schwierigkeit war der Kampf zwischen ziviler und militärischer Herrschaft um die führende Rolle, ein generelles Grundproblem des Kaiserreichs, das sich in Elsass-Lothringen besonders deutlich zeigte. Die deutsche Politik schwankte zwischen den Alternativen, das Reichsland als erobertes, feindliches Gebiet zu verwalten oder es als selbstständig werdenden Staat in das Kaiserreich zu integrieren. Grundlegend für die unschlüssige und inkonsequente Politik war der Konflikt, der sich aus den Bedürfnissen nach militärischer Sicherheit einerseits und dem Ziel der Germanisierung der Gebiete andererseits ergab. Für das Selbstverständnis der Bevölkerung wirkte die Vorstellung freilich abstoßend, nur als Schutzwall gegen einen neuerlichen Angriff Frankreichs annektiert worden zu sein252. 1874 bekam das Reichsland zwar 15 Sitze im Reichstag, durfte jedoch nach wie vor keinen Vertreter in den Bundesrat entsenden. 1875 wurde ein Landesausschuss gegründet, in dem gewählte Vertreter saßen, die eine beratende Funktion ohne echten politischen Einfluss hatten. Hervorstechendstes Merkmal für die Bevormundung des Reichslands war der sogenannte Diktatur-Paragraf, der bis 1902 gültig war. Er ermächtigte den Oberpräsidenten und später den Statthalter, für die Wahrung der Sicherheit und der öffentlichen Ordnung jede beliebige Maßnahme zu ergreifen253. Zumeist wurde er für das Verbot von Zeitungen und für die Ausweisung von profranzösischen Agitatoren verwendet. Erst mit der Verfassungsreform 1911 bekam Elsass-Lothringen einen Landtag und damit eine eigene gesetzgebende Kammer. Da sich Berlin jedoch ein Vetorecht für die Gesetzgebung vorbehielt und es nach wie vor keinen Staatschef gab, war die Verfassung von 1911 mit ihrem Zugeständnis der „überwachten Freiheit“254 eine Enttäuschung für die Bevölkerung255.
Die Elsässer und Lothringer nahmen die preußische Verwaltung vor allem in den Anfangsjahren als Fremdherrschaft wahr und sahen sich aufgrund der fehlenden Staatsbürgerrechte und der mangelnden Regierungsautonomie als Bürger zweiter Klasse. In der Folge entwickelte sich die Protestbewegung, die bis ca. 1890 diejenigen vereinte, die die Rechtmäßigkeit der Annexion bestritten, eine Zusammenarbeit mit den Deutschen ablehnten und eine Volksabstimmung über die nationale Zugehörigkeit forderten. Ab etwa 1890 wurde die Protest- von der Autonomiebewegung abgelöst, deren Ziele sich alle politischen Strömungen in unterschiedlichem Ausmaß zu eigen machten256. Sie akzeptierte überwiegend die Eingliederung Elsass-Lothringens in das Kaiserreich, forderte jedoch weitergehende Autonomie und Gleichstellung mit den anderen Bundesstaaten. In der Verlängerung entwickelte sich eine vielfältige, auch kulturelle Regionalismusbewegung257. Als weitere politische Kraft traten die Katholiken auf, die als Antwort auf den Kulturkampf und die repressiven Maßnahmen die Interessen der katholischen Kirche verteidigten. Erst um die Jahrhundertwende fassten die politischen Parteien des Kaiserreichs in Elsass-Lothringen Fuß und die politische Landschaft glich sich der im Reich an. Drei große politische Kräfte dominierten dabei: Als erste Partei stellten 1893 die Sozialdemokraten mit August Bebel in Straßburg und Wilhelm Liebknecht in Metz Kandidaten für die Reichstagswahlen in Elsass-Lothringen auf258. Die katholische Zentrumspartei und die Deutschkonservative Partei (DKP) stellten die Hauptbastion des Bürgertums gegen die organisierte Arbeiterbewegung. Die Zentrumspartei war trotz der expliziten Referenz unabhängig von der gleichnamigen Fraktion der Zentrumspartei im Reichstag259. Die liberalen Parteien (Nationalliberale und Fortschrittliche) vertraten die Interessen des Bürgertums, der Protestanten und eines Teils der „Altdeutschen“. Sie unterschieden sich von den stärker nationalistisch ausgerichteten liberalen Kräften im Kaiserreich260.
Politik der Germanisierung: französische Einflüsse zurückdrängen
Die Übernahme der Verwaltung des Reichslands war ein langwieriger Prozess, der teilweise zu einer kuriosen deutsch-französischen Mischung aus Vorgaben und Gesetzen führte. In vielen Bereichen wurden nach 1871 administrative, juristische und politische Gegebenheiten zunächst übernommen, ehe sie nach und nach – stets langsam, oft widersprüchlich und teils unvollständig – durch neue bzw. im Deutschen Kaiserreich gültige Regelungen ersetzt wurden. Als wichtigste Maßnahmen wurden alle französischen Beamten durch deutsche ersetzt und Deutsch zur Verwaltungssprache erklärt, wobei das Französische noch bis 1881 toleriert wurde. Der Militärdienst galt verpflichtend bereits ab dem 1. Oktober 1872. Erst 1876 wurde dagegen mit der Mark die deutsche Währung eingeführt, und es eröffneten die ersten Filialen der Reichsbank. Bei der Feuerwehr wurden noch bis 1887 französische Uniformen toleriert261. Der code Napoléon und Teile des französischen Rechts blieben wie in den übrigen linksrheinischen Gebieten bis zum 1. Januar 1900 gültig, dem Tag, an dem das Bürgerliche Gesetzbuch in Kraft trat. Das führte zur grotesken Situation, dass Elsässer und Lothringer für das Singen der republikanischen Marseillaise – ein Zeichen des Widerstands gegen die deutsche Herrschaft – nach einem Gesetz des französischen Strafrechts aus dem Jahr 1822 verurteilt wurden262. Ein äußerst heikles Problem war die Frage der Grenzziehung der katholischen Diözesen, die nicht mit den neuen politischen Grenzen übereinstimmten. Bis 1874 hatten französische Bischöfe Jurisdiktion über Gebiete, die mittlerweile deutsch waren, während zur Diözese von Metz, die ab 1871 einem deutschen Bischof unterstand, französisches Gebiet gehörte263. Hinzu kamen grenzüberschreitende Pfarrbezirke, die eine Integration bewirkten264. Diese Besonderheiten setzen sich nach 1918 fort. So fand beispielsweise das in Frankreich 1905 verabschiedete Gesetz zur Trennung von Kirche und Staat bis heute keine Umsetzung in den damals zum Kaiserreich gehörenden Gebieten265.
Zu den wichtigsten Maßnahmen der Germanisierungspolitik gehörten der dreijährige Militärdienst sowie der für Jungen und Mädchen verpflichtende Schulunterricht. Über die Vermittlung der deutschen Sprache, Geschichte und Kultur sollten die Kinder Loyalität zu Kaiser und Reich erlernen266. Doch bei der Sprachregelung gab es keine Eindeutigkeit: In den überwiegend französischsprachigen Gebieten Lothringens konnten in den Grundschulen Lesen und Schreiben weiterhin auf Französisch gelehrt werden267. Elsässische Lehrerinnen leisteten nicht geschlossen Widerstand gegen die Germanisierung, sondern beteiligten sich aktiv an der deutschen Nationsbildung268. Die Betonung der gemeinsamen Geschichte, die Unterstützung des deutschen Vereinswesens und der Kult des Kaisers, dessen Büste in allen Schulen stand und dessen Geburtstag und Besuche im ganzen Land gefeiert wurden, waren weitere Elemente der erzieherischen Germanisierung. Diese Maßnahmen verfolgten eine mindestens doppelte Zielrichtung, indem sie die lokale, aber auch die französische Bevölkerung beeindrucken und von der deutschen Überlegenheit überzeugen sollten. Das zeigte sich ebenso an der am 1. Mai 1872 eröffneten Kaiser-Wilhelm-Universität in Straßburg. Sie wurde als Modell der modernen Universität aufgebaut, mit einer großen Bibliothek als Herzstück269. Durch eine attraktive Besoldung und den Appell zur Teilnahme an einer „nationalen Mission“ gelang es, führende deutsche Professoren nach Straßburg zu holen und so den Grundstein für den guten Ruf der Universität zu legen. Die naturwissenschaftlichen Fakultäten brachten fünf Nobelpreisträger hervor, darunter Wilhelm Röntgen und Karl Ferdinand Braun. Bei den Geisteswissenschaften zählten der Kunsthistoriker Georg Dehio und der Mediävist und Leiter der Monumenta Germaniae Historica Harry Bresslau, der im „Berliner Antisemitismusstreit“ gegen Treitschke auftrat, zu den prominenten Persönlichkeiten. Hinzu kam eine städtebauliche und architektonische Germanisierung durch den Neubau zahlreicher eindrucksvoller Verwaltungsgebäude, Bahnhöfe, Postämter, Schulen, Kasernen und Kirchen270. Straßburg sollte die Größe und Modernität des Kaiserreichs verbildlichen. In Metz wurde eine umfangreiche Stadterweiterung unter militärischen Gesichtspunkten mit deutsch-nationalen Architekturformen aufgelegt, an der Wilhelm II. maßgeblich mitarbeitete. Der neoromanische Bahnhof und die Oberpostdirektion sind hierfür Beispiele. Die Neustadt in Metz wurde stilistisch älter als die eigentliche Altstadt angelegt, um die deutsche Vergangenheit der Stadt zu demonstrieren. Obgleich Gotik und deutsche Renaissance als stilistische Leitmotive bei den Neubauten vorherrschten, gab es keinen einheitlichen Reichsland-Stil271. Die städtebauliche Germanisierung sollte vor allem über eine Abkehr von bisherigen französischen Baustilen erfolgen. Französische Reisende sowie elsässische und lothringische Beobachter sparten nicht mit ästhetischer Kritik an den Machtbauten, die der lothringische Schriftsteller Émile Hinzelin als „architektonische Verbrechen“ in einem Katalog sammelte272.
Neben der offiziellen Politik spielten Begegnungen und ab Mitte der 1890er-Jahre die zunehmende Vermischung zwischen „Altdeutschen“ und Elsass-Lothringern in Beruf, Alltag, Vereinen, im religiösen Leben sowie in Publikationen eine Rolle bei der Integration in das Kaiserreich. Zur gleichen Zeit gelang der elsass-lothringischen Wirtschaft die Anpassung an den deutschen Markt. Im Zuge des konjunkturellen Aufschwungs im Kaiserreich entstanden vielfältige Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zu den deutschen Ländern. Die Textilindustrie sowie die Lebensmittel- und Weinproduktion fanden im Kaiserreich neue Absatzmärkte. In der Eisen- und Stahlindustrie entwickelten sich zwischen Lothringen und Ruhr enge Verbindungen. Der neue Rheinhafen in Straßburg ließ nicht nur den Transportverkehr ansteigen, sondern zog auch weitere Industrieansiedlungen nach sich273. Die Arbeiterklassen in Elsass-Lothringen handelten stärker in einem nationalen als in einem regionalen Kontext und sorgten damit ebenfalls für die Integration. Positiv auf ihre Hinwendung zum Kaiserreich wirkten sich das Ende des „Sozialistengesetzes“ und die im internationalen Vergleich fortschrittliche Sozialgesetzgebung Bismarcks aus, die im Übrigen bis heute gültig ist274.
Deutsch-französische politische Krisen wurden im Reichsland Elsass-Lothringen stets verstärkt wahrgenommen. Es war in dieser Hinsicht ein „Thermometer für die deutsch-französischen Beziehungen“275. Während die Bevölkerung befürchtete, ihre Heimat könnte erneut Schauplatz kriegerischer Auseinandersetzungen werden, reagierten Verwaltung und Militär mit Misstrauen und repressiven Maßnahmen. Verschärfung der Sprachenpolitik in den Schulen, Verbot französischer Zeitungen, die Ausweisung von missliebigen Personen, die Auflösung von Vereinen sowie die Einführung von Schutzzöllen und Passzwang waren Maßnahmen als Reaktion auf die Ereignisse im Jahr 1887: die Schnaebelé-Affäre, die darauf folgende Drohung der Generalmobilmachung durch Boulanger sowie die von der Regierung Bismarck in Elsass-Lothringen verlorenen Reichstagswahlen276. Aufgrund eines deshalb eingeführten vorübergehenden Passzwangs benötigten Franzosen für die Einreise nach Elsass-Lothringen ein Visum, ausgestellt durch den deutschen Botschafter in Paris. Junge Männer zwischen 18 und 20 Jahren erhielten dieses sehr selten, Militärs und Lehrer nur mit weiteren Anträgen277. Doch davon abgesehen, handelte es sich um eine „offene Grenze“278 zwischen Elsass-Lothringen und Frankreich, wie zahlreiche grenzüberschreitende Veranstaltungen und Kontakte belegen. Trotz der repressiven Maßnahmen war die Germanisierungspolitik in Elsass-Lothringen sehr viel vorsichtiger und flexibler als beispielsweise in den Gebieten mit polnischen Minderheiten. Einer der Gründe dafür liegt in der diffusen Höherwertung der französischen Kultur und der Überzeugung, dass der als deutsch angesehene Grundcharakter der Elsässer sich nach einer Übergangszeit wieder durchsetzen würde279. Trotz eines bisweilen kolonialen Auftretens280 lässt sich der in Ostpreußen konstatierte deutsche kontinentale Kolonialismus nicht in gleicher Weise in Elsass-Lothringen feststellen.
Die Bindungen an Frankreich
Die Bindungen an Frankreich waren in Elsass-Lothringen vor allem in den ersten Jahren nach der Annexion besonders stark. Eine erhebliche Anziehungskraft übten nationale französische Ereignisse aus. Zu nennen sind die Staatsbegräbnisse, in erster Linie die Beisetzung von Léon Gambetta 1883, die Weltausstellungen und ab 1880 die jährlichen Feiern zum 14. Juli281. Gerade die französische fête nationale erfreute sich großer Beliebtheit: Ganze Karawanen zogen aus dem Reichsland nach Nancy oder Belfort, um an den Feierlichkeiten teilzunehmen, was von den deutschen Behörden misstrauisch überwacht wurde282. Darüber hinaus gab es Kontakte zu Exilkreisen vor allem in Paris sowie zur ausgewanderten Verwandtschaft. Über ihre zeitweilige Arbeit als Dienstmädchen in Paris trugen junge Frauen aus Elsass-Lothringen dazu bei, die Bindung nach Frankreich aufrechtzuerhalten283. Freimaurer und Vereine wie die Association générale d’Alsace-Lorraine waren für Exilelsässer in Frankreich integrierende Kräfte284. Zahlreiche der einflussreichen, in Schule und Universität tätigen Germanisten und Sprachwissenschaftler kamen aus Elsass-Lothringen, so etwa Charles Andler, der 1904 den ersten Lehrstuhl für Germanistik an der Sorbonne erhielt285. Begegnungen zwischen Elsässern und Franzosen, aber auch von Elsässern und „Altdeutschen“, wurden darüber hinaus durch Sportvereine geschaffen, allen voran von Fußballvereinen. Regelmäßig wurden Spiele organisiert, wobei der sportliche Austausch über Grenzen deutsche und schweizerische Mannschaften einbezog286. Die Bindung an die französische Kultur aufrechterhalten zu können war zugleich eine Frage des Geldes: So bildeten überwiegend die vermögenden Schichten der elsass-lothringischen Gesellschaft, die regionalen Notabeln, Industriellen, Landbesitzer und Geistlichen den Kern des Widerstands gegen die Eingliederung in das Deutsche Kaiserreich. Allerdings büßte die Dritte Republik durch ihre Politik des Antiklerikalismus sowie durch Boulangismus, Panamaskandal und Dreyfusaffäre an Attraktivität ein. Der Antisemitismus und die Feindschaft gegenüber Elsass-Lothringen, die sich im Zuge der Dreyfusaffäre manifestierten, wirkten dabei vor allem auf die pro-französisch eingestellte jüdische Bevölkerung abschreckend. Sie traf der doppelte Vorwurf besonders hart, den man dem vermeintlichen Spion Alfred Dreyfus aufgrund seiner jüdischen und elsässischen Abstammung von beiden Seiten machte. Die Trias aus Spionage, Verrat und Illoyalität im Grenzland gehörte sowohl zur deutschen als auch zur französischen Vorstellungswelt über Elsass-Lothringen287.
Die oppositionelle Einstellung der Bevölkerung schwächte sich mit zunehmender Dauer und dem Heranwachsen der nächsten Generationen ab. Um die Jahrhundertwende hatte die Mehrheit der Elsässer und Lothringer die Zugehörigkeit zum Kaiserreich akzeptiert. In einer vielschichtigen Regionalismusbewegung, die sich auf Sprache und Kultur stützte, wurde der Wunsch deutlich, dem nationalen Antagonismus durch einen dritten, regionalen Weg zu entkommen. Einen Rückschlag für die Eingliederung des Reichslandes stellte 1913 die Zabern-Affäre dar288. In ihr zeigte sich nicht nur erneut der Konflikt zwischen ziviler und militärischer Vorherrschaft. Die Affäre machte ebenso die im Deutschen Reich verbreitete anti-elsässische Einstellung, die Grenzen der Germanisierungspolitik und die Ohnmacht der Elsässer und Lothringer selbst deutlich und trug zu einem Wiederaufflammen der Regionalismusbewegung bei289.
Frankreich: Denken an die „verlorenen Provinzen“
In Frankreich wurde das Denken an die provinces perdues in vielerlei Hinsicht stilisiert und ein regelrechter Mythos entstand um Elsass-Lothringen290. Am stärksten präsent war die Erinnerung in der Schule, hing doch in allen Klassenzimmern eine Landkarte, auf der die annektierten Gebiete farblich hervorgehoben waren, verewigt im Ölgemälde „Der schwarze Fleck“ (um 1887) von Albert Bettannier291. Überdies prägte die Erinnerung maßgeblich der 1877 veröffentlichte Schulroman „Le Tour de la France par deux enfants“, von dem über neun Millionen Exemplare verkauft wurden. Darin aufgezeichnet sind die Erlebnisse zweier verwaister Jungen aus dem Elsass, die nach der Annexion 1870 auf der Suche nach ihrem Onkel Frankreich durchqueren292. Im städtischen Raum waren die provinces perdues durch Straßennamen293 mit Bezug auf elsässische oder lothringische Städte sowie durch zahlreiche elsässische Brasserien präsent. Hinzu kamen Denkmäler wie beispielsweise Jeanne-d’Arc-Statuen, der Trauerflor um die Straßburg repräsentierende Statue auf der Place de la Concorde in Paris sowie das Denkmal „Le Souvenir“, das 1910 in Nancy eingeweiht wurde. Zahlreiche Zeitschriften, Journale und eine umfassende patriotische Literatur sowie Gedichte, Reiseberichte und Pamphlete über Elsass und Lothringen hielten die Erinnerung an die „schlecht verheilte Wunde“ aufrecht294. Der Lothringer Schriftsteller Maurice Barrès galt als einer der Hauptvertreter dieser Richtung. In ihrer Beschwörung der Revanche nahm diese Literatur genau wie die populären Lieder, Gemälde und Abbildungen teilweise den Charakter eines „religiösen Gelübdes“295 an. Visuell kulminierte die Erinnerung in der Darstellung der elsässischen Tracht und hier vor allem in der traditionellen Haube (coiffe) der Frauen, die nicht nur schnell zu erkennen war, sondern auch im Laufe der Zeit auf den Illustrationen immer größer wurde296.
Trotz der von Gambetta 1872 ausgegebenen Parole „Nie davon sprechen, immer daran denken“ („Pensez-y toujours, n’en parler jamais!“) nahm das Interesse der französischen Öffentlichkeit an Elsass-Lothringen spätestens seit den 1890er-Jahren ab. Die Anzahl der Publikationen ging stark zurück, obschon in nationalistischen Kreisen wie der Ligue des patriotes um Paul Déroulède die Erinnerung an die „verlorenen Provinzen“ weiterhin im Zentrum der politischen Agitation stand. Im Wahlkampf und in öffentlichen Debatten war Elsass-Lothringen jedoch kaum präsent. Unter den Intellektuellen hatte sich gegenüber dem Thema Indifferenz, ja eine „regelrechte Feindseligkeit“297 entwickelt. Gleichgültigkeit und emotionaler Aufruhr bildeten nach den Krisen der späten 1880er-Jahre die zwei Pole einer vielschichtigen öffentlichen Meinung, deren Einschätzung in der Historiografie sehr unterschiedlich ausfällt298. Einerseits hielt sich in Frankreich hartnäckig das Bild der tapferen und loyalen Elsässer und Lothringer, die unter der deutschen Herrschaft litten299. Andererseits schlug ihnen Misstrauen entgegen und die Angst vor Spionen war groß, wie sich vor allem im Umfeld der Dreyfusaffäre zeigte. Zentrales Organ für die desinteressierte Haltung war die Zeitschrift „Mercure de France“, in der zwischen 1895 und 1902 mehrere Umfragen zur Haltung gegenüber Deutschland durchgeführt wurden, die sehr unterschiedlich ausfielen300. Im Dezember 1897 zu Elsass-Lothringen befragt, zeigte sich die ältere Generation von der Unausweichlichkeit eines erneuten deutsch-französischen Krieges überzeugt, während die jüngere Generation Elsass-Lothringen „definitiv abgeschrieben“301 hatte. Nur als Reaktion auf bestimmte regionale Ereignisse und auf deutsch-französische Konflikte wie die beiden Marokkokrisen 1905/06 und 1911, die Einführung der Verfassung 1911 und die Zabern-Affäre 1913 flammte das Interesse punktuell auf302. Auf der Internationalen Ausstellung für Ost-Frankreich, Exposition internationale de l’Est de la France, 1909 in Nancy erfuhr der Nachbau eines elsässischen Dorfes ein immenses Interesse. Dass diese Nachbildung nicht nur den regionalen, sondern auch den kolonialen Ausstellungskonzepten der Zeit glich und direkt neben dem „senegalesischen Dorf“ lag, schien niemanden zu stören, nicht mal die Elsässer und Lothringer selbst, die in Sonderzügen aus Metz und Straßburg anreisten303.
1 Forschungsüberblick über die verschiedenen Aspekte der „inneren Reichseinigung“ bei FRIE 22013 [91], S. 31–43.
2 ALTHAMMER 22017 [83], S. 31–32; SIEMANN 2006 [256], S. 125; ULLMANN 22005 [258], S. 1–2.
3 BERGHAHN 102003 [85], S. 195.
4 Siehe dazu NONN 2015 [106], S. 208, 243–261; sowie zusammenfassend FRIE 22013 [91], S. 35–37. Einen Überblick zu den Forschungskontroversen um Bismarck und das Kaiserreich bei MÜLLER, TORP 2009 [302]; ULLMANN 22005 [258], S. 62–69.
5 WINKLER 2000 [111], S. 262; NIPPERDEY 1990 [Bd. 1], S. 414–427.
6 ULLMANN 22005 [258], S. 10.
7 Zur Integration durch Eisenbahn, Post, Migration und Verwaltung siehe WEICHLEIN 2004 [733].
8 OSTERHAMMEL 2009 [80], S. 119, 120.
9 CHICKERING 2011 [238], S. 68–69.
10 HAZAREESINGH 2013 [279], S. 246–248; HAZAREESINGH 1998 [278]; NORD 21998 [287].
11 Vgl. z.B. HOUTE 2014 [124]; FONTAINE, MONIER, PROCHASSON 2013 [130]; DUCLERT 2010 [118].
12 ROUSSELLIER 2003 [299], S. 340–345; CHARLE 1987 [116].
13 FONTAINE, MONIER, PROCHASSON 2013 [130], S. 8.
14 CHANET 2006 [1524]; ROYNETTE 22017 [1531]. Zum deutschen Einfluss siehe MITCHELL 1984 [525]. Zu Studienreisen französischer Militärs nach Deutschland siehe BARBEY-SAY 1994 [1138], S. 183–196.
15 COSSON 2013 [336], S. 114; CHANET 2006 [1524], S. 21, 27, 37, 102–103, 288–291.
16 HOUTE 2014 [124], S. 94–97; BERSTEIN 2003 [268], S. 278. Zur deutsch-französischen Rivalität im Eisenbahnbau siehe MITCHELL 2000 [384].
17 RIEDERER 2005 [471], S. 21. Siehe dazu das Kapitel II.1 „Elsass-Lothringen zwischen Deutschland und Frankreich“.
18 SIEHE z.B. THIESSE 1997 [1267]; CHANET 1996 [1251]. Ältere Sicht: WEBER 1977 [304]. Ein Forschungsüberblick auf Deutsch: HÜSER 2001 [284].
19 MERGEL 2009 [1244], S. 376.
20 BADE, OLTMER 22008 [1235], S. 150; WEHLER 1995 [110], S. 546.
21 PAGE MOCH 22008 [1265], S. 127; LEQUIN 2006 [1258], S. 301–302; WEIL 2002 [768], S. 356–357.
22 Zur deutschen Einwanderung nach Frankreich im 19. Jahrhundert siehe KÖNIG 2003 [1221].
23 BARBEY-SAY 1994 [1138].
24 DORNEL 2012 [1254]; NOIRIEL 2007 [357]; LEQUIN 2006 [1258], S. 338–334.
25 MERGEL 2009 [1244], S. 384. Vgl. PRAT-ERKERT 2012 [355], S. 232.
26 GOSEWINKEL 2009 [309], S. 400–401; GOSEWINKEL 2008 [307]; JANSEN, BORGGRÄFE 2007 [682], S. 121. Ältere Sicht: BRUBAKER 1994 [307].
27 KAELBLE 1991 [1219], S. 84.
28 HALDER 22006 [244], S. 13.
29 Zur Verfassung und zur Forschung darüber siehe ALTHAMMER 22017 [83], S. 39–44; BERGHAHN 102003 [85], S. 290–298; GUSY 2002 [243]; MOMMSEN 1993 [101], S. 333–353; NIPPERDEY 1992 [105], Bd. 2, S. 85–109. Zur Kontroverse um den Einfluss Bismarcks auf die Verfassung und deren Einordnung siehe ULLMANN 22005 [258], S. 65–68.
30 ALTHAMMER 22017 [83], S. 44.
31 Zur unterschiedlichen Gewichtung der Rolle des Reichstags in der Forschung siehe ULLMANN 22005 [258], S. 71–72.
32 NIPPERDEY 1992 [105], Bd. 2, S. 203.
33 Zusammenfassung der Forschungskontroverse über das „persönliche Regiment“ Wilhelms II. bei ULLMANN 22005 [258], S. 81–82; BERGHAHN 102003 [85], S. 296–298. Auf Französisch: BAECHLER 2003 [233].
34 Zur politischen Geschichte sowie zu Aufbau und Festigung der Republik siehe GROS 2014 [122]; RÉMOND 2002 [294]; ROSANVALLON 2000 [297]; CANDAR 1999 [115]; NORD 21998 [287]; MAYEUR 1984 [127]; RUDELLE 1982 [301]; RÉBERIOUX 1975 [131].
35 HOUTE 2014 [124], S. 23.
36 PASSMORE 2013 [333], S. 18–44.
37 ENGELS 2007 [121], S. 37; RÉMOND 2002 [294], S. 154.
38 ROUSSELLIER 2003 [298], S. 367. Zu den Anfangsjahren siehe HUDEMANN 1979 [283].
39 Eine vergleichende Studie zur sozialen Herkunft von Parlamentariern in Deutschland und Frankreich in der longue durée bei BEST 2007 [212].
40 RÉMOND 2002 [294], S. 86–93.
41 ENGELS 2007 [121], S. 35; RÉMOND 2002 [294], S. 90–91. Ein Vergleich der „crise du 16 mai“ mit dem preußischen Verfassungskonflikt 1862–1866 bei RAITHEL 2007 [228].
42 DUCLERT 2010 [118], S. 169; RÉMOND 2002 [294], S. 208–222, 224–228.
43 HOUTE 2014 [124], S. 10.
44 Zu den Gegnern der Republik siehe BERSTEIN 2003 [268], S. 291–302.
45 FONTAINE, MONIER, PROCHASSON 2013 [130], S. 5.
46 Zur kritischen Geschichtsschreibung über die Dritte Republik siehe FONTAINE, MONIER, PROCHASSON 2013 [130].
47 Zu Wahlen im Kaiserreich allgemein siehe ANDERSON 2009 [232]; SPERBER 1997 [257]. Auf Französisch: BIEFANG 2013 [235]. Auf Englisch: KÜHNE 2015 [248]; ANDERSON 2000 [232]. Forschungsüberblick zu Wahlen und Wahlkultur bei KÜHNE 2005 [247].
48 ANDERSON 2009 [232], S. 34.
49 HALDER 2006 [244], S. 9.
50 BIEFANG 2003 [234].
51 ALTHAMMER 22017 [83], S. 56.
52 Eine Zusammenfassung der Forschungskontroverse bei JEFFERIES 2008 [95], S. 90–125; KÜHNE 2005 [247]. Die Ergebnisse der Reichstagswahlen 1871–1912 im Überblick bei ALTHAMMER 22017 [83], S. 54; HALDER 2006 [244], S. 150; BERGHAHN 102003 [85], S. 312–313.
53 Zur Entwicklung des Wahlrechts in Frankreich allgemein siehe GARRIGOU 2002 [276]; ROSANVALLON 2000 [297]; GARRIGOU 1992 [275]; ROSANVALLON 1992 [296]; HUARD 1991 [280]. Forschungsüberblick auf Deutsch: HÜSER 2001 [284].
54 BERSTEIN 2003 [268], S. 280; GARRIGOU 2002 [276]; GARRIGOU 1992 [275].
55 HAUPT 2009 [589], S. 155.
56 WEIL 2002 [768], S. 61.
57 SCHASER 2006 [1249], S. 54. In Württemberg, Baden und Hessen etwa durften Frauen bereits vor 1908 an Versammlungen teilnehmen, siehe ANDERSON 2009 [232], S. 363.
58 ANDERSON 2009 [232], S. 364.
59 PLANERT 2009 [250], S. 167–172; SCHASER 2006 [1249], S. 88–91; KLEJMAN, ROCHEFORT 1989 [1256], S. 26. Zur internationalen Diskussion des Frauenwahlrechts siehe BOCK 1999 [237].
60 TAITHE 2001 [201], S. 110.
61 PLANERT 2009 [250], S. 171; ROSANVALLON 1992 [296], S. 410. Zum Frauenwahlrecht in Frankreich siehe BOUGLÉ-MOALIC 2012 [271]; ROSANVALLON 1992 [296], S. 393–412; HUARD 1991 [280], S. 188–210; KLEJMAN, ROCHEFORT 1989 [1256], S. 262–301.
62 PLANERT 2009 [250], S. 179.
63 BOUGLÉ-MOALIC 2012 [271], S. 170–173, 175–177; ANDERSON 2009 [232], S. 118; ROSANVALLON 1992 [296], S. 396; HUARD 1991 [280], S. 198–199.
64 PLANERT 2009 [250], S. 183. Siehe auch BOUGLÉ-MOALIC 2012 [271], S. 166–170; ROSANVALLON 1992 [296], S. 406–407.
65 Zur Kritik an der Festlegung des Zeitpunkts siehe RETALLACK 2009 [251], S. 133–134 sowie KÜHNE 2005 [247], S. 299. Aus der Fülle der Literatur über Parteien im Kaiserreich siehe neben den bereits zitierten Werken zu Wahlen DOWE, KOCKA, WINKLER 1999 [239]; RITTER 1985 [252]. Französisch: SAINT-GILLE 2006 [253]; WAHL 1999 [260].
66 OSTERHAMMEL 2009 [80], S. 827, 859.
67 KREUZER 2001 [223], S. 3, 24, 49–51.
68 HALDER 2006 [244], S. 21; RITTER 1985 [252], S. 6. Ullmann sieht dagegen ein „regionalisiertes Fünfparteien- und nationalisiertes Drei-Lager-System“, ULLMANN 22005 [258], S. 73.
69 ENGELS 2007 [121], S. 56–57.
70 Vgl. den Überblick bei OFFERLÉ 2006 [288] sowie HUDEMANN 1979 [283]. Zu Parteien allgemein siehe außer der bereits zu Wahlen zitierten Literatur BERSTEIN 2003 [269]; HUARD 2003 [282]; HUARD 1996 [281].
71 NORD 21998 [287], S. 15–30; HUARD 1996 [281], S. 183. Siehe auch ENGELS 2007 [121], S. 59.
72 BERSTEIN 2003 [269], S. 438. Zu den Radikalen in den Anfangsjahren der Republik siehe auf Deutsch: MOLLENHAUER 1997 [286].
73 TORP, MÜLLER 2009 [104], S. 21, 23.
74 ALTHAMMER 22017 [83], S. 61.
75 HEWITSON 2001 [245], S. 779.
76 KÜHNE 2005 [247], S. 314; LANGEWIESCHE 2003 [249], S. 16; HEWITSON 2003 [220], S. 218, 244; HEWITSON 2001 [245].
77 KRUMEICH 2007 [98], S. 458; HEWITSON 2003 [220], S. 190–202; KRUMEICH 1992 [319], S. 204–205.
78 HEWITSON 2003 [220], S. 223.
79 Ebd., S. 3, 4, 26, 27, 33, 50, 65.
80 Siehe dazu KRUMEICH 1996 [125], S. 305–306.
81 HOUTE 2014 [124], S. 11.
82 NOLAN 2005 [325], S. 35.
83 LEONHARD 2008 [701], S. 741–783; FRANÇOIS, SCHULZE 1998 [689]; VOGEL 1997 [331]; FRANÇOIS, SIEGRIST, VOGEL 1995 [687].
84 PUSCHNER 2016 [189], S. 23–26.
85 GÖDDE-BAUMANNS 1998 [1216]; KRUMEICH 1989 [1592]; DIGEON 1959 [1149].
86 KÖNIG 2014 [1257].
87 GÖDDE-BAUMANNS 2009 [1217], S. 292.
88 LINGELBACH 2003 [1224]; WERNER 1995 [1234]; CHARLE 1994 [1252], S. 21–131; CARBONELL 1991 [1207]; CHARLE 1988 [1208].
89 ESCUDIER 2004 [1212]; LINGELBACH 2003 [1224].
90 HÜBINGER, PICHT, DąBROWSKA 2010 [1215], S. 176, 190. Zu den internationalen Historikerkongressen siehe auch ERDMANN 2005 [1211]; ERDMANN 1987 [1210].
91 DUCLERT 2010 [118], S. 158–166; CABANEL 2007 [1250]; CHANET 1996 [1251]; DÉLOYE 1994 [1253]; OZOUF 1992 [1264]; OZOUF 1963 [1260].
92 SCHIVELBUSCH 2003 [1472], S. 417.
93 ALEXANDRE 2007 [1205], S. 92.
94 LÖHER, WULF 1998 [1243], S. 30.
95 SPIVAK 2007 [1233], S. 38.
96 ALEXANDRE 2007 [1205], S. 100.
97 MIDDELL 1993 [1225], S. 365.
98 RANDIG 2015 [1228], S. 162; ALEXANDRE 2007 [1205], S. 100.
99 Siehe dazu das Kapitel I.4 „Städtische und ländliche Lebensformen“.
100 ANDERSON 22005 [676]; HOBSBAWM 32005 [696]; THIESSE 1999 [707]; HOBSBAWM, RANGER 1987 [697].
101 SCHNEIDER 2008 [255], S. 174.
102 FEHRENBACH 1971 [216], S. 326.
103 Ebd., S. 319.
104 SCHNEIDER 2008 [255], S. 175; NIPPERDEY 1992, S. 261. Vergleichend über europäische Hymnen: LETERRIER 1998 [225].
105 PUSCHNER 2016 [189], S. 30–37; VOGEL 2010 [259], S. 212–213. Für SCHNEIDER 2008 [255], S. 165, verlor der Sedantag bereits in den 1880er-Jahren an Bedeutung. Vgl. SCHELLACK 1990 [254], S. 67–132.
106 VOGEL 1997 [331]; ROHKRÄMER 1990 [1500], S. 37–55, 266.
107 SCHNEIDER 2008 [255], S. 187. Zu den Feierlichkeiten von 1913 im Vergleich mit französischen Praktiken siehe MARIOT, ROWELL 2004 [226].
108 ALLGEMEIN: RICHARD 2015 [295]. Zur Marseillaise siehe VOVELLE 2005 [303]; FEHRENBACH 1971 [216], S. 303–309. Zur Trikolore siehe OZOUF 2005 [290]; GIRARDET 1984 [277]; FEHRENBACH 1971 [216], S. 303–309. Zum 14. Juli siehe IHL 1996 [285], S. 111–133; AMALVI 1984 [265].
109 MOLLENHAUER 2004 [563], S. 209–210; AMALVI 1984 [265], S. 424–425.
110 MARIOT, ROWELL 2004 [226], S. 182, 206–207.
111 STELLER 2011 [332], S. 130–131.
112 SANSON 1998 [302], S. 357, 377.
113 RICHARD 2015 [295], S. 115–120, 296–300; IHL 1996 [285], S. 134–179; AGULHON 2001 [263], S. 42–49, 247–253.
114 HOUTE 2014 [124], S. 75. Zur Triade allgemein siehe OZOUF 2005 [290].
115 MOLLENHAUER 2004 [563], S. 214. Zum centenaire von 1889 siehe ORY 1992 [289]; BARIÉTY 1992 [266].
116 IHL 1996 [285], S. 208–220; ORY 1992 [289], S. 130–131.
117 VON PLATO 2001 [1195], S. 210; BUELTZINGSLOEWEN 1992 [214], S. 40. Zu den weiteren internationalen Reaktionen siehe BARIÉTY 1992 [266]. Zu den Weltausstellungen siehe außerdem das Kapitel I.4 „Massen- und Vergnügungskulturen“.
118 STELLER 2011 [332], S. 202.
119 AGULHON 1995 [262]. Zur Ikonografie der Marianne siehe AGULHON 2001 [263]; AGULHON 1979 [261]. Vergleichend mit der Germania: GALL 1993 [240].
120 SIEMANN 2006 [256], S. 122. Vergleichend zu Denkmäler siehe RAUSCH 2006 [229]; TACKE 1996 [231]; TACKE 1995 [230].
121 FRANÇOIS 2016 [159], S. 331.
122 TACKE 1996 [231], S. 13.
123 RAUSCH 2006 [229], S. 673.
124 THIESSE 1999 [707]; TACKE 1996 [231], S. 131. Ein Überblick zur deutschen, französischen und englischen Denkmal- und Festforschung bei RAUSCH 2006 [229], S. 24–51.
125 Ereignisgeschichtlich nach wie vor am detailliertesten, wenn auch inhaltlich in Teilen überholt: POIDEVIN, BARIÉTY 1982 [79].
126 HEWITSON 2004 [315], S. 5, 8; HEWITSON 2000 [314], S. 578.
127 KRUMEICH, BECKER 2010 [1541], S. 13–15; BECKER 2001 [734], S. 22; JOLY 1999 [364], S. 326; BECKER 1977 [1571], S. 62. So auch bereits STEINBACH 1976 [331], S. 37.
128 Zum Europäischen Konzert der Mächte allgemein siehe GRUNER 2009 [340]; BAUMGART 22007 [309] [der nachfolgende Band des Handbuchs der Geschichte der Internationalen Beziehungen für den Zeitraum von 1878–1918 von G. Kronenbitter ist im Druck]; GIRAULT 22004 [1585].
129 HILDEBRAND 2008 [342], S. 31–32; GALL 21990 [92], S. 509–510; DEININGER 1983 [310], S. 35; STEINBACH 1976 [331], S. 52–109.
130 So sieht es STONE 2010 [333]. Anders dagegen JANORSCHKE 2010 [316]. In der Forschung ist ebenso umstritten, ob die Kriegsdrohung ernst gemeint war, siehe LAPPENKÜPER 2006 [320], S. 24.
131 Zitiert nach: HILDEBRAND 2008 [342], S. 32.
132 Zur Außenpolitik der Dritten Republik bis 1914 allgemein siehe KREIS 2007 [366]; GUILLEN 2005 [361]; ALLAIN 2005 [353]; HAYNE 1993 [362]; GUILLEN 1985 [359]. In Teilen kommentierte Bibliografie bei GUILLEN, ALLAIN 2005 [354], S. 739–742; Forschungsüberblick bei KREIS 2007 [366], S. 19–24; WILSBERG 1998 [334], S. 6.
133 KREIS 2007 [366], S. 1.
134 HEWITSON 2004 [315], S. 12, 14. Siehe auch das Kapitel I.3 „Friedensbewegung“.
135 JANORSCHKE 2010 [316], S. 132–139; STEINBACH 1976 [331], S. 32.
136 GUILLEN 2005 [361]; GUILLEN 1985 [359].
137 Siehe dazu das Kapitel II.3 „Die Kolonialimperien“.
138 Siehe dazu ROTH 1993 [474], S. 135–138; CARROLL 1965 [355], S. 129–132.
139 Zur französisch-russischen Annäherung siehe HOGENHUIS-SELIVERSTOFF 1997 [363]; GIRAULT 22004 [1585], S. 254–269; DEININGER 1983 [310]. Zur Entente cordiale siehe VAÏSSE 2004 [370]. Speziell zur Bedeutung der Entente und der Politik Delcassés für die deutsch-französischen Beziehungen BECKER, KRUMEICH 2010 [1541], S. 25–30, 46–47; KREIS 2004 [365]; GUILLEN 2001 [360].
140 Aus der Fülle der Literatur zur Außenpolitik des Kaiserreichs allgemein siehe HILDEBRAND 2008 [342]; HILDEBRAND 32008 [343]; MOMMSEN 1993 [347]. Ein Forschungsbericht zur Außenpolitik des Kaiserreichs bei: MICHEL, SCHOLTYSECK 2010 [99]; HILDEBRAND 32008 [343], S. 114–151; JEFFERIES 2008 [95], S. 164–192.
141 Zur Außenpolitik Bismarcks siehe ROSE 2013 [349], dort weitere Literaturhinweise, sowie CANIS 22008 [336]. Mit Blick besonders auf Frankreich: JANORSCHKE 2010 [316]; DEININGER 1983 [310]; PUNTILA 1971 [329].
142 MICHEL, SCHOLTYSECK 2010 [99], S. 137.
143 HEWITSON 2000 [314], S. 578.
144 HILDEBRAND 2008 [342], S. 26; KREIS 2007 [366], S. 537; PUNTILA 1971 [329], S. 229–231. Ausführlich: POHL 1984 [327].
145 STONE 2010 [333], S. 316–317, 320, 339, 342; HILDEBRAND 2008 [342], S. 31; POIDEVIN, BARIÉTY 1982 [79], S. 154–159.
146 LAPPENKÜPER 2006 [320], S. 32. Zu den Interviews Bismarcks nach seiner Entlassung siehe auch DANIEL 2005 [339], S. 293; GALL 21990 [92], S. 711–729.
147 DANIEL 2005 [339], S. 303.
148 HILDEBRAND 2008 [342], S. 149.
149 Zur wilhelminischen Außenpolitik allgemein siehe ROSE 2013 [350]; CANIS 2011 [338]; CANIS 22009 [337]. Mit Blick besonders auf Frankreich: WILSBERG 1998 [334]; RAULFF 1976 [330].
150 CZEMPIEL 1966 [954], S. 95. Vgl. CARROLL 1965 [355], S. 183–185.
151 GIRAULT 22004 [1585], S. 227. Zu Reaktionen in der Presse siehe auch CARROLL 1965 [355], S. 175–182.
152 MAYER 2002 [367], S. 107.
153 Siehe dazu die Kapitel II.3 „Die Kolonialimperien“ und II.4 „Auf dem Weg zum totalen Krieg?“.
154 FRANÇOIS 2016 [159], S. 333; CZEMPIEL 1966 [954], S. 98.
155 MAYER 2002 [367], S. 267, 326; MOMMSEN 1993 [347], S. 174–175.
156 DANIEL 2005 [339], S. 314–315. Siehe auch KRUMEICH, BECKER 2010 [1541], S. 31–35.
157 CLARK 2013 [1579]; JEFFERIES 2008 [95], S. 165–167; HEWITSON 2000 [314], S. 570.
158 ROSE 2013 [349], S. 132–133; HILDEBRAND 32008 [343], S. 128–132.
159 ABALLÉA 2015 [305], Absatz 3. Vgl. auch ABALLÉA 2017 [306].
160 ABALLÉA 2015 [305], Absatz 10.
161 CHARLE 2001 [376], S. 241.
162 Ebd., S. 235–236. Zur sozialen Herkunft der Botschafter ALLAIN 1994 [352]; CHARLE 1987 [116], S. 220–225.
163 STELLER 2011 [332], S. 62–63, 65, 80.
164 ABALLÉA 2015 [305], Absatz 9.
165 STELLER 2011 [332], S. 141–147; CARROLL 1965 [355], S. 148–153.
166 MOLL 2007 [323], S. 78.
167 BAUMGART 22007 [309], S. 409; MOLL 2007 [323], S. 79.
168 MOLL 2007 [323], S. 80.
169 Zitiert nach: STELLER 2011 [332], S. 155. Siehe auch KREIS 2007 [366], S. 545; VILATTE 2002 [371], S. 152; HOGENHUIS-SELIVERSTOFF 1997 [363], S. 125–127.
170 STELLER 2011 [332], S. 160.
171 DUCLERT 2010 [118], S. 265.
172 MOLL 2007 [323], S. 82.
173 Ebd., S. 82. Zum Zarenbesuch in Paris 1896 siehe auch PAULMANN 2000 [326], S. 363–385.
174 STELLER 2011 [332], S. 199–221; CARROLL 1965 [355], S. 162–163.
175 MOLL 2007 [323], S. 92.
176 KREIS 2007 [366], S. 568.
177 MOLL 2007 [323], S. 93, 100, 101.
178 HILDEBRAND 2008 [342], S. 149.
179 HOUTE 2014 [124], S. 364. Vergleichende Zahlen bei CHARLE 2001 [376]; KAELBLE 1991 [1219].
180 HEWITSON 2004 [315], S. 16–20, 22–24; HEWITSON 2000 [314], S. 574, 576, 577, 581, 582.
181 HEWITSON 2000 [314], S. 580; KRUMEICH 1992 [319], S. 203, 207; RAULFF 1976 [330], S. 31–32.
182 DANIEL 2005 [339], S. 285.
183 KRUMEICH, BECKER 2010 [1541], S. 47–52. Militärhaushalte von 1900–1913 im internationalen Vergleich bei LEONHARD 2014 [1557], S. 40. Siehe auch das Kapitel I.5 „Der Erste Weltkrieg 1914–1918“.
184 LEONHARD 2014 [1557], S. 73; ALLAIN 2005 [353], S. 727; MOMMSEN 1990 [346].
185 BERNHARDI 1912 [13], S. 11. Siehe dazu LEONHARD 2014 [1557], S. 73; DANN 31996 [719], S. 218.
186 BLOCH 1899 [14]. Siehe dazu das Kapitel I.3 „Friedensbewegung“.
187 KIESSLING 2002 [318]; DÜLFFER, KRÖGER, WIPPICH 1997 [312].
188 Zur ersten Marokkokrise siehe MAYER 2002 [367]; RAULFF 1976 [330].
189 LEONHARD 2014 [1557], S. 51–52.
190 KRUMEICH, BECKER 2008 [370], S. 39–43. Zur zweiten Marokkokrise siehe MEYER 1996 [345]; ONCKEN 1981 [348]; ALLAIN 1976 [307].
191 WALKENHORST 2007 [732], S. 201.
192 VILATTE 2002 [371], S. 298–299.
193 KRUMEICH, BECKER 2008 [370], S. 42, 52, 54–56; HEWITSON 2000 [314], S. 598.
194 LEONHARD 2014 [1557], S. 59. Siehe auch KIESSLING 2002 [318], bes. S. 136–145; WILSBERG 1998 [334], S. 98–103; KEIPER 1997 [317]; LÖHR 1996 [321].
195 Siehe dazu die detailreiche Studie von POIDEVIN 21998 [385]. Zur Globalisierung der Wirtschaft im 19. Jahrhundert siehe MARNOT 2012 [383]; DORMOIS 2008 [401]; OSTERHAMMEL 2009 [80], S. 1029–1055. Zum Währungssystem siehe THIEMEYER 2012 [387].
196 PETERSSON 2004 [390], S. 55, 66.
197 ALEXANDRE 2012 [374]; ALDENHOFF-HÜBINGER 2002 [373]. Zusammenfassung auf Französisch: ALDENHOFF-HÜBINGER 2005 [372].
198 DEDINGER 2012 [378], S.49; DORMOIS 2008 [401], S. 194–198.
199 POIDEVIN 21998 [385], S. 87–92.
200 Eine Gegenposition zu der positiven Sicht von POIDEVIN 21998 [385] und POIDEVIN, BARIÉTY 1982 [79] vertritt DEDINGER 2012 [378]; DEDINGER 2011 [377] mit dem Blick auf die lange Entwicklung bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Vergleiche der Volkswirtschaften und industriellen Produktion bei DORMOIS 2008 [401]; CHARLE 2001 [376] unter Einschluss Großbritanniens; KAELBLE 1991 [1219].
201 WILSBERG 1998 [334], S. 221.
202 Ebd., S. 229, 249–257.
203 TORP 2005 [394], S. 62, 81–84; WILSBERG 1998 [334], S. 180.
204 DEDINGER 2011 [377], S. 1032.
205 Zu den Transfers im Bereich der Elektrotechnik siehe KÜHL 2009 [315].
206 Ebd., S. 85.
207 LANGLINAY 2009 [382], S. 121; TORP 2005 [394], S. 105.
208 WILSBERG 1998 [334], S. 352; POIDEVIN 21998 [385], S. 727–760; POIDEVIN, BARIÉTY 1982 [79], S. 210.
209 KÖNIG 2003 [355].
210 BARBEY-SAY 1994 [1138], S. 164–171.
211 NOLAN 2005 [325], S. 49.
212 POIDEVIN, BARIÉTY 1982 [79], S. 241–242.
213 Zur Zollpolitik in Deutschland und Frankreich siehe ALEXANDRE 2012 [374]; ALDENHOFF-HÜBINGER 2002 [373]. Zu Europa siehe DORMOIS 2008 [401], S. 69–156. Zur deutschen Außenhandels- und Zollpolitik siehe BURHOP 2011 [389], S. 101–117. Eine Zusammenfassung der Forschungskontroversen um den Protektionismus des Kaiserreichs bei TORP 2009 [395], S. 424–427.
214 ALDENHOFF-HÜBINGER 2002 [373], S. 42–70, bes. S. 61.
215 POIDEVIN, BARIÉTY 1982 [79], S. 176–177.
216 POIDEVIN 21998 [385], S. 784–786; WILSBERG 1998 [334], S. 208–209.
217 POIDEVIN 21998 [385], S. 727–728, 767–769; POIDEVIN, BARIÉTY 1982 [79], S. 273.
218 POIDEVIN, BARIÉTY 1982 [79], S. 179.
219 WILSBERG 1998 [334], S. 184, 217.
220 Zum Kapitalexport im 19. Jahrhundert allgemein siehe OSTERHAMMEL 2009 [80], S. 1047–1055.
221 WILSBERG 1998 [334], S. 110.
222 BARTH 2009 [375], S. 18–19; WILSBERG 1998 [334], S. 105; POIDEVIN 21998 [385], S. 245–247.
223 GUILLEN 2005 [361], S. 658.
224 BARTH 2009 [375], S. 17.
225 MARNOT 2012 [383].
226 POIDEVIN 21998 [385], S. 44–82; POIDEVIN, BARIÉTY 1982 [79], S. 173–174.
227 BARTH 2009 [375], S. 35–36; WILSBERG 1998 [334], S. 125, 147; BARTH 1995 [388], S. 384.
228 WILSBERG 1998 [334], S. 165.
229 BARTH 2009 [375], S. 30.
230 POIDEVIN 21998 [385], S. 317–319.
231 ALLAIN 1976 [307], S. 279–284, 291–294.
232 PETERSSON 2004 [390], S. 59.
233 BARTH 2009 [375], S. 19. Ausführlich: POIDEVIN 21998 [385], S. 654–723.
234 POIDEVIN, BARIÉTY 1982 [79], S. 271.
235 WILSBERG 1998 [334], S. 173. Anders sehen es POIDEVIN 21998 [385], S. 809–810; POIDEVIN, BARIÉTY 1982 [79], S. 276.
236 PLUMPE 2011 [391], S. 53; BARTH 2009 [375], S. 36.
237 Zur Geschichte des Elsass und Lothringens im 19./20. Jahrhundert und zur Gesamtgeschichte siehe IGERSHEIM 2016 [454]; VOGLER 2012 [499]; ROTH 2010 [476]; NOWAK 2010 [468]; MEYER 2008 [464]; DINET, IGERSHEIM 2003 [427]; ERBE 2002 [431]; WAHL, RICHEZ 1994 [502]; DOLLINGER 1991 [428]. Vgl. auch die Doppelbiografie von Pascale Hugues über ihre beiden Großmütter Marthe und Mathilde, HUGUES 2008 [449].
238 VOGLER 2012 [499], S. 158.
239 Ebd., S. 156; VOGLER, KAMMERER 2003 [498], S. 188–191, 199–210.
240 Zur Protestbewegung siehe ROSSÉ 1936, [40], Bd. 1, S. 58–83; Stimmen zur Annexion bei BRONNER 1970 [416], S. 219–375.
241 WAHL 1974 [501], S. 78–81.
242 SILVERMAN 1972 [487], S. 28–29.
243 VOGLER 2012 [499], S. 161.
244 WAHL 1974 [501], S. 190, 214.
245 MARTIN 2009 [461].
246 VOGLER, HAU 1997 [497], S. 202.
247 FREY 2009 [436], S. 29–37; WAHL 1974 [501], S. 203–212.
248 VOGLER 2012 [499], S. 168; UBERFILL 2001 [495]; UBERFILL 1995 [494]; WAHL, RICHEZ 1994 [502].
249 VOGLER, HAU 1997 [497], S. 257.
250 WAHL, RICHEZ 1994 [502], S. 72.
251 Zur politischen Geschichte Elsass-Lothringens siehe IGERSHEIM 2016 [454].
252 WEHLER 21979 [109], S. 67.
253 HIERY 1986 [447], S. 74; SILVERMAN 1972 [487], S. 87.
254 BAECHLER 1988 [406], S. 52.
255 FISCHER 2010 [435], S. 81; BARIETY, POIDEVIN 1982 [79], S. 255.
256 Zu Autonomisten und Protestlern als Abgeordnete im Reichstag grundlegend HIERY 1986 [447].
257 Zur Kultur im Elsass siehe BRAEUNER 2013 [415]; BENAY, LEVERATTO 2005 [410]. Zum Regionalismus siehe das vertiefende Kapitel II. 1 „Elsass-Lothringen zwischen Deutschland und Frankreich“.
258 HARVEY 2001 [445], S. 92–129.
259 BAECHLER 1982 [405], S. 154.
260 KURLANDER 2006 [725], S. 137–184.
261 WAHL, RICHEZ 1994 [502], S. 230.
262 RIEDERER 2004 [470], S. 270–271.
263 SILVERMAN 1972 [487], S. 93.
264 MARTIN 2009 [461], S. 162–163.
265 LANGLOIS 2008 [559], S. 120.
266 VLOSSAK 2010 [496]; HARP 1998 [444]; ARETIN 1992 [404].
267 RIMMELE 1996 [472]; WAHL, RICHEZ 1994 [502], S. 302–303.
268 VLOSSAK 2010 [496], insbes. S. 66–67.
269 BISCHOFF, KLEINSCHMAGER 2010 [413]; ROSCHER 2006 [473]; CRAWFORD, OLFF-NATHAN 2005 [424]; JONAS 1995 [456].
270 MUSÉES de Strasbourg 2000 [467]; WILCKEN 2000 [504]; MAAS 1997 [459].
271 WILCKEN 2000 [504].
272 NOLAN 2005 [325], S. 77.
273 Zur Wirtschaft in Elsass–Lothringen siehe HARVEY 2001 [445]; VOGLER, HAU 1997 [497] sowie das Kapitel I.2 „Ökonomische Rivalität und Kooperation“.
274 VOGLER 2012 [499], S. 165; CARROL 2010 [420], S. 60, 62–63; HARVEY 2001 [445], S. 84.
275 WEHLER 21979 [109], S. 39.
276 HIERY 1986 [447], S. 219–240.
277 Vgl. zur Grenze und zu den Ausweisungen BARBEY-SAY 1994 [1138], S. 35–36, 39–41, 45.
278 ROTH 1993 [474], S. 135.
279 WINKLER 2000 [111], S. 253; ARETIN 1992 [404]; BAECHLER 1996 [407]; RIMMELE 1996 [472]; WEHLER 21979 [109], S. 57–58, 184–202.
280 Siehe dazu das vertiefende Kapitel II.1 „Elsass-Lothringen zwischen Deutschland und Frankreich“.
281 RIEDERER 2004 [470], S. 219, 229–240.
282 WAHL, RICHEZ 1994 [502], S. 220.
283 Ebd., S. 109.
284 ROTH 2010 [476], S. 59–62; SICARD–LENATTIER 2002 [484].
285 ESPAGNE 1999 [1154], S. 52–53, 59–61.
286 WAHL 2012 [503], S. 425–428; PIROT 2010 [469]; WAHL, RICHEZ 1994 [502], S. 169.
287 NOLAN 2005 [325], S. 73; CARON 1988 [419], S. 127–131; MAYEUR 1986 [462]; MAYEUR 1984 [127], S. 179–186. Siehe auch die Kapitel II. 1 „Elsass-Lothringen zwischen Deutschland und Frankreich“ und II.2 „Moderner Antisemitismus“.
288 Siehe dazu das Kapitel II.1 „Elsass-Lothringen zwischen Deutschland und Frankreich“.
289 VONAU 1993 [500]; MACKEY 1991 [460]; SCHOENBAUM 1982 [478]. Siehe dazu das Kapitel II. 1 „Elsass-Lothringen zwischen Deutschland und Frankreich“.
290 TURETTI 2008 [493]. Dem Elsass ist in den französischen „Lieux de mémoire“ ein eigener Aufsatz gewidmet, vgl. MEYEUR 1986 [462] genauso wie dem Buch „Le Tour de la France par deux enfants“, vgl. OZOUF 1984 [1262]. In den deutschen „Erinnerungsorten“ finden sich Artikel zur Hohkönigsburg und zum Straßburger Münster, nicht jedoch zum Elsass, vgl. FRANÇOIS, SCHULZE 2001 [89]. In den deutsch-französischen „Erinnerungsorten“ dagegen ist ein Beitrag über Straßburg und den Rhein abgedruckt, vgl. DREYFUS 1996 [430].
291 TURETTI 2008 [493], S. 163–171.
292 Ebd., S. 173–189; CABANEL 2007 [1250], S. 139–214; OZOUF 1984 [1262].
293 TURETTI 2008 [493], S. 131–146.
294 SCHRODA 2008 [480]; SCHRODA 2009 [481]; THIESSE 1991 [492].
295 POIDEVIN, BARIÉTY 1982 [79], S. 149.
296 BISCHOFF 1993 [412], S. 50–51.
297 POIDEVIN, BARIÉTY 1982 [79], S. 203.
298 SCHRODA 2002 [479]; JOLY 1999 [364]; CONTAMINE 1957 [357]; ZIEBURA 1955 [335].
299 TURETTI 2008 [493], S. 93–106.
300 Zu den Umfragen siehe SCHOCKENHOFF 1986 [1168]; POIDEVIN, BARIÉTY 1982 [79], S. 207–208; DIGEON 1959 [1149], S. 463–476.
301 SIEBURG 1969 [486], S. 28.
302 GRUNEWALD 1998 [443]; IGERSHEIM 1981 [452], S. 115–116.
303 ROTH 2010 [476], S. 63–64; SICARD-LENATTIER 2008 [485]; SICARD-LENATTIER 2002 [484], S. 431–438.