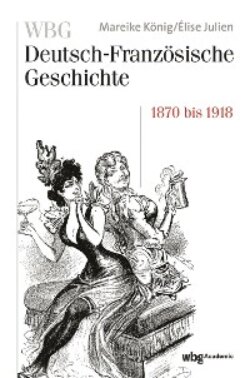Читать книгу WBG Deutsch-Französische Geschichte Bd. VII - Mareike König - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Deutsch-Französischer Krieg 1870/71
ОглавлениеDer Deutsch-Französische Krieg gilt heute als vergessener Krieg. Zu übermächtig ist die Flut der Publikationen über den Ersten und den Zweiten Weltkrieg. Dabei steht die enorme Bedeutung des Krieges 1870/71 für die damaligen Zeitgenossen außer Frage. Für das Verständnis der Epoche bis 1914 ist er grundlegend. Die aus dem Krieg resultierende dauerhafte Intensivierung des Nationalgefühls sowie die Verfeindlichung zwischen Deutschland und Frankreich waren dabei weniger ein Ergebnis der im Krieg gemachten Erfahrungen als das Resultat der zeitgenössischen medialen und der retrospektiven erinnerungspolitischen Interpretation des Krieges in beiden Ländern1. Die jüngste Forschung zeigt diese Differenz zwischen dem subjektiven Erleben des Einzelnen und dem, was die nationalistisch aufgeheizte Publizistik veröffentlichte, ganz deutlich.
Im Sommer 1870 sahen sich beide Länder als Angegriffene, die in einem Konflikt um die Vormachtstellung in Europa ihre nationale Ehre verteidigten2. Stein des Anstoßes war die von Bismarck forcierte Kandidatur des Hohenzollernprinzen Leopold auf den seit 1868 vakanten spanischen Thron. Aus französischer Sicht war es nicht hinnehmbar, dass ein, wenn auch entfernteres Mitglied des preußischen Herrscherhauses in Madrid regierte, beinhaltete diese Perspektive doch eine mögliche Einkreisung Frankreichs. Das Erstarken Preußens durch die militärischen Siege 1864 gegen Dänemark und 1866 gegen Österreich war in Frankreich mit äußerstem Missfallen registriert worden. Preußen hatte damit nicht nur die Vorherrschaft über den deutschsprachigen Raum erlangt, sondern auch die Machtverhältnisse auf dem Kontinent zu seinen Gunsten verändert. Hinzu kam, dass der Versuch einer diplomatischen Einmischung Frankreichs durch den preußischen Sieg 1866 bei Königgrätz (frz. Sadowa) gescheitert war, was dem Prestige Napoleons III. einen empfindlichen Dämpfer erteilt hatte. Bismarck, im Frühjahr 1870 innenpolitisch durch die bevorstehende Bewilligung des preußischen Militäretats unter Druck und dafür nach Entlastung suchend, handelte gemäß der Vorstellung, dass die angestrebte Einigung Deutschlands durch den Beitritt der süddeutschen Staaten zum Norddeutschen Bund nur durch einen Krieg mit Frankreich zu verwirklichen war. Bei der Inszenierung des Konflikts um die spanische Thronfolge konnte er mit dem Sadowa-Komplex3 Frankreichs rechnen und damit, dass Napoleon III. auf eine Provokation reagieren würde.
Obwohl Preußenkönig Wilhelm I. als Oberhaupt der Hohenzollern in Vertretung für den verreisten Prinzen auf französischen Druck hin auf die Kandidatur schließlich verzichtete, gab sich die französische Seite damit nicht zufrieden. Frankreich wollte einen deutlichen diplomatischen Sieg erlangen, von dem man sich innenpolitisch einen Prestigegewinn für das marode Regime versprach. Die französische Regierung verlangte daher trotz der erfolgten Absage der Thronkandidatur zusätzliche Garantien. Diese Nachricht überbrachte der französische Botschafter Benedetti dem preußischen König, der sich zur Kur in Bad Ems aufhielt, entgegen allen diplomatischen Gepflogenheiten auf der Emser Promenade. Wilhelm I. lehnte in diesem Gespräch weitere Garantien ab. Dies teilte Bismarck in der später berühmt gewordenen, von ihm bewusst auf einen beleidigenden Ton gekürzten und modifizierten „Emser Depesche“ der Presse mit. Deren Bedeutung wird in der Historiografie mittlerweile relativiert. Die Schwelle zum Krieg war bereits aufgrund der französischen Forderung nach Garantien und der Kriegsbefürwortung Bismarcks beim Abendessen mit Generalfeldmarschall Helmuth von Moltke und Kriegsminister Albrecht von Roon überschritten. Für die zeitgenössische Wahrnehmung des Konflikts spielten die Ereignisse auf der Emser Promenade jedoch eine große Rolle: Sie verflochten die Ehrbeleidigungen beider Länder und machten einen rationalen Ausgleich unmöglich4. Am 19. Juli 1870 erklärte Frankreich Preußen den Krieg. In beiden Ländern wurde die Auseinandersetzung zum gerechten Verteidigungskrieg stilisiert.
Für die europäischen Regierungen und die europäische Öffentlichkeit stand fest, dass die französische Regierung für die Eskalation des Konfliktes verantwortlich war und Napoleon III. als der Schuldige für den Kriegsausbruch zu gelten hatte5. Obwohl er selbst, physisch durch Krankheiten geschwächt, den Krieg vermeiden wollte, drängte ihn doch sein Umfeld dazu. Neben Ministerpräsident Émile Ollivier und Außenminister Herzog de Gramont spielte seine Gattin Kaiserin Eugénie eine wichtige Rolle, wenngleich der ihr zugeschriebene Satz: „Dieser Krieg ist mein Krieg“, in dieser Form wohl nie gefallen ist6. Die Diskussion um Kriegsausbruch und Kriegsschuld gehörte viele Jahre zu den Hauptkontroversen in der Erforschung des Deutsch-Französischen Krieges wie auch später des Ersten Weltkrieges. In den endlosen Diskussionen und Polemiken von Zeitgenossen, Politikern und Historikern ging es zumeist um Bismarcks Manöver und Provokationen sowie um die Motive und irrationalen Aspekte der französischen Kriegsentscheidung. Bismarck hat, wie wir heute wissen, die Affäre um die hohenzollernsche Thronkandidatur eigenhändig und geduldig inszeniert. Die Kriegsbereitschaft der führenden Militärs in beiden Ländern sowie die Risikopolitik der französischen Regierung taten ein Übriges, um es zum bewaffneten Konflikt kommen zu lassen7.
Öffentliche Meinung und Medien im Krieg
Lange Jahre hat sich sowohl in Deutschland als auch in Frankreich die Vorstellung gehalten, die eigene Nation sei jeweils geschlossen euphorisch und zuversichtlich in den als gerecht empfundenen Krieg gegen den Nachbarn gezogen. Dank regionaler Studien verfügen wir heute über ein differenzierteres Bild der öffentlichen Meinung8. In Frankreich wie in Deutschland war demnach die Einstellung von Öffentlichkeit und Presse bei Kriegsausbruch 1870 gleichermaßen komplex, ja diffus. Je nach regionaler Herkunft, politischer Meinung und persönlicher Situation unterschied sich die Einstellung zum Krieg deutlich. Für die Öffentlichkeit in beiden Ländern bedeutete der Kriegsausbruch zunächst vor allem Unsicherheit und materielle Verluste, Todes- oder Invaliditätsgefahr. Persönliche und wirtschaftliche Interessen, Sorgen um die Ernte oder den Arbeitsplatz standen dabei im Vordergrund. Die Vorstellung einer einhelligen nationalen Gemeinschaft ist in beiden Ländern ein Produkt der damaligen Presse sowie der Masse an Veröffentlichungen, die das Bild des Krieges während des Konflikts und vor allem im Nachhinein geprägt haben.
In Deutschland hing die Einstellung zum Krieg zugleich davon ab, ob man Befürworter oder Gegner einer kleindeutschen Lösung war. Die Träger des deutschen Nationalstaatsgedankens sahen im aufkommenden Krieg gegen einen äußeren Feind die lang ersehnte Chance auf eine Einigung Deutschlands9. Vor allem das liberale Bildungsbürgertum, Unternehmer, die sich materielle Gewinne versprachen, sowie Studenten feierten den Kriegsausbruch 1870. Teile der Demokraten, Sozialisten und Katholiken sprachen sich, sofern sie Gegner einer kleindeutschen Lösung waren, gegen den Krieg aus. Die deutschen Juden standen aufgrund ihres Wunsches nach Anerkennung und Integration unter Druck, sich deutlich zur Nation zu bekennen. Wie die französischen Juden betonten sie überwiegend ihren Patriotismus10. Die ungeklärte Bündnisfrage, die große Achtung vor der französischen Armee verbunden mit der Angst vor einer möglichen Invasion führten in den ersten Tagen des Krieges zu einer eher reservierten Stimmung vor allem in Süddeutschland, aber auch unter der städtischen Bevölkerung Norddeutschlands11.
Genauso wenig kann für Frankreich von einer einhelligen Euphorie über den Krieg die Rede sein und es gehört ins Reich der Legenden, dass die öffentliche Meinung Napoleon III. in den Krieg gedrängt habe12. In den Städten, vor allem in Paris, war die Begeisterung in der Regel größer als auf dem Land, teilweise war sie von Dorf zu Dorf verschieden. Frauen schienen generell zurückhaltender gewesen zu sein. Es war zunächst ein unerwarteter Krieg, den die französische Bevölkerung mit Emotion aufnahm und der anschließend als unvermeidlich, ja notwendig stilisiert wurde. Die Mehrheit der Bevölkerung in der französischen Provinz, vor allem im Osten an der Grenze zu Deutschland, war zu Beginn gegen den Krieg, akzeptierte ihn aber angesichts der als nationale Erniedrigung empfundenen Situation13. In diese Notwendigkeit fügte sich die Bevölkerung deshalb, weil man wie selbstverständlich davon ausging, dass der Krieg sich zu großen Teilen auf deutschem Territorium abspielen würde, galt doch die französische Armee als „beste Kampfmaschine der Welt“14. Presse und Publizistik in Frankreich spiegelten jedoch überwiegend die Vision einer Pariser Bevölkerung, die bei Kriegsausbruch zu großen Teilen gemeinsam mit den Militärs in euphorische Stimmung verfiel. In der französischen Hauptstadt gab es Jubel vor allem in den populären Milieus, die bis zu 20.000 Personen in großer Erregung auf die Straßen brachten. Es handelte sich dabei jedoch um eine deutliche – obgleich sehr sichtbare – Minderheit. Daneben gab es Demonstrationen gegen den Krieg, zumeist von radikalen Republikanern und Militanten der extremen Linken15. Ebenso zeigten sich Kaufleute und Monarchisten aus unterschiedlichen Gründen zurückhaltend. Die sehr viel niedrigere Anzahl an Freiwilligenmeldungen zur Armee in Frankreich ist nicht nur Ausdruck des unterschiedlichen Wehrsystems, sondern spricht auch dafür, dass die Zustimmung zum Krieg und zum Staat, in dessen Namen gekämpft werden sollte, geringer war als in Preußen16.
Für die Sinnstiftung des Krieges spielten die Medien entweder eigenständig oder durch die Regierungen manipuliert die entscheidende Rolle. Über Zeitungen, Nachrichten, Briefe, Grafiken und Bilder entstand eine medial vermittelte Kriegserfahrung aus zweiter Hand, die dafür sorgte, dass sich diejenigen, die den Krieg nicht selbst gesehen hatten, ein Bild davon machen und sich mit den Soldaten identifizieren konnten. In Deutschland schürte die nationalliberale, protestantische Presse bewusst die Begeisterung und legte damit schon zu Beginn der Auseinandersetzung den Grundstein für die überwiegend homogene Deutungskultur des Krieges17. In Frankreich fallen die zahlreichen Falschmeldungen und Gerüchte in der französischen Presse ins Auge, die vor allem im Sommer 1870 grandiose französische Siege vermerkte und für eine sichtbare Welle nationaler Erhebung sorgte. Doch auch hier gab es Ausnahmen und nicht alle Zeitschriften stimmten in das Kriegsgeschrei ein18.
Angestachelt durch die Berichterstattung kriegsbefürwortender Journalisten, durch Gerüchte und Spekulationen kam es in beiden Ländern zu einer regelrechten „Spionagephobie“, die in Frankreich parallel zu den ersten militärischen Niederlagen zunahm19. Überall im Land vermutete man preußische Spione, ein Wahn, der im Fall des Lynchmords eines jungen Adeligen in Haute-Faye, das als „Dorf der Kannibalen“20 bekannt wurde, weitaus dramatischere Ausmaße annahm als in Deutschland. Ebenso hatten die deutschen Einwanderer in Frankreich – allein in Paris waren es rund 60.000 – teilweise unter der einsetzenden Verfeindlichung zu leiden und wurden Opfer von verbalen und tätlichen Übergriffen. Dem Ausweisungsbefehl der französischen Regierung folgten dennoch nicht alle, verstanden sich doch viele der deutschen Einwanderer trotz fehlender Papiere eher als Franzosen21.
Im Verlauf des Krieges warfen die Publizisten beider Länder den Soldaten des jeweils anderen Landes ein wildes und unzivilisiertes Verhalten vor. Die deutschen Soldaten wurden als Barbaren hingestellt, das Bild des grausamen preußischen Eindringlings in vielen Abstufungen variiert22. Umgekehrt wurden die Freischärler (francs-tireurs) sowie die Turko- und Zuavensoldaten aus den französischen Kolonialarmeen als hemmungslose Wilde porträtiert. In der deutschen Presse und Öffentlichkeit wurde ihnen eine geradezu exzessive Aufmerksamkeit geschenkt. Entscheidend bei der Ausprägung der Bilder und Meinungen war die Deutungsmacht der Presse. Die Feldpostbriefe der deutschen Soldaten konnten sich als Korrektiv nicht durchsetzen. Umgekehrt wurden die Soldaten in ihrer Wahrnehmung der Ereignisse ebenso durch die Presse beeinflusst.
Die Bildberichterstattung spielte ebenfalls eine wichtige Rolle, denn Maler und Grafiker „berichteten“ ebenso zeitnah und flächendeckend von den Kriegsschauplätzen. Mit nur geringer zeitlicher Verzögerung gelangten diese Bilder als weitere Massenmedien an die Öffentlichkeit und visualisierten den Krieg für alle23. In Frankreich erlebte in der zweiten Kriegshälfte insbesondere die Karikatur eine neue Blüte. Ob schwarz-weiß oder koloriert: Tausende dieser Blätter von oftmals unbekannten Künstlern erreichten über ihre Symbolkraft selbst die analphabetische Bevölkerung24.
Analogien in der Einstellung der Bevölkerung sowie bei der veröffentlichten Meinung zwischen beiden Ländern ergeben sich ebenso im Hinblick darauf, wie der Krieg durch die bisherigen Erfahrungen mit dem Nachbarn historisch gerechtfertigt wurde. Bilder des aggressiven und raublustigen „Erbfeinds“ Frankreich aus der Zeit der antinapoleonischen Kriege erlebten eine neue Blüte und prägten die Wahrnehmung des Krieges25. Die antifranzösischen Vorstellungen aus der Zeit, die während der Rheinkrise 1840 aufgefrischt worden waren, saßen fest verankert im kulturellen Gedächtnis der Deutschen. Der Feldzug von 1870 wurde als Schluss der „unvollendeten Freiheitskriege“26 stilisiert. Im Kampf gegen den gleichen Feind wie damals sollte die deutsche Einheit endlich vollendet werden. In Frankreich wurden neben Rückgriffen auf die siegreiche Zeit der napoleonischen Grande Armée vor allem auf dem Lande Erinnerungen an die brutale preußische Besatzung der Jahre 1814 und 1815 wieder lebendig27. Es meldeten sich sogar Veteranen aus den napoleonischen Kriegen als Freiwillige, um erneut gegen die preußische Armee zu kämpfen.
In beiden Ländern gelang es nach Ausbruch des Krieges, Widerstände zu verwischen und Gegner verstummen zu lassen. Dabei kam den Regierungen der Umstand zu Hilfe, dass sie sich jeweils im Recht sahen und dies lautstark verkündeten. Auf diese Weise gelang es bereits 1870, eine union sacrée bzw. einen „Burgfrieden“ avant la lettre hervorzurufen, dank derer sich selbst Teile der linken Parteien hinter die Kriegspolitik der eigenen Führung stellten28. Obwohl August Bebel und Wilhelm Liebknecht nicht für die Kriegskredite stimmten, hielt die politische Zustimmung zum Krieg in der deutschen Sozialdemokratie bis zum Sturz des französischen Empire an. Anschließend sahen die Sozialisten einen Verteidigungskrieg als nicht mehr gegeben an und kritisierten Krieg und Annexionsforderungen. Unter den französischen Politikern warnte beispielsweise Adolphe Thiers vor einem Krieg. Es ist auffallend, wie stark sich die Kriegseintritte von Frankreich 1870 und gut 40 Jahre später 1914 gegen den gleichen Feind ähnelten29.
Kriegserfahrungen von Soldaten und Zivilisten
Seit einigen Jahren sind Kriegserfahrungen von Soldaten und Zivilisten, auch gegliedert nach Konfession, in den Mittelpunkt des Interesses einer neuen Militärgeschichte gerückt. In diesem Zusammenhang wird die Diskussion geführt, inwiefern schon der Deutsch-Französische Krieg ein „totaler Krieg“ war und darin als Vorläufer für die beiden Weltkriege gesehen werden kann30. Während der erste Teil des Krieges bis zur Niederlage des Empire und der Gefangennahme Napoleons III. bei Sedan als weitgehend klassischer Kabinettskrieg gelten kann, obschon er als nationaler Krieg deklariert wurde, zeigten sich im zweiten Teil nach Ausrufung der Republik am 4. September 1870 Züge eines nationalen Volkskriegs. Einer Kapitulation, die aufgrund der preußisch-deutschen Forderungen nur unter Abtretung französischer Gebiete zu haben war, wollte man in Frankreich nicht zustimmen. So hatte Napoleon III. auf den Schlachtfeldern von Sedan als symbolische Geste der Kapitulation nur sein eigenes, nicht aber das Schwert Frankreichs überreicht31. Die Fortsetzung des Krieges durch die Regierung der nationalen Verteidigung der Republik als Nationalkrieg war gleichzeitig ein ideologischer Krieg gegen die Monarchie und das Beharren darauf, dass die Niederlage von Sedan das Ende des Bonapartismus bedeutete. Die provisorische Regierung unter ihrem Innenminister Léon Gambetta ordnete die levée en masse an, die Massenmobilisierung zur nationalen Verteidigung. Die deutschen Soldaten sahen sich statt den kaiserlichen Truppen in der Folge bewaffneten Volksarmeen gegenüber. In beiden Ländern wurde intensiv über das bessere Wehrsystem diskutiert, eine Debatte, die nach dem Krieg anhielt32.
Die teilweise Entgrenzung des Krieges zur lutte à outrance, zum Kampf bis zum Äußersten, zeigte sich in den vereinzelten Überfällen durch französische Freischärler sowie in den Vergeltungsmaßnahmen und der härteren Behandlung der französischen Zivilbevölkerung durch die deutschen Truppen. In Deutschland machten Gerüchte von grausamen Attacken auf Angehörige der deutschen Armeen die Runde. Umgekehrt breiteten sich in Frankreich Gerüchte über das brutale Vorgehen der deutschen Soldaten gegen die französische Zivilbevölkerung aus. Während für die einen der französische Freischärler zum Sinnbild eines brutalen und verbrecherischen Vorgehens wurde, avancierte für die anderen der preußische Ulan zum Inbegriff des tierhaften und übelriechenden Barbaren. Zwischen den Soldaten selbst war die Kommunikation jedoch stärker von beruflichen Zuschreibungen geprägt als von nationalfeindlichem Vokabular. Eine Ausnahme stellten hier die farbigen Soldaten in der französischen Armee dar, die von deutscher Seite als Menschen zweiter Klasse angesehen wurden. Vielfach überliefert sind daneben freundschaftliche Interaktionen zwischen Deutschen und Franzosen während des Krieges. So führte man einen überwiegend gehegten Krieg, der medial jedoch zu einem entgrenzten Volkskrieg übersteigert wurde33.
Von den Zeitgenossen wurde der Deutsch-Französische Krieg aufgrund der Tausenden von Toten und Verletzten als beispiellos angesehen34. Besonders hoch waren auf beiden Seiten die Verluste bei den Offizieren. In der Schlacht bei Saint-Privat, der tödlichsten des Krieges, beliefen sich die Verluste auf über 20.000 deutsche und über 12.000 französische Soldaten. Das Gemetzel der Schlacht von Gravelotte blieb im französischen Gedächtnis in der sprichwörtlich gewordenen Aussage „fallen wie in Gravelotte“ (tomber comme à Gravelotte) haften, während Bismarck den Ort als „Grab der preußischen königlichen Garde“ bezeichnete. Die Belagerung der Festung Metz, die in einem Blutbad und mit der Kapitulation von General Bazaine und 150.000 französischen Kriegsgefangenen endete, ist über viele Jahre in der kollektiven Erinnerung der Deutschen und Franzosen geblieben35. Ebenso groß war der emotionale Aufruhr, als Straßburg zunächst beschossen und dann von den preußischen Truppen eingenommen wurde. Die Bombardierung der Stadt ließ nahezu jedes wichtige Gebäude in Flammen aufgehen36. Ab Mitte September 1870 begann die Belagerung von Paris, die bis zur Kapitulation am 28. Januar 1871 andauerte. Die Pariser Bevölkerung erlebte einen eiskalten Winter, der Hunger, Krankheiten und Tod zusätzlich förderte. Hinzu kam die Angst vor einer Beschießung der Hauptstadt, die Frankreichs größte Festung war, sowie Gerüchte über französische Niederlagen37.
Das Kriegsende: Sieg, Niederlage und Bürgerkrieg
Der Krieg 1870/71 blieb auf Deutschland und Frankreich lokalisiert und aus dem Krieg in der Mitte Europas wurde kein europäischer Krieg38. Trotz des französischen Werbens um Unterstützung verhielten sich die übrigen europäischen Länder neutral. Da der Krieg von beiden Seiten zur Verteidigung der nationalen Ehre geführt wurde, musste sein Ausgang zwangsläufig für die unterlegene Nation demütigend sein. Zu den harten Reparationsforderungen an das unterlegene Frankreich kamen symbolische Verletzungen, die weit über den Kriegsschluss hinauswirken sollten: die Proklamation des Kaiserreichs am 18. Januar 1871 in Versailles und der Einmarsch deutscher Truppen in Paris am 1. März 1871, die vielleicht „bitterste Pille“39 der deutschen Forderungen für den Waffenstillstand. Mit dem Spiegelsaal im Schloss von Versailles als Ort für die Gründung des Kaiserreichs fiel die Wahl auf einen zentralen Ort des französischen Geschichtsbewusstseins. In der deutschen Presse war die Genugtuung über diese Wahl nicht zu überhören. Die Reaktion der deutschen Bevölkerung war je nach politischer Einstellung unterschiedlich. Insgesamt war sie jedoch zurückhaltender als bei der Kapitulation von Paris wenige Tage später, die das lang ersehnte Ende des Krieges bedeutete40. Von französischer Seite wurde die Kaiserproklamation in Versailles als symbolische Aggression aufgefasst, als „eine Art politischer Vergewaltigung des nationalen Kulturguts“41. Doch als solche war sie, wie wir heute wissen, gar nicht geplant, da die Entscheidung vor allem logistischen Erwägungen geschuldet war: Der Spiegelsaal, der im Übrigen als Lazarett diente, war der größte verfügbare Saal in Versailles42. Symbolisch hatte diese Wahl und die damit verknüpfte Erniedrigungsempfindung dennoch weitreichende Folgen, denn am gleichen Ort sollte Deutschland nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg 1919 die harten Friedensbedingungen des Versailler Vertrages unterzeichnen43.
Die Friedensverhandlungen zwischen beiden Ländern wurden durch den Ausbruch der Revolution in Paris am 18. März 1871 erschwert44. Ausgelöst durch das Trauma der Kriegsniederlage, die sie nicht akzeptieren wollten, erhoben sich Tagelöhner, Arbeiter, Handwerker, Kaufleute und Selbstständige gegen die provisorische Regierung von Adolphe Thiers, in der sie Königstreue und Kriegsversager am Werk sahen45. Der revolutionäre Pariser Stadtrat wollte die eigene Stadt selbstständig verwalten und die monarchistische und klerikale Welt genauso hinter sich lassen wie Militarismus, Ausbeutung sowie bürgerliche und adelige Privilegien. Die Kommune erließ Mietschulden, stoppte Zwangsversteigerungen, übergab verlassene Fabriken und Betriebe zur kollektiven Verwaltung durch kooperative Assoziationen an die Arbeiter und setzte darüber ein sozialreformerisches Werk in Gang. Die deutschen Truppen sahen als Belagerer der 72 Tage dauernden Auseinandersetzung zwischen Kommunarden und Versailler Regierung zu. Der Aufstand in Paris schwächte die Position der französischen Regierung in Versailles bei den Friedensverhandlungen. Außenminister Jules Favre unterzeichnete in Frankfurt am 10. Mai 1871 ein Friedensabkommen, das durch ein Geheimabkommen ergänzt wurde. Darin war eine Blockade von Paris durch die preußische Armee vorgesehen, die nur die Versailler Regierungstruppen durch die eigenen Linien nach Paris hineinlassen sollten. Das Zusammengehen der beiden offiziell verfeindeten Staaten zur Niederschlagung der Kommune ist bemerkenswert. Die französische Regierung ließ sich vom Kriegsgegner innenpolitisch helfen, ein Umstand, zu dem sich Adolphe Thiers aus Furcht vor der öffentlichen Meinung nicht bekennen wollte. Die besondere Situation des eingekapselten Bürgerkriegs nach dem verlorenen staatlichen Krieg war einer der Gründe für die Gewaltexzesse, mit denen der Aufstand der Pariser Kommune in der „blutigen Woche“ (semaine sanglante) Ende Mai 1870 von den Versailler Regierungstruppen unterdrückt wurde46. Gemeinsam mit einem Teil der Pariser Bevölkerung standen deutsche Einwanderer auf den Barrikaden, um die Kommune gegen die Regierungstruppen zu verteidigen. Zumeist waren die deutschen Kommunarden sehr gut integriert und hatten zuvor in der Nationalgarde oder der Fremdenlegion gedient47. In mehreren deutschen Städten kam es zu solidarischen Demonstrationen mit der Pariser Kommune48.
Im Frankfurter Frieden forderte Deutschland von Frankreich mit der Zahlung von 5 Milliarden Francs eine damals exorbitant hohe Summe49. Doch waren die Besetzung eines Viertels seiner Departements durch deutsche Truppen und vor allem der Verlust von Territorium im Zeitalter der Nationalstaaten ungleich schwerer zu ertragen. Die Forderung nach Gebietsabtretung wurde von der französischen Öffentlichkeit als barbarisch wahrgenommen. Darüber geriet in Vergessenheit, dass es umgekehrt Pläne für die Annexion der linksrheinischen deutschen Gebiete im Falle eines französischen Sieges gegeben hatte: Der französische Innenminister hatte im Sommer 1870 in Erwartung des Sieges über Deutschland 150 Bewerbungen von Kandidaten für den zukünftigen Posten des Präfekten von Mainz erhalten50. Im Kaiserreich trat der überwiegende Teil der Bevölkerung und vor allem die Presse und ihre Kommentatoren – entweder kulturell oder geostrategisch argumentierend – für die Annexion Elsass und Lothringens ein. Doch es herrschte keineswegs bedingungslose Begeisterung51. Vor allem die sozialistische Presse kritisierte die harten Friedensbedingungen. Einige Unternehmer sprachen sich aus wirtschaftlichen Gründen gegen die Annexion aus, befürchteten sie doch die Konkurrenz der elsässischen und lothringischen Betriebe. Die Debatte wurde unter Intellektuellen ebenso emotional und mit großer Vehemenz geführt. Der öffentliche Briefwechsel zwischen Ernest Renan und David Friedrich Strauß während des Krieges ist dafür ein sprechendes Beispiel, führte die Meinungsverschiedenheit doch schließlich zum Bruch zwischen beiden52.
Für Frankreich kam die überraschende Niederlage, die das Selbstbewusstsein der bis dahin erfolgreichen französischen Armee stark ankratzte, einer nationalen Demütigung mit Langzeitwirkung gleich. Sie setzte sich als tiefes Trauma im nationalen Gedächtnis fest und löste eine Identitätskrise aus, die das französische Selbstbild sowie Platz und Zukunft der Nation in Europa und in der Welt betrafen. Ein komplexer Prozess der Sinngebung setzte ein, durch den zum einen das doppelte Trauma von Niederlage und Bürgerkrieg überwunden werden sollte, zum anderen die republikanische Idee fest in der französischen Gesellschaft zu verankern war. Die Schwierigkeit bestand darin, gleichzeitig am Gefühl der moralischen, kulturellen und zivilisatorischen Überlegenheit festzuhalten und dennoch am Beispiel des überlegenen Gegners aus den eigenen Fehlern zu lernen53.
In Deutschland wurde dem militärischen Sieg über Frankreich langfristig eine fast sakrale Bedeutung beigemessen. Kein Ereignis hat die öffentlichen Emotionen der Deutschen und zugleich das kollektive Gedächtnis im 19. Jahrhundert stärker bewegt als die Reichsgründung im siegreichen Krieg gegen Frankreich. Als dritter und letzter der im Nachhinein zu einer Einheit stilisierten „Einigungskriege“ diente der Krieg von 1870/71 über seine mediale Aufbereitung sowie seine Sieges- und Gedenkfeiern als ideologisches Bindemittel für die Einheit der jungen Nation. Der Krieg versinnbildlichte zugleich den Aufstieg Deutschlands zur europäischen Großmacht und die veränderten Mächteverhältnisse auf dem Kontinent. Die Konzepte von Nationalstaat und Krieg waren nach 1871 im Kaiserreich unauflöslich verbunden. Das hohe Ansehen der Militärs und alles Militärischen, das sich in den zahlreichen Schützen-, Turn- und Kriegervereinen sowie in der Verherrlichung Helmuth von Moltkes und im Nimbus des bürgerlichen Reserveoffiziers zeigte, hat hierin seinen Ursprung und sollte die politische Kultur des Kaiserreichs nachhaltig prägen54. Ganz ähnlich stand die Dritte Republik, die aus der militärischen Niederlage und dem Bürgerkrieg hervorging, unter einem militärischen und patriotischen Stern, der bis zum Ersten Weltkrieg ein Charakteristikum der Republik blieb55.
1 DANIEL, KRUMEICH 2005 [1448], S. 10.
2 Grundlegend zum Krieg 1870/71: BENOISTEL, LE RAY-BURIMI, POMMIER 2017 [141]; MILZA 2009 [184]; BECKER 2003–2007 [2]; HOWARD 22006 [162]; WETZEL 2005 [209]; WAWRO 2003 [207]; LEVILLAIN 1990 [178]; ROTH 1990 [191].
3 KOLB 1970 [167], S. 96.
4 ASCHMANN 2013 [132].
5 BECKER 2001 [134], S. 19.
6 MILZA 2009 [184], S. 54.
7 Hauptvertreter der These der alleinigen Schuld Bismarcks ist BECKER, 2003–2007 [2]. Widerspruch zu dieser Einschätzung bei FENSKE 2003 [156] sowie bei WETZEL 2008 [210] und erneut Antwort von BECKER 2008 [138] sowie BECKER 2011 [139]. Zur Entwicklung der Forschung siehe auch DOERING-MANTEUFFEL 2010 [311], S. 100–107. Eine aktuelle Zusammenfassung auf Französisch bei BURGAUD 2010 [146].
8 Für Deutschland siehe METELING 2010 [183]; MEHRKENS 2008 [182]; SEYFERTH 2007 [196]; BUSCHMANN 2003 [147]. Für Frankreich: PARISOT 2013 [186]; BERGER 2011 [142]; CALVIGNAC 2010 [148]; FELLRATH, FELLRATH-BACART 2011 [154]; AUDOIN-ROUZEAU 1997 [369]; AUDOIN-ROUZEAU 1992 [369]; AUDOIN-ROUZEAU 1989 [133].
9 LEONHARD 2008 [701], S. 625–626.
10 KRÜGER 2006 [170]. Vergleichend zu Frankreich und zu 1914: KRÜGER 2016 [172].
11 SEYFERTH 2007 [196], S. 28.
12 Zur öffentlichen Meinung siehe CARROLL 1965 [355], S. 25–35.
13 ROTH 1990 [191], S. 38–39; BECKER, AUDOIN-ROUZEAU 1995 [1522], S. 56.
14 WETZEL 2005 [209], S. 209.
15 LECAILLON 2012 [177], S. 15.
16 WAWRO 2003 [207], S. 75, 79.
17 BECKER 2001 [134], S. 499.
18 WETZEL 2005 [209], S. 120.
19 Zu Frankreich siehe MILZA 2009 [184], S. 147–149; MEHRKENS 2005 [181], S. 173; TAITHE 2001 [201], S. 104–107. Zu Deutschland siehe SEYFERTH 2007 [196], S. 39–40; MEHRKENS 2005 [181], S. 173, 177.
20 CORBIN 1992 [153].
21 KÖNIG 2010 [169].
22 JEISMANN 1992 [76], S. 212.
23 KOCH 2011 [166]; BECKER 2009 [136]; BECKER 2006 [135]. Zur internationalen illustrierten Presse siehe MARTIN 2006 [180].
24 MEHRKENS 2005 [181], S. 246.
25 LEONHARD 2008 [701], S. 623–626; JEISMANN 1992 [76], S. 249, 265; FENSKE 1990 [155], S. 167, 174, 186.
26 FENSKE 1990 [155], S. 174.
27 AUDOIN-ROUZEAU 1997 [1520], S. 399–403; AUDOIN-ROUZEAU 1989 [133], S. 25.
28 POIDEVIN, BARIETY 1982 [79], S. 167.
29 BECKER, AUDOIN-ROUZEAU 1995 [1522], S. 67; AUDOIN-Rouzeau 1997 [1520], S. 399–403. Beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs tauchten die Analogien und Verweise auf die Befreiungskriege erneut auf, und so war der August 1914 teilweise eine Neuinszenierung des Juli 1870, vgl. BECKER 2001 [134], S. 509.
30 Zur vertiefenden Diskussion siehe das Kapitel II.4 „Auf dem Weg zum totalen Krieg?“
31 STELLER 2011 [332], S. 33; FERMER 2008 [157], S. 178.
32 BECKER 2013 [137]; LEONHARD 2008 [701], S. 560–562; BECKER 2001 [134].
33 Siehe vertiefend dazu das Kapitel II.4 „Auf dem Weg zum totalen Krieg?“.
34 KRÜGER 2011 [171], S. 406.
35 TISON 2011 [202], S. 67; STEINBACH 2002 [198], S. 125. Zu den Kriegsgefangenen siehe MEHRKENS 2008 [182], S. 156–171; BENDICK 2003 [140]; BOTZENHART 1997 [144], 1994 [143]; ROTH 1990 [191], S. 418–433.
36 CHRASTIL 2014 [151]; PIJAUDIER-CABOT 2010 [187].
37 MILZA 2009 [306], S. 280. Zum besetzten Paris siehe FERMER 2011 [158]; CLAYSON 2002 [152]; LECAILLON 2005 [176]; TOMBS 1997 [203].
38 LANGEWIESCHE, BUSCHMANN 2007 [1469], S. 165.
39 SHOWALTER 2004 [197], S. 339. Siehe auch LECAILLON 2012 [177], S. 28; KOLB 1989 [168], S. 361.
40 FENSKE 1990 [155], S. 208–209; SEYFERTH 2007 [196], S. 66–67.
41 BARIETY 1995 [312], S. 204.
42 SCHULZE 2001 [195]. Vgl. den Artikel in den französischen „Lieux de mémoire“, der die „cérémonie profanatrice“ 1871 zwar nur streift, aber als absichtsvolle Rache für die im Spiegelsaal dargestellte Zerstörung der Pfalz interpretiert, HIMMELFARB 1986 [160], S. 278, 281.
43 BEAUPRÉ 2009 [70], S. 50–56.
44 Zur Kommune von Paris siehe MILZA 2009 [185]; LE QUILLEC 2006 [175]; ROUGERIE 22004 [194]; TOMBS 1999 [204].
45 LECAILLON 2012 [177], S. 43–44.
46 Ebd., S. 49, 55.
47 KÖNIG 2010 [169].
48 Siehe das Kapitel I.3 „Arbeiterbewegungen und Sozialpolitik“.
49 ROTH 1990 [191], S. 473.
50 GUIOMAR 2004 [1459], S. 256.
51 Vgl. SEYFERTH 2007 [196], S. 57–58, 69–70; BUSCHMANN 2003 [304], S. 329–335; FENSKE 1990 [155], S. 199, 201; POIDEVIN 1990 [188]; KOCH 1978 [164], S. 306–323; BRONNER 1970 [416].
52 STRAUSS 1915 [27]. Siehe dazu das Kapitel II.1 „Elsass-Lothringen zwischen Deutschland und Frankreich“.
53 TISON 2011 [202]; SCHIVELBUSCH 2003 [1472], S. 201; BECKER, AUDOIN-ROUZEAU 1995 [1522], S. 70.
54 PUSCHNER 2016 [189]; WETTE 2008 [1510], S. 45–47, 60–64; VOGEL 1997 [708]; JEISMANN 1992 [76].
55 HOUTE 2014 [124], S. 10; ROUSSELLIER 2013 [300], S. 16; CANDAR 2013 [272], S. 65.