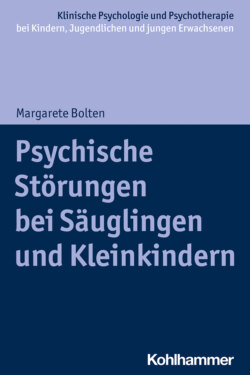Читать книгу Psychische Störungen bei Säuglingen und Kleinkindern - Margarete Bolten - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3.3 Frühkindliche Fütter- und Essstörungen
ОглавлениеDas Essverhalten eines Säuglings bzw. Kleinkindes entwickelt sich immer im Zusammenspiel komplexer Mechanismen, Erfahrungen und der Interaktionen mit seinen Bezugspersonen ( Abb. 1.1).
Abb. 1.1: Einflussfaktoren auf des Essverhalten im Säuglings- und Kleinkindalter
Neben reifungsassoziierten Faktoren wie beispielsweise die anatomische und kognitive Reife sowie oralmotorische Fähigkeiten, haben physiologische Regelmechanismen von Hunger und Sättigung eine zentrale Bedeutung bei der Entwicklung des Essverhaltens und der Esskompetenz von Säuglingen bzw. Kleinkindern. Zusätzlich spielen aber auch eine Vielzahl von Lerneinflüssen eine Rolle. Die Lernumwelt wird im Säuglings- und Kleinkindalter vor allem durch die Interaktionen mit Eltern bestimmt. Die Eltern oder Bezugspersonen machen Nahrungsangebote und strukturieren den Tag bzw. die Mahlzeiten, sie füttern aber auch das Kind und setzen Grenzen. Eltern geben im Zusammenhang mit der Essentwicklung die Entwicklungsreize in Form der Nahrungsangeboten. Werden einem Kind nur eingeschränkte Angebote an Nahrungsmitteln gemacht, können auch keine neuen Erfahrungen im Verarbeiten (Beißen, Kauen, Schlucken) gewonnen werden. Dadurch ist das Kind in seinen keine Entwicklungsschritten im Hinblick auf die Erweiterung des Nahrungsmittelspektrums eingeschränkt. Im Zusammenhang mit den Lernerfahrungen sind aber auch Traumatisierungen im Mund-Rachen-Bereich zu nennen. Diese können z. B. durch forciertes Füttern, unsachgemäße Zubereitung der Nahrung (hohe Temperaturen), Verschlucken und Erbrechen oder aber auch durch intensivmedizinische Maßnahmen entstehen. In diesem Gefüge können also auch Störungen der normativen Essentwicklung auftreten.
Generell erscheint es sinnvoll, Fütterstörungen und Essverhaltensstörungen zu unterscheiden. Bei Fütterstörungen erfolgt die Nahrungsaufnahme in dyadischen Beziehungen, da ein unabhängiges Essen des Kindes aufgrund seines Entwicklungsstandes noch nicht möglich ist. Bei den Essverhaltensstörungen können Kinder unabhängig von ihren Bezugspersonen selber essen. Streng genommen sollte deshalb der Begriff »Fütterstörungen« auf Säuglinge oder Kindern mit Entwicklungsstörungen beschränkt sein, welche nicht selbstständig essen können.
In den letzten Jahren gab es vielfältige Veränderungen und Anpassungen bei den verschiedenen Definitionen von Ess- und Fütterstörungen im frühen Kindesalter. Die Revisionen waren dringend notwendig, da die Definitionen der traditionellen Klassifikationssysteme der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10) und der 4., überarbeiteten Version des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR) teilweise im klinischen Alltag problematisch waren. So wird die »Fütterstörung im frühen Kindesalter« (F98.2) in der ICD-10 als »eine für das frühe Kindesalter spezifische Störung beim Gefüttert-werden« beschrieben (Remschmidt, Schmidt, & Poustka, 2006). Außerdem muss es definitorisch beim Kind zu einem Gewichtsverlust bzw. keiner Gewichtszunahme in Abwesenheit anderer psychischer oder organischer Krankheiten kommen. Diese Definition ist in vielerlei Hinsicht problematisch, da sie die anhaltende Unfähigkeit, adäquat zu essen, nur sehr allgemein formuliert. Zum anderen wird eine mangelnde Gewichtszunahme bzw. mangelndes Gedeihen vorausgesetzt. Gedeihstörungen sind jedoch nicht zwangsläufig mit Fütter- und Essstörungen assoziiert. Wie Chatoor (2016) ausführt, sind Gedeihstörungen (»Failure to thrive«) ein mögliches Symptom einer Fütter- und Essstörung, aber keine zwingende Voraussetzung für die Vergabe der Diagnose. Mit anderen Worten, manche Fütterstörungen gehen mit einer mangelnden Gewichtszunahme einher, während andere Kinder trotz massiver Essstörung sehr gut gedeihen. Auch der Ausschluss medizinischer Krankheitsfaktoren muss kritisch bewertet werden. Natürlich müssen alleinige organische Ursachen für eine Fütter- und Essstörung ausgeschlossen werden. Auf der anderen Seite gibt es Kinder mit organischen Grunderkrankungen, die komorbid eine Fütter- und Essstörung entwickelten, welche trotz erfolgreicher Behandlung der Grunderkrankung nicht verschwindet (Berlin, Lobato, Pinkos, Cerezo, & LeLeiko, 2011). Ferner haben neuere Studien (Krom et al., 2019; Norris, Spettigue, & Katzman, 2016) wiederholt zeigen können, dass komorbide psychische Störungen bei Fütter- und Essstörungen sehr häufig sind. Internalisierende (vor allem Angststörungen) und externalisierende Störungen (vor allem Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem Verhalten), aber auch Autismus-Spektrums-Störungen sind typische komorbide Störungen. Und abschließend muss bemängelt werden, dass der interaktionelle Aspekt einer Fütterstörung vollkommen ausgeblendet wird.
Eine Neuerung im DSM-5 ist, dass es keine Fütterstörung im Säuglings- oder Kleinkindalter mehr gibt, sondern dass Probleme mit der Nahrungsaufnahme sowohl bei Säuglingen und Kleinkindern als auch bei Erwachsenen im Rahmen einer Störung mit Vermeidung oder Einschränkung der Nahrungsaufnahme (Avoidant/restrictive food intake disorder; ARFID; Association, 2013) klassifiziert werden können. Dabei handelt es sich um eine Ernährungs- bzw. Fütterstörung ohne Gewichts- und Figursorgen. Die ARFID ist mit einem signifikanten Gewichtsverlust, signifikantem Nährstoffmangel, Abhängigkeit von Sondennahrung oder einer signifikanten Beeinträchtigung der psychosozialen Funktion verbunden. Nahrungsmittelknappheit, kulturelle Praktiken, Anorexia, Bulimia Nervosa oder körperliche Erkrankungen müssen als Alternativerklärungen für das gestörte Essverhalten ausgeschlossen werden.
Assoziierte Störungsbilder der ARFID können in drei Subkategorien eingeteilt werden: Ernährungsstörung aufgrund (a) einer allgemeinen unangemessenen Nahrungsaufnahme, (b) einer eingeschränkten Akzeptanz von Lebensmitteln oder (c) aufgrund einer spezifischen Angst, sind jeweils mit deutlichen Einschränkungen der akzeptierten Nahrungsmitteln und der aufgenommenen Nahrungsenergie verbunden (Bryant-Waugh, Markham, Kreipe, & Walsh, 2010).
a) Die Nahrungsvermeidung mit emotionaler Störung (Food avoidance emotional disturbance; FAED) wurde erstmals von Higgs, Goodyer und Birch (1989) für Kinder mit einer emotionalen Störung und einer damit einhergehenden Nahrungsvermeidung verwendet. Die Nahrungsvermeidung oder restriktive Nahrungsaufnahme muss mindestens einen Monat präsent sein ohne organische Hirnstörung, Psychose, Drogenmissbrauch oder Medikamenteneinwirkung. Kinder mit FAED erleben häufig emotionale Spannungen mit Sorgen oder Traurigkeit, die den Appetit und den Hunger beeinflussen, ohne das ein Gewichtsverlust angestrebt wird (Bryant-Waugh et al., 2010). FAED geht oft mit Untergewicht, Wachstumsstörungen und einem reduzierten Allgemeinzustand einher (Bryant-Waugh, 2013).
b) Die vermeidend/restriktive Ernährungsstörung aufgrund einer eingeschränkten Akzeptanz von Lebensmitteln, Picky Eating oder selektivem Essen ist durch ein extrem eingeschränktes Nahrungsspektrum und eine starke Vorliebe für ausgewählte Lebensmittel aufgrund von sensorischen oder anderen Merkmalen (Farbe, Geschmack, Konsistenz oder Marke) gekennzeichnet (Bryant-Waugh, 2019). In dieses Spektrum fällt auch die Food Neophobie, also die Ablehnung neuer, unbekannter Lebensmittel (Lobos & Januszewicz, 2019). Zwischen dem extrem selektiven Essverhalten und der Neophobie wurden bisher große Überschneidungen (Cole, An, Lee, & Donovan, 2017) beobachtet. Zudem gibt es eine Häufung bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) (Wallace, Llewellyn, Fildes, & Ronald, 2018). Weitere Ernährungsstörungen aufgrund einer eingeschränkten Akzeptanz von Lebensmitteln sind die von Chatoor (2016) beschriebene »Sensorische Nahrungsvermeidung« und das »Perseverant eating«, also das alleinige Akzeptieren von Babynahrung (Bryant-Waugh, 2019). Im Normalfall hat diese Form der vermeidend/restriktiven Ernährungsstörung keinen Einfluss auf das Gewicht und das Wachstum. Allerdings kann es, je nach Nährstoffzusammensetzung der akzeptierten Lebensmittel, zu Mangelerscheinungen und Wachstumsstörungen kommen (Cooney, Lieberman, Guimond, & Katzman, 2018).
c) Eine vermeidend/restriktive Ernährungsstörung aufgrund einer spezifischen Angst wird auch Nahrungsphobie (NP) genannt, kann als isoliertes Symptom mit akutem Beginn oder als Symptom anderer Störungen auftreten. Die Ernährungsphobie unterliegt häufig einem vorausgehenden traumatischen Erlebnis, wie zum Beispiel würgen (Kreipe & Palomaki, 2012). Die wohl bekannteste Ernährungsphobie ist die funktionelle Dysphagie, bei der die Kinder aufgrund einer Angst vor dem Erbrechen bzw. Würgen Nahrung verweigern. Diese Phobie steht im engen Zusammenhang mit der Emetophobie, einer spezifischen Phobie vor dem Erbrechen (Bryant-Waugh & Lask, 2007).
Im Rahmen der Revision des Klassifikationssytems ZERO TO THREE wurden in der DC: 0-5 (ZERO TO THREE: National Center for Infants, 2016, 2019) die Fütterstörungen in »Essstörungen im Säuglings- und Kleinkindalter« umbenannt und enthalten nun zwei Hauptklassen: Essstörung mit Überessen (Overeating Disorder) und Essstörung mit Nahrungsverweigerung (Undereating Disorder) sowie eine Restkategorie (Atypical Eating Disorder). Die Essstörung mit Nahrungsverweigerung entsprechen den Frühkindlichen Fütterstörungen der ICD-10, jedoch werden hier acht verschiedene Symptome unterschieden, durch welche sich die Essstörung manifestieren kann. Die DC: 0-5 stellt die durchgängige Weigerung altersadäquat zu Essen ins Zentrum seiner Definition einer Essstörung im frühen Kindesalter. Dabei kann altersadäquat vielerlei bedeuten und ist nicht zwangsläufig nur durch eine mangelnde Nahrungsaufnahme bzw. Gewichtszunahme definiert. Vielmehr spricht das DC: 0-5 auch von einer Essstörung, wenn das Kind bestimmte Verhaltensmuster, wie beispielsweise ein fehlendes Interesse am Essen, extrem selektives Essen oder sehr langes im-Mund-behalten zeigt oder Interaktionen beim Füttern/Essen dysfunktionale Auffälligkeiten aufweisen (z. B. nur im Schlaf, mit Zwang oder Ablenkung).
Sowohl aus der klinischen Praxis, als auch aus verschiedenen Studien ist bekannt, dass Kinder mit Fütter- und Essstörungen oftmals eine Vielzahl von weiteren Begleiterkrankungen (psychische und organische) und Einschränkungen haben (Berlin et al., 2011; Norris et al., 2016; Rommel, De Meyer, Feenstra, & Veereman-Wauters, 2003). Auch Goday et al. (2019) kritisieren in einem Konzeptpapier, dass Fütterstörungen bisher jeweils nur aus der Perspektive einer Disziplin (z. B. Psychiatrie) betrachtet wurden, was zu den bereits oben beschriebenen Problemen der Definition führte. Sie schlagen deshalb den Begriff der »Pädiatrischen Fütterstörungen« (Pediatric feeding disorders, PFDs) vor. Voraussetzung für die Vergabe dieser Diagnose ist eine über mind. 2 Wochen anhaltende Störung der Nahrungsaufnahme, die mit medizinischen Komplikationen (kardiorespiratorische Probleme, wiederkehrende Aspirationen), ernährungsbedingten Dysfunktionen (Mangelernährung, Nährstoffmangel, Notwendigkeit von Sondennahrung oder Nährungsergänzungsmitteln), Dysfunktion in den Essfertigkeiten (Pürieren/Andicken von Nahrungsmitteln, Anpassung von Positionierung/Hilfsmitteln oder Fütterstrategien erforderlich) oder psychosoziale Dysfunktionen (Vermeidungsverhalten, ungeeignete Fütterstrategien der Bezugspersonen, beeinträchtige soziale Funktionen, beeinträchtige Eltern-Kind-Beziehung) assoziiert ist und nicht auf kognitive Prozesse (wie z. B. bei Anorexie), einem Mangel an Nahrung bzw. kultureller Normen erklärbar sind (vgl. Goday et al., 2020).
Die vorgeschlagene Definition erleichtert die multidisziplinäre Arbeit auf den vier potenziell beeinträchtigen Ebenen: organische bzw. medizinische Komplikationen, beeinträchtigte Ess- und Schluckfertigkeiten, Nährstoffversorgung und psychische Beeinträchtigung.