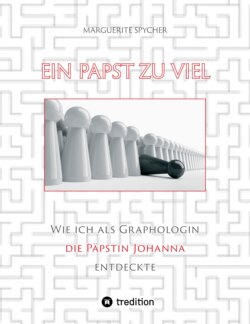Читать книгу Ein Papst zu viel - Marguerite Spycher - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKAPITEL 2
Die Sensationsstory
Die Anfrage ging noch weiter: »Daher möchte ich Sie anfragen, ob aus graphologischer Sicht mit solchen Monogrammen etwas ausgesagt werden kann«. Im Verlaufe des Gespräches mit Michael Habicht zeigte sich bald, dass aus seiner Sicht noch andere Aspekte von Interesse waren. Es ging darum, ob möglicherweise Einzelheiten zu den Persönlichkeiten der verschiedenen kirchlichen Würdenträger herausgefunden werden können. Beispielsweise dachte er an Herkunft, an den Bildungsstand oder auch an besondere Charakterzüge dieser Persönlichkeiten.
Bei zweien dieser Anliegen ist klar, dass graphologische Untersuchungen keinesfalls dazu geeignet sind, weitere Informationen zu liefern. Andere Anliegen hatten ein gewisses Potenzial, und ich sagte zu, einen Versuch zu unternehmen und herauszufinden, ob vielleicht etwas geklärt werden kann – allerdings mit klarem Vorbehalt und dem Hinweis, dass die Bedingungen doch reichlich einschränkend seien. Das war auch meinem Gesprächspartner klar und wir einigten uns dahingehend, dass es mir jederzeit offenstehe, die Arbeit zu beenden, auch wenn nur ein Teil der möglichen Antworten gegeben worden ist.
Ergänzende Anliegen und meine Antworten darauf
Aus graphologischer Sicht möglich sind Feststellungen allgemeiner Art, die für die meisten verständlich sind. Sicher können Sie nachvollziehen, dass wir bei den zu untersuchenden Monogrammen einige sehen, die sehr harmonisch wirken. Die Zeichen sind ausgewogen angeordnet, die Proportionen überlegt, die Elemente sorgfältig gestaltet, das Ganze gut durchdacht. Bei anderen bekommt man beim Betrachten den Eindruck, dass ein optisches Ungleichgewicht besteht. Das kann in der gesamten räumlichen Anordnung bestehen oder in der Gestaltung der einzelnen Elemente. Und noch andere Signaturen sind reichlich kompliziert gestaltet, was nicht immer zu einer geglückten Lösung führte.
Von Interesse war als Zweites, ob aus den Monogrammen gewisse Charaktereigenschaften abgeleitet werden könnten. Wünschbar wäre beispielsweise die Klärung, ob der Bischof von Rom – dies ist auch einer der Titel, die der Papst trägt – eher ein frommer Mystiker war oder eher ein rabiater Kirchenpolitiker.
Ganz so eindeutig wie auf die vorherige Frage fällt meine Antwort in diesem Falle nicht aus. Wenn bei der Gestaltung der Signatur aussagekräftige Symbole verwendet worden sind, vielleicht auch solche, die sich gegenseitig bestätigen und somit die Aussage verstärken, dann können sich gewisse Persönlichkeitszüge herauskristallisieren. Ein frommer Mystiker und ein Haudegen, die dürften sicher unterschiedliche Symbole verwendet haben, denn diese Zuschreibungen haben mit ihrem individuellen Charakter zu tun gehabt. Die Kirchenmänner hätten damit auch ausgedrückt, was ihnen wichtig war in ihrem Amt als Pontifex maximus: Geistliches, Spirituelles, allenfalls auch theologische Fragen etwa, oder das Durchsetzen von Vorschriften, die Verteidigung gegen innere und äußere Angriffe, die Sicherung von Macht und Einfluss oder im Extremfall auch Ausweitung des Herrschaftsgebietes.
Fraglos hat die jeweilige politische Situation immer auch Einfluss darauf gehabt, wer auf den Heiligen Stuhl gewählt wurde. Schwierige Phasen waren im Frühmittelalter nicht selten, drängten doch fremde Völker von Norden und auch von Süden nach Italien und wollten sich dort niederlassen. Die Papstwahl erfolgte damals nicht im Konklave, der Versammlung von Kardinälen, wie wir das heute kennen. Vielmehr wurde der neue Bischof von Rom in einer Volkswahl erkoren. Wahlberechtigt waren Bürger aus den alteingesessenen vornehmen Familien. Das hieß in jener Zeit selbstverständlich, dass nur männliche Personen ihre Stimme abgeben durften. Neben diesen hatten auch die Geistlichen jeglichen Ranges das Recht, über ihr neues Kirchenoberhaupt zu bestimmten. Unter dem Eindruck von äußerer Bedrohung wählte das Volk von Rom wohl jemanden, der politische Sicherheit gewährleisten konnte. In solchen Zeiten war entschlossenes Handeln eher angebracht als fromme Kontemplation. Es ist davon auszugehen, dass ein handlungsorientierter Papst seine Haltung auch durch die Auswahl entsprechender Symbole ausgedrückt hat. Und diese unterscheiden sich so gut wie sicher von solchen, die ein Kirchenführer wählte, dem in erster Linie Kontemplation und religiöse Angelegenheiten wichtig waren. Ein Stück weit würde ich daher versuchen, etwas herauszufinden.
Von anderer Dimension war die dritte Frage. »Ein Monogramm stammt eventuell von einer Frau aus dem kirchlichen Umfeld (Kloster). Können Sie dieses identifizieren?«. Nein, kann ich nicht! Aus graphologischer Sicht ist die Antwort hierauf ganz einfach: Es ist nicht möglich, aus einer Handschrift das Geschlecht der schreibenden Person zu bestimmen. Zwar gibt es statistisch nachgewiesene Besonderheiten, die bestimmte Tendenzen bei den Geschlechtern aufzeigen. In modernen Handschriften neigen Frauen eher zu größeren und eher gerundeten Schriftzügen, Männer eher zu kleineren, knapperen. Derartige Tendenzen können jedoch keinesfalls verallgemeinert werden. Zu zahlreich sind die Beispiele, welche aufgrund einer solchen simplen Vorstellung zu falschen Zuordnungen führen würden.
Was aufgrund von ausführlicheren Texten in modernen Handschriften nicht möglich ist, das ist erst recht unmöglich aufgrund eines Monogrammes. Nicht allein wegen des spärlicheren Umfanges des vorliegenden Materials, sondern vor allem, weil bei der Gestaltung einer Signatur für den Entwerfenden besondere Kriterien im Vordergrund stehen. Es geht um ein ganz persönliches, unverwechselbares Zeichen, und so werden Wertvorstellungen und die Einstellung zum verantwortungsvollen Amt in Gestalt von Symbolen mitgeteilt.
Eine völlig neue Frage liegt auf dem Tisch
Diese dritte Frage hatte es allerdings in sich. Jetzt musste ich mich sammeln: Ein Monogramm stamme eventuell von einer Frau aus dem kirchlichen Umfeld, beispielsweise aus einem Kloster, lautete sie. Wie bitte? Das würde ja heißen, dass die Dame sehr hohe kirchliche Positionen erlangt hätte, schließlich konnte sie Münzen prägen lassen, was ein besonderes Recht war! Diese Frage kam mir einfach exotisch vor. Sie machte mich stutzig. Aber ja, sie weckte zugleich auch mein Interesse. Weshalb wurde sie gestellt? Gab es irgendwelche Anhaltspunkte für entsprechende Vermutungen?
Hervorragende Frauen in Klöstern
Ja, freilich, es gab zahlreiche Frauenklöster, das wusste ich. Einige sind in früheren Zeiten ganz schön mächtig gewesen. Sie besaßen große Ländereien und verstanden es, diese geschickt zu verwalten, ihre Güter auch zu mehren. Manche von Nonnen geführte Schreibstuben waren weit herum bekannt, ihre Schriften sehr begehrt. In solchen Skriptorien wurden Texte sorgfältig abgeschrieben oder neu verfasst, genau wie in Männerklöstern. Bildung spielte in diesen klösterlichen Gemeinschaften eine wichtige Rolle. In ein Kloster einzutreten war für viele Frauen die einzige Möglichkeit, ihr Wissen zu mehren, sich mit bestimmten Fragen auseinanderzusetzen, an etwas zu forschen. Diese Perspektive war oft der Anlass, um Nonne zu werden.
Trotz ihrer bescheidenen und zurückhaltenden, eben klösterlichen Lebensweise sind uns die Namen von einer ganzen Reihe dieser Klosterfrauen heute noch bekannt. Stellvertretend seien einige davon genannt:
Vielen bekannt sein dürfte HILDEGARD VON BINGEN (1098-1179). Sie gründete eine Klostergemeinschaft auf dem Rupertsberg bei Bingen in der Nähe von Mainz. Die vielseitige Gelehrte beschäftigte sich mit Naturkunde und lernte die Kräfte von Heilpflanzen kennen. Ihr naturmedizinisches Wissen hat sie aufgezeichnet, diese Schriften werden auch heutzutage genutzt. Darüber hinaus war sie Mystikerin und Theologin. Ihr Rat war gefragt, sowohl in medizinischen und theologischen Fragen als auch bei politischen Problemen. Hohe Kirchenvertreter, Könige und sogar der Kaiser wandten sich an sie, wenn schwierige Entscheidungen zu treffen waren.
Etwas früher geboren wurde PÉTRONILLE DE CHEMILLÉ (1080/90-1140). Von ihr ausgestellte Dokumente beginnen jeweils mit: Petronilla prima abba[tissa] fontis ebraldi. Die Äbtissin des Doppelklosters Fontevrault bei Anjou, war eine äußerst geschickte Politikerin und Diplomatin. Sie verstand es, den Besitz ihres Ordens umsichtig zu mehren und damit sowohl an Land als auch an Einfluss zu gewinnen. Gehörte ein Stück Land, ein Wald, eine Siedlung oder auch eine größere Ortschaft zu einem Kloster, dann war die zugehörige Bevölkerung der Äbtissin zins- und steuerpflichtig. Im Gegenzug kümmerte sich die Klostervorsteherin um das Wohl ihrer Schutzbefohlenen. Dazu gehörten die gesundheitliche und die geistliche Versorgung. Häufig waren die abgeordneten Priester rein seelsorgerisch tätig. Beichte, Taufe, Sterbesakramente spendete die Äbtissin. Pétronille de Chemillé wirkte sehr umsichtig in ihrem Amt und scheute keine Konflikte mit einflussreichen Bischöfen und Adeligen, sofern dies nötig war. Das beeinträchtigte ihr Ansehen keineswegs, ganz im Gegenteil, sie verschaffte sich noch mehr Achtung dadurch.
Oder HERRAD VON LANDSBERG (1125/30-1195), ebenfalls eine Äbtissin. Sie lebte auf dem Odilienberg, am Ostrand der Vogesen im Elsass. Die hochgebildete Universalgelehrte verfasste den »Hortus Deliciarum«. In dieser von ihr als »Garten der Köstlichkeiten« benannten Lehrschrift hielt sie für ihre Nonnen das Wissen ihrer Zeit fest. Das Werk sollte Kenntnisse vermitteln und ebenso der Erbauung der Nonnen dienen. Bibeltexte, theologische Abhandlungen und Naturkundliches sind darin zu finden. Die Autorin hat auch zahlreiche Bilder beigefügt, wie die nebenstehende Darstellung. Im Zentrum thront die Philosophie, sie ist von den Sieben Freien Künsten umgeben. Diese Studienfächer standen den freien Männern der griechischen Antike zur Auswahl. Bemerkenswert, dass diese Fächer im Frühmittelalter auch in Frauenklöstern gelehrt wurden! Dieses Werk der Äbtissin Herrad von Landsberg wird zudem auch als Reformschrift angesehen, denn Herrad führt das unmoralische Verhalten von Mönchen und Priestern jener Zeit vor Augen und prangert es an.
Die Fraumünsterabtei in Zürich wurde 853 von Ludwig II., genannt der Deutsche, gegründet. Die Äbtissinnen hatten die Interessen der Karolingischen Könige und Kaiser zu vertreten. Sie verwalteten deren Güter, weshalb die Abtei immer von einer Dame aus der Königsfamilie geleitet wurde. Die Äbtissinnen des Fraumünsters waren Reichsfürstinnen und hatten in dieser Eigenschaft Sitz und Stimme im Reichstag. Herausragend als Persönlichkeit war unter anderem ELISABETH VON WETZIKON (1235-1298), die während 28 Jahren als Äbtissin amtete. Umfangreiche Güter und Ländereien der Zürcher Abtei hatte sie zu verwalten, Lehen auszugeben, Zehnten und Pachtzinsen einzuziehen. Seelsorge und Krankenpflege waren ebenfalls zu organisieren. Sie ernannte Pfarrer von mehr als zehn Kirchensprengeln, die vom Elsass bis in die Zentralschweiz verteilt waren. Elisabeth von Wetzikon war nicht nur Hausherrin über die Abtei, zugleich war sie Stadt- und Bauherrin, und hatte das Münz-, Markt- und Zollrecht. Sie bestimmte, welche Masse und Gewichte in Zürich gelten sollten. Erst im Zuge der Reformation übergab die letzte Äbtissin dieses altehrwürdigen Klosters dem Bürgermeister die Stadtschlüssel Zürichs.
In Italien verstand sich KLARA VON ASSISI (1193/94-1253) gut mit Franziskus aus der gleichen Stadt, und wie dieser hat sie einen Orden gegründet: die Klarissen. Der Orden stieg zum erfolgreichsten Frauenorden im Europa auf.
Eine andere Italienerin, KATHARINA VON SIENA (1347-1380), war Mystikerin, aber nicht nur. Auch sie beteiligte sich aktiv am Zeitgeschehen. Mit Päpsten und weltlichen Mächtigen führte sie ausgiebig Korrespondenz und versuchte auf diese Weise, das politische Geschehen zu beeinflussen. Durchaus mit Erfolg, denn es gelang ihr, Papst Gregor XI. zu bewegen, Avignon zu verlassen und nach Rom zurückzukehren.
Diese Frauen haben als Nonnen Bedeutendes für Kirche, Kultur, Medizin und Politik geleistet. Unzählige weitere Klosterfrauen führten ein frommes Leben und strebten nach persönlicher Vollkommenheit. Auch sie bewirkten durch ihre Arbeit und ihr Engagement so manches in ihrem Umfeld.
Aber sonst? Als Nonnen, Priorinnen oder Äbtissinnen konnten sie keine kirchlichen Weihen empfangen und somit auch keine sakralen Handlungen vornehmen, so viel meinte ich zu wissen. Demnach durften sie nicht predigen, keine Beichte abnehmen, weder Taufen noch Ehen schließen, denn diese Riten gehören zu den Sakramenten, die nur Geweihte spenden dürfen. Die katholische Kirche ist eine Art geschlossener Organismus für geweihte Geistliche. Das Sakrament der Weihe ist ausschließlich Männern vorbehalten. Hohe moralische und ethische Leitplanken gelten für die Geweihten jeglichen Grades. Ihre Ausbildung ist anspruchsvoll, sie sollen weitgehend auf Besitz verzichten und vor allem sind sie verpflichtet, zölibatär zu leben. Zuständigkeiten innerhalb der verschiedenen hierarchischen Positionen sind klar geregelt. Kirchenvertreter haben generell Vorbildfunktion, sie haben eine herausragende Vertrauensstellung als Seelsorger, und ganz besonders in ihrer Funktion als Beichtvater. Vorschriften bestehen nicht nur für Geistliche jeglichen Standes. Ebenso macht die Kirche klare Vorgaben für das Leben der Gläubigen in Bezug auf ihr religiöses und auch ihr weltliches und privates Verhalten. Das war früher so und gilt heute noch, denken wir nur an die Verhaltensregeln für Familie, Ehe, Partnerschaft und Sexualität, die im Alltag von Angehörigen des katholischen Bekenntnisses beachtet werden sollten.
Um auf Nonnenklöster zurückzukommen: Die spirituellen Kompetenzen für eine Äbtissin unterscheiden sich von jenen eines Abtes. Sie können nicht die Messe lesen, sie können auch nicht die Beichte abnehmen. Dazu muss ein männlicher Geistlicher ins Kloster kommen, der in der Regel dem gleichen Orden angehört. Wie sollte es in einer solchen Struktur Platz haben für eine Art geistliche Karrierefrau?! Allerdings sei hier angemerkt, dass ich im Verlaufe meiner Recherchen erfuhr, dass diese Rollenzuschreibungen von Frauen in der Kirche unvollständig waren. Zu gewissen Zeiten und in bestimmten Regionen gab es ganz andere Modelle, und zahlreiche Frauen waren in Stellung und Kompetenzen den Männern gleichgestellt. Vor allem im Europa nördlich der Alpen gab es ganz selbstverständlich Bischöfinnen. Darüber ist in den Kapiteln »Das Christentum, eine neue Religion« sowie »Persona non grata« mehr zu lesen.
Spekulative Spielkarte
Abbildungen von alten Tarotkarten zeigen unter anderem eine »Päpstin«. Tarot ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln, aber ich erinnere mich an den Besuch im Tarotgarten von Niki de Saint Phalle in der Südtoskana. In einem lockeren Wald auf einem Hügel stehen überdimensionierte bunte Gestalten. Sie sind schon von weitem sichtbar. Die Künstlerin hat in mehr als zehnjähriger Arbeit riesige Figuren aus dem Kartenset kreiert. Einige dieser Skulpturen sind begehbar, und in einer hat sie sogar zehn Jahre lang gewohnt.
Empfangen wird man beim Besuch im Garten gleich von einer monumentalen Skulptur, welche die »Hohepriesterin« darstellt. »Die Hohepriesterin« – das könnte vielleicht eine heidnische Figur sein. Im Christentum ist die Bezeichnung »Hohepriester« nicht geläufig, noch weniger die »Hohepriesterin«. Diese Tarotkarte wurde früher »Die Päpstin« genannt. Wenig erstaunlich, dass kirchliche Kreise daran Anstoß nahmen. Kartenspiel und Kartenlegen wurden grundsätzlich missbilligt. Und ein Spiel mit einer Karte, die eine Päpstin darstellt, das war erst recht unmoralisch. Eine Päpstin kann es ja nie geben, eben weil ausschließlich Männer kirchliche Aufgaben übernehmen können. Unter dem Druck der Kirche erhielt die Figur die Bezeichnung »Hohepriesterin«, was aber letztlich an der Verwerflichkeit des Kartenlegens wenig änderte. Klar ist: Ob Hohepriesterin oder ob Päpstin, in jedem Fall repräsentiert diese Gestalt eine Frau in sehr hoher Position in einem wie auch immer geprägten religiösen Umfeld. Doch für eine Päpstin in der realen Kirche scheint mir das eindeutig kein ernstzunehmender Hinweis zu sein. Und sonst?
Natürlich war mir bekannt, dass es Leute gibt, die behaupten, es habe einmal eine Päpstin gegeben. Für mich waren das wohlfeile Gerüchte, welche die Sensationslust eines breiten Publikums bedienten. Ich verstand dies als üble Nachrede, mit der die katholische Kirche als eine etablierte Institution lächerlich gemacht werden sollte. Der psychologische Hintergrund: Was »unangreifbar hochstehend« und als moralische Instanz über allem anderen stehend gelten will, kann auf diese Weise durch den Schmutz gezogen werden. Jeder, der will und das lustig findet, kann sich über diese Vorstellung ergötzen, auch wenn die grundsätzliche Einstellung zur Religion positiv bleibt.
Die Geschichte von der Päpstin
Im Laufe der Arbeiten an diesem Buch habe ich mich auch umgesehen, wo denn die Geschichte von einer Päpstin zu finden sei. Ich staunte nicht schlecht, denn seit vielen hundert Jahren wurde dieser Stoff immer wieder aufgenommen und bearbeitet. Selbstredend spielen jeweils auch Zeitgeschichte und Geschmack des anvisierten Publikums eine Rolle. Die Geschichten wurden ausgemalt und reichlich mit anzüglichen Details versehen. Nicht wenige erheben den Anspruch, historisch fundiert zu sein, eine Behauptung, die wohl das Interesse steigern sollte. Im Kern kann die Geschichte wie folgt zusammengefasst werden:
Eine Frau – sie kommt aus einer Region nördlich der Alpen – maßt sich Unerhörtes an: Sie verkleidet sich als Mann. Als Mönch tritt sie in ein Kloster ein, niemand bemerkt die Täuschung. Anscheinend ist sie sehr gelehrig, denn sie eignet sich umfassendes Wissen an. Später reist sie durch Europa, stets sich als Mann ausgebend. Erfolgreich verbirgt sie ihr wahres Geschlecht, wo immer sie sich aufhält. So gelangt sie auch nach Rom, wo sie klassische Fächer aus den Sieben Freien Künsten lehrt. Ihre Haltung, ihre Taten, ihr Engagement entsprechen gänzlich christlichen Werten, sie schafft sich dadurch einen hervorragenden Ruf. Schließlich gelangt sie auf die allerhöchste Stufe in der kirchlichen Hierarchie: Das Volk von Rom wählt sie zum Papst. Doch sie stolpert über ihre »typisch weibliche Natur«. Sie kann auch in dieser Position nicht auf Sex verzichten, was selbstredend im Laufe der Erzählungen schon bei früheren Gelegenheiten erwähnt und weidlich ausgekostet wird. Als Päpstin wird sie schwanger und bringt auf offener Straße ein Kind zur Welt. Eine riesige Blamage! Grausame Strafen muss sie erleiden, was den verschiedenen Autoren wiederum Gelegenheit für detailreiche Schilderungen bietet. In den meisten Varianten erleidet sie einen schmachvollen Tod. Ende gut, alles gut für diejenigen, welche der Vorstellung nachhängen, dass Männer eben die besseren Menschen seien – mit einer zusätzlichen Botschaft: Wehe denen, welche diese gottgewollte Ordnung nicht respektieren!
Unglaubwürdige Sensationsmache
Kein Zweifel: die Geschichte von einer Päpstin ist eine perfekte Sensationsstory. Ihre Elemente: Kirche, Moral, Hierarchie, Geschlechterstereotypen, alles fein säuberlich aufgebaut und in der Kombination »Papst hat Sex« kulminierend. Kaum zu übertreffen!
Dieses riesige Sensationspotential machte die Story für mich unglaubwürdig. Sie deckt oberflächliche Bedürfnisse ab und bietet die Möglichkeit, eine mächtige, von einigen wohl als übermächtig und bevormundend angesehene Institution in Frage zu stellen. Hohn und Spott anstelle von Ehrfurcht und Demut, das ist für manche Menschen – zumindest vorübergehend – wohltuend. Nicht ausgeschlossen, dass man sich an einer solchen Erzählung erheitert, im Grunde aber durchaus gläubig bleibt und das Ganze eher als harmlose Unterhaltung konsumiert. Dies jedenfalls lassen entsprechende Bearbeitungen des Stoffes aus früheren Jahrhunderten vermuten. Allerdings gilt zu bedenken: Wenn die Sache professionell durchdacht ist, genügend Mittel zur Verfügung stehen und alles entsprechend propagiert wird, dann kann diese Geschichte auch in moderner Zeit sehr lukrativ vermarktet werden.
Alles in allem waren diese meine Überlegungen bisher kein Anlass, mich mit der Sache zu beschäftigen. Und jetzt bin ich mit der Frage konfrontiert, ob eines der mir unterbreiteten Monogramme von einer Frau stammen könnte. »Zum Glück kann ich über das Geschlecht nichts sagen«, dachte ich mir. Aber das Experiment mit den Papstmonogrammen, das wollte ich versuchen.