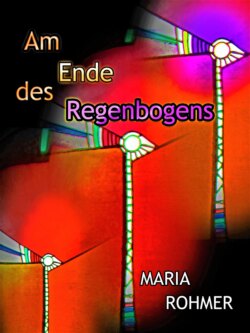Читать книгу Am Ende des Regenbogens - Maria Rohmer - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6. Kapitel
ОглавлениеWie vielen Patienten ist von ihrem Arzt schon - mal mehr, mal weniger einfühlsam - gesagt worden:
„Sie haben da einen bösartigen Tumor. Sie haben Krebs.“
Bis heute waren diese Patienten stets `die anderen`. Bis heute waren wir davon nicht betroffen. Bis heute, da wurde wieder ein Patient mit der Tatsache konfrontiert, die sein und das Leben seiner Familie von Stund an verändern wird. Der Patient ist mein Vater. Der Tumor sitzt in der Lunge. Es ist der 22.03.1993.
Jetzt - im nachhinein - bin ich mir sicher, dass alles schon viel früher begonnen hat. Schon sehr viel früher ... Nur hat damals keiner von uns an etwas Ernstes, an etwas Lebensbedrohliches gedacht.
Warum eigentlich nicht?
Anfang September 1992 erkrankt Vater an einer Grippe, die ihn - der nie wirklich `richtig` krank war - volle vierzehn Tage ans Bett fesselt. Ein Zustand, der neu ist für die Familie. Etwas, das erschreckt. Das kennen wir nicht an ihm, freiwillig bleibt er nicht so lange liegen. Es muss schlimm sein.
Völlig kraftlos ist er, nicht in der Lage, auch nur für kurze Zeit das Bett zu verlassen. Sein Hausarzt, der ihn seit vielen Jahren kennt, verordnet Antibiotika und Paracetamol Tabletten, die üblichen Medikamente in so einem Fall. Damit wird es besser werden. Nach zwei Wochen kann er aufstehen, aber bis er sich richtig erholt hat, dauert es noch lange.
Dann, Anfang Januar 1993, heißt es erneut: „Sie haben eine Virusgrippe. Aber es ist schließlich Winter, und erwischt hat es viele. Man kennt das ja. Jedes Jahr das gleiche. Dazu kommt bei Ihnen eine chronische Bronchitis, zurückzuführen auf Ihr starkes Rauchen.“
Wieder sollen Antibiotika Linderung bringen. Wieder sind es die gleichen Symptome: Husten, der ihn Tag und Nacht quält, Fieber, Schüttelfrost, Schmerzen in der linken Brust, im linken Arm, Atemnot. Er fühlt sich matt, zerschlagen, hat absolut keinen Appetit. Nur eines lässt er auch während dieser Zeit nicht: Das Rauchen.
Weniger zwar, aber 15 pro Tag werden es immer noch. Darüber kann man mit ihm nicht reden, und längst hat unsere Mutter es aufgegeben, ihn zu drängen, damit aufzuhören. Im Laufe der 39jährigen Ehe hat sie es mehr als einmal versucht - ohne Erfolg. Um nicht ständig Streitigkeiten heraufzubeschwören, hat sie es dann irgendwann bleiben lassen - schweren Herzens zwar - aber sicher besser so. Ein Problem, das vielen von uns vertraut ist.
Diesmal dauert es erheblich länger, bis Vater die Kraft hat, für einige Stunden aufzubleiben. So richtig beschwerdefrei wird er nicht. Oft sitzt er nachts auf der Bettkante oder wandert durch die Zimmer, weil er `so schlecht Luft kriegt`. Im Mai verschlechtert sich sein Zustand wieder. Sämtliche Beschwerden treten erneut verstärkt auf. Nun kann sich sein Arzt nicht mehr mit `wir haben Winter` und `eine Virusgrippe kann äußerst langwierig sein und sich schon mal gegen erprobte Arzneimittel resistent erweisen` herausreden. Mittlerweile glaubt er wohl selbst nicht mehr daran. Vater hat 20 Pfund an Gewicht verloren, ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Jetzt endlich, nach fast acht Monaten, bekommt er die Überweisung zum Röntgenfacharzt. Jetzt endlich soll die Lunge durchleuchtet werden. Warum hat niemand von uns an das Naheliegendste gedacht? Warum nicht? Warum bloß nicht?
Waren wir alle blind?
Acht Monate hatte der Tumor, um zu wachsen. Die ganze lange Zeit ist nichts geschehen. Nichts, was ihn hätte stoppen können. Was hätten Antibiotika und Grippemittel gegen die anders gearteten Zellen ausrichten sollen?
Das Resultat der Röntgenuntersuchung: „Da ist ein Schatten auf Ihrer Lunge. Das muss genauer abgeklärt werden. Sie müssen für einige Tage in die Klinik. Ambulant geht das nicht.“ Mit der Einweisung ins Kamillianer Krankenhaus kommt Vater nach Hause. Noch können wir uns etwas vormachen. Noch ist es nur ein Schatten auf der Lunge. Noch hat niemand das Wort ausgesprochen, dieses eine Wort ...
Zwei Tage später ist ein Brett frei, früh morgens fahre ich Vater die kurze Strecke bis zur Klinik. Zur Anmeldung darf ich ihn nicht begleiten. „Fahr du nur zurück. Das schaffe ich schon alleine. Wer weiß, wie lange du hier warten müsstest. Du und Mutter, ihr kommt ja heute Nachmittag.“ Nimmt sich seine Tasche und ist raus aus dem Auto, bevor ich irgendetwas erwidern kann.
Ziemlich überrumpelt bleibe ich zurück. Schaue ihm hinterher. Er ist nie ein Mensch gewesen, der seine Empfindungen zeigen oder darüber reden mochte. Und bevor ich sehen muss, wie sehr ihn die Sache mitnimmt, da schickt er mich lieber weg.
Ich verstehe ihn.
Das Reden, das wird er noch lernen, im Laufe der Zeit. Ich warte, bis er hinter der breiten Glastür verschwunden ist. Spüre seit langer Zeit wieder ein Gefühl von Zärtlichkeit für diesen Mann, der zwar biologisch mein Vater ist, der mir und meiner Schwester viele Jahre hindurch aber kein Vater war. Wir haben nebeneinander hergelebt, mehr nicht. Keiner hat den anderen an seinem Leben wirklich teilhaben lassen.
Aber jetzt plötzlich weiß ich es: Wir werden uns wieder näherkommen, ganz allmählich, zaghaft, vorsichtig tastend. Wir werden sie wiederfinden: die alte, so lange zugeschüttete Vertrautheit. Die Gefühle füreinander, die früher einmal da waren und die solange keiner von uns mehr zulassen wollte - zulassen konnte.
Ich weiß es.
Auf dem Weg vom Wagen zur Glastür hat Vater eine halbe Zigarette geraucht. Es wird seine letzte gewesen sein. Nie mehr werden wir erleben, dass er sich eine anzündet. Ich sehe noch, wie er die angebrochene Schachtel in den Papierkorb rechts neben dem Eingang wirft. Dann schluckt das Halbdunkel der Eingangshalle seine Gestalt.
Hier beginnt sein und unser Weg durch die Krankenhäuser und die Praxen unzähliger Ärzte. Unmöglich zu sagen, wie viele Stunden wir in den nun folgenden Monaten in Wartezimmern, Vorzimmern, Behandlungsräumen, auf Krankenhausfluren absitzen, ablaufen, abhoffen, abzittern werden.
Hätten wir sie zählen sollen?
Profis werden wir beide werden. Fachmenschen in Sachen Warten, in Sachen Geduld aufbringen. Ohne Buch für mich, ohne Tageszeitung oder Illustrierte für Vater, ohne Brötchen, Kaffee und Cola, ohne Medikamente - meist Tropfen gegen Übelkeit - ohne das alles werden wir nicht mehr unterwegs sein.
Wir werden ihn lernen: Den Umgang mit Chefärzten, Oberärzten, Stationsärzten, Fachärzten, Arzthelferinnen, Pflegern und Krankenschwestern. Ohne sie wird es nicht mehr gehen, die Welt der Krankheit nimmt uns in sich auf. Hier werden andere Prioritäten gesetzt, andere Gesetze vorgegeben. Eine Welt voller dunkler Farben wartet auf uns.
Aber immer wieder brechen einzelne Strahlen, bricht die Sonne durch. Trifft uns, mitten im schwärzesten Schwarz. Das ist Glück!
7. Kapitel
Nachmittags fahren wir beide, Mutter und ich in die Klinik. Meine Schwester, die wieder ganztags berufstätig ist und zwei Kinder hat, ist zwangsläufig gebundener, kann nur abends weg. Seit ich mit einem Seemann verheiratet bin, beschränke ich mich auf einen Halbtagsjob in der Drogerie, in der ich seit zehn Jahren arbeite. Ganz aufgeben wollte ich die Arbeit nicht, obwohl ein Seemann, wenn er dann auf Urlaub daheim ist, seine Ehefrau gerne ganz für sich hätte.
Verständlicherweise, ist er doch fünf bis sechs Monate auf See.
So habe ich mich eben aufgeteilt. Jetzt bin ich flexibler, abkömmlicher. Es sollte wohl so sein ... Wir gehen einen der endlos langen Flure entlang. Die letzte Tür ist es: Nummer 217.
Wie stets, wenn ich ein Krankenzimmer betreten muss, hole ich tief Luft bevor ich die Türklinke runter drücke.
Ich sehe meinen Vater das erste Mal in einem Krankenhausbett. Und erst jetzt, hier, in diesem sterilen, weißen Raum mit der hohen Decke und den kahlen Wänden, hier, in diesem sterilen, weißen Bett sieht er für mich krank aus. Die nächsten vierzehn Tage wird er hier verbringen müssen, aber so oft es möglich ist, flüchtet er: Raus in den angrenzenden Park, in dem er bald jeden Baum, jeden Strauch kennt. Glücklicherweise erlaubt ihm das Wetter diese Spaziergänge, denn das `Eingesperrt sein` erweist sich für ihn als das Schlimmste. Er, der zeitlebens gewöhnt war, draußen zu sein, unterwegs zu sein, empfindet die Enge eines Zimmers, das Beschränktsein auf die wenigen Quadratmeter, als beängstigend. Solange er `an die Luft kann`, lässt sich für ihn alles ertragen.
8. Kapitel
22.03.1993 - Der Tag.
Seit heute Mittag können wir uns nichts mehr vormachen. Unsere Gnadenfrist ist abgelaufen, länger werden wir nicht verschont. Seit der Chefvisite heißt der Schatten auf dem Röntgenbild: Krebs.
Das Ergebnis der Bronchoskopie lautet: Tumoröser Verschluss der Segmente S1 bis S3 links. Bei dem Patienten handelt es sich um ein zentrales Bronchialkarzinom des linken Lungenoberlappens. Tumorstadium T2 No Mo.
Histologie: Kleinzelliges Karzinom, Limited-Disease, funktionell operabel (zumindest Lobektomie).
Eine Untersuchung soll noch folgen um dieses:
`Im Stadium der Limited-Disease halten wir eine Operation noch für möglich` zu bestätigen.
Erneut vier Tage warten, hoffen. Vier lange Tage hinter sich bringen.
Wir alle klammern uns an dieses: Operation noch möglich. Vor Monaten ist einer von Vaters Freunden ebenfalls an Lungenkrebs erkrankt. Er wurde operiert, und er schaffte es. Er lebt. Es ist also möglich. Und leben, das will Vater. Er ist gerade 59 geworden. Wer will da sterben? Sehr viel später wird er einmal zu Schwester Marion sagen: „Dass ich an dieser Krankheit irgendwann sterben könnte, habe ich immer vor Augen gehabt, aber ich war bereit, alles auf mich zu nehmen, um diesen Augenblick hinauszuzögern“.
Und mein Vater wird kämpfen, kämpfen bis zum Schluss.
9. Kapitel
Heute morgen hat es sich entschieden: Operation - ja oder nein. Auf dem Flur schon kommt Vater uns entgegen. Wir schauen uns an, wagen nicht zu fragen. Er kann nur nicken, immer wieder nicken, während ihm die Tränen übers Gesicht laufen. Ich falle ihm um den Hals, klammere mich an ihn, packe Mutter, erdrücke sie fast. Wir drei halten uns umschlungen. Reden können wir lange nicht. Hier, auf diesem kalten, sterilen Klinikflur finden sich Vater und Tochter wieder. All das, was uns über viele Jahre getrennt hat, ist weg, hat keine Bedeutung mehr.
Wir spüren beide, wir können da wieder anknüpfen, wo wir uns einmal verloren haben. Unsere Chance ist da.
Wir drei haben den gleichen Gedanken: Alles wird gut, es kann noch operiert werden. Egal wie schlimm es sein wird: Am Ende wird alles gut. Wie eine solche Operation verläuft, wissen wir inzwischen, Vater hat sich lange mit seinem Freund darüber unterhalten. Der Weg wird nicht leicht sein, aber spielt das eine Rolle, wenn am Ende dieses Weges `Leben` steht?!
Für uns bedeutet Operation gleich Heilung. Durchgeführt werden soll sie in Köln, in der dortigen Universitätsklinik. Einer der Ärzte hat uns ganz offen gesagt: Die Chancen bei Lungenkrebs sind nicht allzu gut, von fünf Patienten mit dieser Krankheit überlebt einer. Vater wird dieser `eine` sein, davon sind wir felsenfest überzeugt. Wir müssen es wohl sein, wie sonst sollten wir, sollte vor allem Vater, weitermachen. Aber, was ist es, das uns einen derart starken Glauben gibt, was ist es, das uns an diesem Glauben festhalten lässt, das uns tragen wird über viele Monate hindurch?
Wir müssen dankbar sein dafür, denn aus dieser Zuversicht, aus dieser Gewissheit heraus, nehmen wir unsere Kraft. Glauben wir an eine höhere Macht, glauben wir an Gott, an einen, der es nicht zulassen wird, dass mir der gerade wiedergefundene Vater genommen wird. Jetzt, da wir wieder zu einer richtigen Familie zusammenwachsen.
Mutter ist eine sehr gläubige Frau, sie wird viel gebetet haben während der ganzen Zeit. Und ich? Ich weiß noch, dass ich als Kind an keinem Abend eingeschlafen bin, ohne vorher dem `Lieben Gott` zu danken für diesen schönen Tag, ohne ihn um etwas zu bitten (dass ich eine gute Arbeit schreibe, auch wenn ich lieber draußen gespielt als gelernt hatte). Der liebe Gott würde das schon irgendwie hinkriegen, darauf baute ich mit all meinem kindlichen Vertrauen. Beschützen sollte er auch noch: Mama, Papa, die Schwester (die ich auch schon mal `vergaß` wenn es zwischen uns Streit gegeben hatte), die Großeltern, meine Tiere und mich natürlich auch ein bisschen. Es gab so manches, was ich in seine Hände legte, so manches, was er wieder richten sollte.
Wie oft sollte dieses Vertrauen im laufe meines Lebens erschüttert werden. Aber ich habe lernen dürfen, dass noch alles, was mir widerfahren ist, zu irgend etwas gut war. Auch wenn ich dieses `Gute` oft erst sehr, sehr viel später sehen konnte.
Ich weiß nicht, ob ich an einen `Gott` glaube. Aber ich glaube fest daran, dass unser Leben vorbestimmt ist, dass wir unseren Weg verfolgen. Nichts geschieht zufällig, hinter allem steckt ein Sinn. Wie oft habe ich mich schon gefragt: Warum? Warum muss dir das nun wieder passieren? Warum muss das jetzt so und nicht anders verlaufen? Falsch! Vielmehr sollte es heißen: Wozu? Denn dieses `wozu` führt uns in die Zukunft, lässt uns vorwärts schauen. Gibt dem Geschehenen eine ganz andere Bedeutung.
`Warum`, das ist viel zu viel Vergangenheit.
Das Osterfest ist vorüber, es wird Mai. Die ganze Zeit über Untersuchungen, zermürbendes Warten, quälende Ungewissheit. Vater und ich wandern durch die Praxen der Radiologen, durch die Ambulanzen der Krankenhäuser. Überall neue Ärzte, neue Schwestern, neue Assistentinnen auf die man sich einstellen muss, neue Termine, stundenlanges Absitzen in den Wartezimmern.
Viele Ärzte, viele Schwestern die uns freundlich, menschlich begegnen, manche, wohl abgestumpft durch jahrelange Routine. Immer die gleichen Handgriffe, die gleichen Anweisungen, und dann Patienten, die nicht gleich begreifen, wie sie sich hinzulegen, hinzustellen haben. Oft frage ich mich: Wieso bloß halten die an ihrem Beruf fest? Die sind doch hier absolut fehl am Platz. Hier, wo es um Menschen geht, Menschen mit all ihren Ängsten.
Unsere Sammlung von Berichten, Beurteilungen und Röntgenaufnahmen wird zusehends umfangreicher. Wir fotokopieren jedes Blatt und bewahren es zuhause auf. So können wir alles in Ruhe nachlesen, und wenn wir Fragen haben, dann löchern wir die Ärzte. Hier geht es schließlich nicht um eine harmlose Grippe, hier geht es um Krebs.
Es erweist sich außerdem als vorteilhaft, bei jedem neuen Arztbesuch die Papiere gleich vorlegen zu können, den genauen Stand dabei zu haben.
Bisher sind an Voruntersuchungen durchgeführt worden: Zahlreiche Sonografien, je eine Computertomografie des Thorax, des Abdomens und des Schädels. Vater durchläuft die ganze Maschinerie der Apparatemedizin. Jeder Winkel des Körpers, jedes Organ wird durchleuchtet. All das, um, wie es heißt, `eine mögliche Metastasierung auszuschließen`. Kurz bevor er in der Kölner Uni `antreten` muss - wie Vater sagt - wird in einem hiesigen Krankenhaus noch eine Knochenszintigrafie gemacht. Der handschriftliche Vorabbefund des Professors, in dem es heißt: `Keine Anzeichen von Metastasen`, wird uns gleich mitgegeben, der endgültige Bericht soll direkt nach Köln geschickt werden.
Später werde ich in einem Buch von Prof. Julius Hackethal in dem Kapitel: `Riskante Überdiagnostik wie Mammografie, Szintigrafie, Computertomografie´ einmal folgendes lesen: “Im Zusammenhang mit der Strahlendiagnostik bei Krebs interessiert in erster Linie die Frage, ob durch Diagnosestrahlung vorhandene Krebszellen zu rascher Zellteilung, also zur Krebsvermehrung, angeregt werden können oder nicht. Dies geschieht immer! Besonders große Gefahr der Vermehrungsaktivierung von Krebszellen geht von der Szintigrafie aus. Bei dieser Flimmerbilddiagnostik mit Hilfe der Einspritzung von radioaktiven <Glühwürmchen> ins Blut, die wie Wunderkerzen sprühen, wird die Strahlung über den ganzen Körper verteilt. Die Röntgenologen bagatellisieren die Gefahr von Strahlenschäden damit, dass die Halbwertzeit der verwendeten Substanzen sehr kurz sei, verschweigen dabei jedoch, dass der Strahlungsrest trotz des ständigen Zerfalls noch Wochen bis Monate wirksam bleibt. Auch von allen anderen Röntgenuntersuchungen gehen Aktivierungsgefahren für vorhandene Krebsherde aus. Ganz besonders gilt dies auch für die Computertomografie, bei der ja das Gewebe kurz hintereinander mehrfachem Strahlenbeschuss ausgesetzt wird!"
Was also soll man als Laie tun? Wer durchschaut schon die ganzen Vorgänge? Welche Behandlung soll man wählen, welchen Weg man gehen, welchem Arzt sich anvertrauen? Wo wird man überhaupt genügend intensiv aufgeklärt, wer nimmt sich die Zeit für Gespräche? Steht man als Patient nicht schrecklich hilfslos da? Tut nicht so mancher in der ersten Panik Dinge, trifft Entscheidungen, die er hinterher bereut?
10. Kapitel
Anfang Juni ist es soweit: In dem festen Glauben, dort werde ich nun endlich operiert, geht Vater in die Klinik. Das erste Mal fahren wir von Mönchengladbach nach Köln, den Weg, den wir in den folgenden Monaten so oft noch werden zurücklegen müssen. Vor uns: Das riesige Universitätsgelände mit seinen vielen Gebäuden. Ein einziger Irrgarten, den ich mir später auf meinen Spaziergängen erlaufen werde:
Durch den Haupteingang, geradeaus, der Studententrakt: Kursräume, Hörsäle, überall Pinnwände: Hier werden Zimmer gesucht, Austauschplätze, medizinische Fachliteratur, Urlaub und Nachhilfeunterricht werden angeboten, auf Veranstaltungen wird hingewiesen.
Rechts in der Ecke: Die orangefarbenen Aufzüge, die zum Zentrallabor führen. Ich werde sie oft benutzen, um Vaters Blutproben hinaufzubringen. Tritt man durch die Glastür ins Freie, weisen einen Tafeln zur Poliklinik für Kinderheilkunde, für Nuklearmedizin, zur Klinik für innere Medizin, für Orthopädie, Frauenheilkunde, Arbeitsmedizin, Strahlentherapie, in ein Gebäude für die Kernspintomografie, zur Schmerzambulanz, zu einem Forschungstrakt, zur Bibliothek. Wer sich hier nicht verläuft, ist selbst schuld.
Wir parken unseren Wagen in der Tiefgarage, von wo aus uns einer der drei Aufzüge in die Eingangshalle hochbringt. Unser erster Gedanke: Wie furchtbar! Wie entsetzlich groß ist alles! Wir, die wir bisher nur ganz normale, überschaubare, im Gegensatz hierzu fast heimelige Krankenhäuser kennen, geraten nun in den für uns fremden, anonymen Betrieb einer Universitätsklinik.
Das hat etwas zutiefst Beängstigendes, Verunsicherndes, Beklemmendes.
Es ist erstaunlich, aber im laufe der Zeit werden wir uns einpassen, alles wird vertraut werden, das Beunruhigende wird sich verlieren. Wir werden uns an einige Gesichter gewöhnen, werden den Mann am Informationsschalter, die beiden Frauen vom Kiosk, einige Schwestern und Ärzte wiedererkennen, begrüßen. Wir werden in dieser für uns neuen Welt einen Halt haben.
Wir wenden uns zur `Anmeldung`, einem langgestreckten Glaskasten mit bestimmt sechs Schaltern, vor denen die Wartenden in Viererreihen sitzen. Die Sonne scheint, der Kasten ist entsprechend aufgeheizt, die Luft hier drinnen warm und stickig. Auch wir müssen geduldig ausharren. Mehr als eine Stunde vergeht, bis wir mit den nötigen Papieren versehen zur `Chirurgischen` geschickt werden. In einigen Tagen wird der O.P.- Termin nun wohl definitiv feststehen.