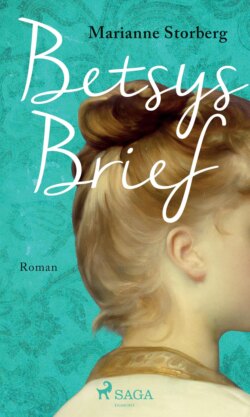Читать книгу Betsys Brief - Marianne Storberg - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Hjalmar Christiania, Dezember 1840
ОглавлениеDas Haus ist niemals so still gewesen. In den Fluren ist es dunkel. Alle Türen sind geschlossen, doch dahinter ist niemand mehr, der weint oder jammert. Das laustarke Gezänk der beiden Jüngsten ist verklungen. Nicht einmal Halfdans leises Geklimper auf dem Klavier ist zu hören.
Es ist Mitte Dezember. Ganz Christiania ist mit einer weißen Decke überzogen. Oben in Bakkehus reicht der Schnee bis zu den Fenstern. Die Vorweihnachtszeit ist nicht mehr so wie früher. Die Girlanden, die im Vorjahr das Treppenhaus schmückten, liegen in Kisten verstaut, Weihnachtsdekorationen und Kränze wurden ebenfalls nicht aufgehängt. Der Kronleuchter ist voller Spinnweben, und das Silber ist matt und schwarzfleckig, ohne dass sich jemand darum kümmert. Kein Duft nach Nelken, Zimt und dampfendem heißen Punsch.
Stattdessen haben sich alle im Haus in ihre Zimmer zurückgezogen, und Platz gibt es genug. Noch immer ist die Familie groß, aber das hat nicht viel zu bedeuten, jeder ist für sich allein.
Denn jetzt ist es geschehen. Jetzt steht Idas Zimmer leer, es ist ausgeräumt. Bettzeug, Blumen, Bücher, alles ist verschwunden, das Licht ist gelöscht, und zurück bleiben nur die Dunkelheit und der kalte Zug von den Fenstern, die zum Garten hinaus gehen.
Hjalmar steht auf der Türschwelle. Seine Füße sind kalt. Das blauweiße Licht vom Schnee dort draußen wirft einen schwachen Schein auf den Fußboden unterhalb der Fenster. Das Laken auf dem Bett ist glatt und gestärkt. Er streicht mit der Hand über die kalte Fläche. Nicht ein einziges dunkles Haar ist von ihr übrig geblieben, nachdem sie hier den ganzen Herbst hindurch gelegen hat.
Er ist neunzehn Jahre alt. Ida war vier Jahre älter.
Der Garten ist unter dem Schnee verborgen. Dort unten war es, wo sie herumsprangen, kletterten, stritten. Lachten. Eine Blindschleiche fanden. Wilde Erdbeeren. Mit den Katzenjungen spielten. Die Tupfen auf einem Marienkäfer zählten.
Sie war das einzige Mädchen in der Jungenschar. Er sieht sie vor sich, niemand konnte so gut Seilspringen wie Ida, niemand konnte sich so viele Pflaumen in den Mund stopfen wie sie, der Saft lief ihr aus den Mundwinkeln und tropfte auf das Kleid. Noch immer sieht er es deutlich vor sich, wie Ida Theodors Tränen abwischt, er hat eine Schürfwunde am Ellbogen, sie setzt ihn in den kleinen Wagen und zieht ihn über den Weg, bis er lächelt und alles vergessen hat. Ida, die flüstert: »Hab keine Angst, Hjalmar«, und sagt, dass er in ihren Armen liegen darf, wenn er mag. Ida, die gebadet hat und ihr Haar zu einem langen dunklen Zopf geflochten trägt, der die Rückseite ihres Nachthemds ganz nass werden lässt. Ida, die plötzlich zu einem orthopädischen Institut in Deutschland fahren muss und lange fortbleibt, obwohl sie erst vierzehn Jahre alt ist. Und Ida, die im Korbstuhl vor der Fliederhecke sitzt, mit einer Wolldecke über dem Schoß, obwohl es vorsommerlich warm ist. Sie ist verliebt, der träumende Blick, sie lächelt, und Hjalmar weiß, dass es Welhaven ist, an den sie denkt.
Jetzt sind das alles nur noch Bildfragmente in seinem Kopf, der Garten ist von mindestens einem Meter Schnee bedeckt, und wenn der Sommer kommt, wird Ida nicht mehr hier sein, um den Duft des Flieders zu spüren.
Die Uhr im Flur schlägt elf. Er wagt es nicht, sich hinzulegen, am schlimmsten ist es, wenn er dort allein liegt und schlafen will. Stattdessen versucht er, sich wachzuhalten, auch wenn die Augen vor Schlafmangel brennen und die Glieder schmerzen. Sieben Nächte hintereinander hat er diese Strategie gewählt, bis er schließlich aufs Bett sank und in einen traumlosen Schlaf fiel.
Im Flur ist es dunkel. Er steht vor Halfdans Zimmer und schaut nach, ob Licht unter der Tür hervordringt. Es sieht nicht so aus. Vorsichtig klopft er an. Keine Antwort, er schläft vielleicht schon oder will einfach allein sein. Am anderen Ende des Flurs bleibt er stehen und hört den lauten, rasselnden Husten des Vaters.
Unten in den Zimmern ist es kalt. Etwas früher am Abend hörte er die Mutter zu Johanne sagen, es sei nicht nötig einzuheizen, ganz bewusst haben sie das Feuer in den Öfen ausgehen lassen. Im Halbdunkel erkennt er die Anrichte, die noch immer mit Blumen und Karten übersät ist. Im Laufe des Tages hat sich ein schwacher Geruch nach fauligem Blumenwasser gebildet, und einige der Sträuße hätten schon längst entfernt werden müssen. Aber niemand ist da, der es tut.
Ein Jahr, und alles ist anders. Denn es muss genau zu dieser Zeit im letzten Jahr gewesen sein, im Dezember 1839, als hier in Bakkehus eine Weihnachtsgesellschaft stattfand. Die Zimmer waren warm, es knisterte in den Öfen, überall brannten Kerzen, es gab lachende Menschen und Musik. Im Lehnstuhl, der jetzt leer und dunkel dasteht, mit dem hübsch arrangierten Kissen, saß der Großvater und erzählte mit lauter Stimme Geschichten, während er Weihnachtsleckereien aß und offenbar Eindruck bei einem der Gäste hinterließ, wenn Hjalmar sich richtig erinnert, war es Frau Hansen.
Alle waren bei guter Gesundheit, die Stimmung war fröhlich, ja sogar Halfdan erzählte die eine oder andere gute Geschichte. Nur wenige Tage zuvor hatten sie Nachricht von Regnald erhalten, der wohlbehalten in Hamburg angekommen war, wo er eine Kaufmannslehre in einem der großen Handelshäuser machen sollte.
Alle waren froh gestimmt. Halfdan spielte etwas vor, Theodor und die Mutter sangen. Onkel Peder überredete die Herren zu einer Kartenpartie, und die halbe Gesellschaft verschwand im Rauchsalon. Hjalmar weiß noch, wie Halfdan sich ihnen anschloss und plötzlich so erwachsen aussah, zusammen mit dem Vater und den anderen. Er hatte versucht, Halfdans Blick aufzufangen, aber der hatte ihn übersehen, denn nun war er entscheidende sechs Jahre älter.
Hjalmar knackte Nüsse und spielte bis kurz vor Mitternacht mit Ida Vielliebchen. Warum waren sie nicht einfach sitzen geblieben? Wieso gähnte er und verabschiedete sich, als Ida ihn zu einer neuen Runde drängte?
Das Sofa, auf dem sie saßen, steht jetzt im Dunkeln, fast scheint es, als hätte nie jemand darauf gesessen.
Das bleiche Winterlicht weckt ihn. Offenbar hat er die Vorhänge nicht zugezogen, bevor er sich hinlegte. Es ist kalt, er zieht sich eine Wolljacke über.
Unten auf dem Hofplatz ist der Schnee schon geräumt worden, hoch aufgetürmt liegt er vor dem Stall.
Hjalmar hört Dorthes Stimme und sieht sie dort unten hin und her eilen, sie fuchtelt herum, schwenkt die Arme, lässt jemanden das Gepäck hinaustragen.
Lasse holt das Pferd, warme Decken werden zum Schlitten gebracht. Und da kommen Axel und Theodor, eingepackt in Pelze und Schals, wie folgsame Pinguine, und setzen sich in den Schlitten.
Sein Atem beschlägt an der Scheibe, er wischt mit der Hand darüber, um bessere Sicht zu haben. Jetzt fahren sie wohl los, Dorthe und die jüngeren Brüder, streitlustige Jungen für gewöhnlich, doch in den letzten Tagen waren sie beide ungewöhnlich schweigsam. Lange werden sie nicht fortbleiben, sollen nur mal woanders hin, hinauf zum Großvater nach Grini. Abwechslung ist genau das, was in diesen Tagen vonnöten ist.
Unten im Esszimmer ist niemand, die anderen müssen schon lange vor ihm aufgestanden sein. Er horcht, hört aber nur Beate, die drinnen in der Küche mit dem Besteck herumklappert. Schließlich kommt sie mit der Teekanne. Er fragt, wo alle sind. Halfdan ist ins Büro gegangen.
»Ins Büro? Heute?«
Wie seltsam. Er dachte, Halfdan hätte sich ein wenig freie Zeit ausgebeten, nach allem, was in letzter Zeit passiert ist. Und außerdem ist ja auch bald schon Weihnachten. Den ganzen Herbst hat Halfdan über die Zeitung und die Redaktionsleitung geklagt. Den Constitutionelle. Angeführt von Andreas Munch, dem Dichter in Person, wie Halfdan ihn ein wenig sarkastisch nennt. Einen noch hoffnungsloseren Redakteur müsste man wohl lange suchen.
Armer Halfdan. Wenngleich er ein guter Beobachter ist und eine spitze Feder führt, gefällt er sich doch ganz und gar nicht in der Rolle des Journalisten. In letzter Zeit hat sein Gesicht einen müden Zug bekommen, den man bei einem Mann Mitte zwanzig nicht erwarten würde. Er ist verbittert, kommt nicht mehr aus dem Trott heraus, in dem er gelandet ist. Der Enthusiasmus, den er nach der Studienreise nach Paris im Sommer aufgebracht hatte, erwies sich als kurzfristig. Hellauf begeistert war er gewesen angesichts all der Konzerte, die er besucht hatte. Und mehr als bereit, endlich selbst etwas zu erschaffen. Im Laufe des Herbstes jedoch erforderte die Arbeit immer mehr Zeit. Jetzt spricht er nur noch ganz verächtlich von dem Auslandsaufenthalt, sagt, es sei völlig umsonst gewesen, eine unnötige Verschwendung von Zeit und Geld, und sowieso habe er zu nichts geführt. Hjalmar hat versucht ihn aufzumuntern, du bist so tüchtig, Halfdan, es ist doch klar, dass du es zu etwas bringen kannst! Du musst dir deine Träume bewahren, Halfdan! Aber es ist nutzlos. Es steht nicht in seiner Macht, den Bruder zu einer Änderung seiner Lebenssituation zu bewegen. Die Initiative muss von ihm selbst kommen.
Die Uhr auf der Anrichte tickt.
»Hat er gesagt, wie lange er fortbleibt?«
Beate schüttelt den Kopf. Ihre Hand zittert, die Kanne stößt an die Porzellantasse, es lässt sich nicht vermeiden, dass sie etwas Tee vergießt.
»Oh je. Ich bitte vielmals um Entschuldigung.« Sie beeilt sich, eine Serviette zu holen, aber sie hat einen Hüftschaden, darum dauert es seine Zeit. Der Vater kann es nicht ausstehen, wenn der Tee auf die Untertasse schwappt, im Laufe der Jahre hat er stets ein großes Gewese um diese Unfälle gemacht, die immer öfter einzutreten scheinen. Ja, sogar die Entlassung der alten Beate war im Gespräch. Interessanterweise scheiterte dies am entschiedenen Einspruch der Mutter, die sonst nicht eben für großes Mitgefühl gegenüber Menschen niedrigeren Ranges bekannt ist.
»Aber das macht doch nichts. Es macht überhaupt nichts.«
Er sieht, wie sich Erleichterung auf ihrem faltigen Gesicht ausbreitet.
So ist es also. Halfdan ist hinunter ins Büro gegangen. Geflüchtet. Er hält diese Stimmung wohl auf Dauer nicht aus. Sogar die Redaktion ist dem noch vorzuziehen. Das sagt nicht eben wenig.
Regnald, der es nicht geschafft hat, aus Deutschland nach Hause zu kommen, kann wahrscheinlich nur froh darüber sein.
Im Flur hält Halfdan den Blick nach vorn gerichtet, vermag es nicht, in Idas Zimmer zu schauen. Die Sonne glänzt über dem Fjord. Frostiger Nebel schiebt sich wie eine Decke über die Stadt. Darunter glitzern die verschneiten Hausdächer. Nur der Kirchturm an der Festung ragt aus dem Nebel, und ganz unten, wie ein einsamer Außenposten am Fjord, ist der runde Turm des Observatoriums erkennbar.
Schon als Kind hat er kleine Skizzen von dieser Aussicht gefertigt, hat versucht, die Perspektive herauszuarbeiten, die Ansicht der Häuser unter ihm, die grünen Hügel, die Inseln, den Fjord. Von Bakkehus aus hat er ein großartiges Panorama vor sich, und niemals wird er es leid, am Fenster zu stehen und hinauszublicken. Farben, Lichter und Schatten.
Oben im Arbeitszimmer liegen seine Skizzen über den Tisch verstreut. Es ist das Eckzimmer am Ende des Nordflügels, das ist perfekt für ihn, das einzige Problem ist die Kälte dort.
Er hätte vielleicht Beate rufen sollen, sieht dann aber vor sich, wie sie den Holzkorb über die Hintertreppe schleppt, und bringt es nicht übers Herz. Normalerweise hätte er Johanne gebeten, den Ofen anzuheizen, aber die ist nach Hurum zu ihrer Mutter gefahren, die schwer krank ist und Weihnachten wohl kaum überleben wird.
Das Anmachholz liegt im Korb, er entzündet ein Feuer, rasch wird es größer, und er spürt die Hitze auf die Hände strahlen.
Es ist ein bescheidenes Zimmer, ursprünglich als Gästezimmer gedacht, doch niemals dazu verwendet. Die Mutter meint, die Aussicht auf den Wald und den Holmenkollen sei so düster, und stets hat sie eine andere Lösung gefunden, wenn Gäste über Nacht blieben. Platz ist kein Problem.
Nachdenklich blättert Hjalmar durch die Skizzen, die er in den letzten Monaten angefertigt hat. Ein paar alltägliche Szenen aus dem Haus. Eine Zeichnung von Ida im Gespräch mit den Eltern unten im Wohnzimmer. Da ging es Ida noch verhältnismäßig gut. Es muss irgendwann im Mai gewesen sein, an einem lichten Nachmittag. Wie so oft wurde über ihre Zukunft gesprochen, dieses Thema, das so lange vor sich hingegärt hatte und manchmal zur Sprache kam und eine drückende Stimmung erzeugte.
Er hatte etwas sagen, sich einmischen wollen. Mit jeder verstreichenden Sekunde kochte es in ihm hoch, zerrte an ihm. Dass Ida und Johan Sebastian Welhaven einander liebten, hatten alle verstanden, aber für die Eltern war die Liebe zweitrangig. Welhaven war nicht gut genug, er war ein indiskutabler Bohemien, bekannt für seine scharfe Zunge und sein schwieriges Wesen. Und seine Ökonomie war höchst unsicher. Ihm fehlte das nötige Etwas, er war Ida nicht würdig. Das war der Punkt. Hjalmar konnte nicht verstehen, wieso die Eltern so hartherzig waren, sie mussten doch sehen, wie sehr Ida litt.
In der nachmittäglichen Sonne stand sie am Fenster. Er selbst hatte sich auf einen Stuhl neben den Kachelofen gesetzt und betrachtete sie verstohlen. Die Verzweiflung stand ihr ins Gesicht geschrieben, es war kaum auszuhalten. Er hätte sie alle überraschen können, ein unerwarteter Angriff von der Seite, der alle schachmatt gesetzt hätte, er hätte schreien, den Stuhl umwerfen und die chinesische Porzellanvase herunterfegen können, er hätte vortreten und ihnen zurufen können, dass sie Ida damit zerschmetterten, dass man auf die Liebe hören müsse, er hätte den Vater schlagen, die Faust auf seine glänzende Nase rammen können, bis das Blut auf den weißen Hemdkragen gespritzt wäre. Und dann hätte er der Mutter eine saftige Ohrfeige verpassen können von eben jener Art, die sie selbst austeilte, wenn sie die Besinnung verlor.
Aber Hjalmar unternahm nichts dergleichen und blieb stumm. Stand nur voller Anspannung da, hörte zu und schämte sich für seine eigene Feigheit, obwohl er doch Idas Alliierter war, der auserwählte Bote, der in aller Heimlichkeit Zettel und Briefe überbrachte, die die Liebenden einander schrieben. Wie üblich schrumpfte er in der Anwesenheit des Vaters zusammen. Immer wieder schaffte es der Vater, dass er sich wie ein kleines Kind vorkam. Trotz Idas flehenden Blicken hatte er ihr schließlich den Rücken zugekehrt, war hinausgegangen und hatte die Tür hinter sich geschlossen, um dem Geräusch ihrer Stimmen zu entkommen. Dann hatte er sich oben in sein Zimmer gesetzt und gezeichnet.
Eine verblichene Bleistiftzeichnung in seinen Händen, mehr ist nicht übrig geblieben.
Er blättert durch die Skizzen aus dem Garten. Im Sommer hat er unzählige Stunden dort draußen verbracht, mit Landschaft und Perspektive gearbeitet, aber auch kleine Detailstudien angefertigt von Blumen, dem Springbrunnen, dem Lusthäuschen und der alles umgebenden Hecke. Halfdan war zu jener Zeit in Paris, aber Hjalmar hatte die Skizzen Ida gezeigt, die im Schatten auf der Veranda saß, in dem Korbstuhl, der dicht an eine der Säulen herangerückt war.
Besonders die Blumenbilder hatten sie bezaubert, und er schenkte ihr eines davon. Sie hatte es einrahmen lassen und über ihrem Bett aufgehängt, neben dem Bild mit dem Engel und den kleinen Kindern.
Idas helle, klare Stimme. Er schließt die Augen und hört sie. So unverdrossen hat sie versucht, ihn aufzumuntern. Als hätte sie gewusst, dass ihre Zeit bald vorüber sein würde, und wollte sich vergewissern, dass er, der jüngere Bruder, nicht den Glauben an sich selbst verlor. Sie und Halfdan, immer waren sie für ihn dagewesen. Sie drei hatten immer versucht, einander zu beflügeln. Hinauf ins Licht, fort von Schwermut und Niedergeschlagenheit, heraus aus dem Dunkeln, heraus aus der Düsternis in Bakkehus.
Er blättert weiter durch die Arbeitsskizzen, aus denen das Gemälde des Vaters entstanden ist, das Bild, das nun unten in der Bibliothek hängt und mit einem exklusiven, vergoldeten Rahmen in den Adelsstand erhoben wurde.
Die Idee zu dem Bild war vor zwei Jahren entstanden, als er, Halfdan und Regnald anlässlich einer Feier, bei der der König anwesend war, in die Stadt mitkommen durften. Onkel Peder hatte sie begleitet. Es war ein warmer Junitag, die Straßen waren mit Laubwerk und Blumen geschmückt, und es waren so viele Menschen auf den Straßen, dass es kaum möglich war, sich vorwärts zu bewegen. Er hatte sich auf die Zehenspitzen gestellt, um gut sehen zu können, dicht neben Halfdan, der immer noch einen halben Kopf größer war als er. Dann erklangen die Fanfaren, und schließlich kam die Prozession über den Platz geschritten, angeführt von einer Gruppe, zu der sein Vater gehörte, Reichsherold Kjerulf zu Pferde, mit ernster, feierlicher Miene unter dem prunkvollen Hut. Und selbstverständlich trug er eine äußerst schmuckvolle Uniform mit einem Dutzend Schnüren, Quasten und Orden. Halfdan hatte ihn angestupst, ganz diskret natürlich, Onkel Peder bekam nichts mit. Sie wechselten einen Blick, und er sah, dass Halfdan kurz davor war, in Lachen auszubrechen. Worte waren überflüssig.
Die Skizzen, die er aus der Erinnerung angefertigt hatte, wurden dann zu einem Gemälde: ein stolzer Ritter auf einem kräftigen Streitross in wichtiger Mission. Ein Außenstehender hätte den Ausdruck des Bildes als leicht karikiert auffassen können. Doch Halfdan und er wussten, dass es mit der Wirklichkeit übereinstimmte. Der Vater war völlig begeistert und sagte, das Gemälde sei meisterhaft ausgeführt.
Dass der Tag vergeht, ist geradezu ein Wunder. Dann schließlich ist er vorbei, die Hügel vor dem Fenster werden im rosa Licht des Winterabends gebadet. Im Innern des Hauses senkt sich die Dunkelheit herab.
In der Küche hört er die Uhr läuten. Er kleidet sich zu einem frühen Abendessen um. Vom Fenster aus blickt er auf den Hofplatz hinunter. Das Licht ist schummrig, die blaue Stunde. Am Ende der Allee kommt eine dunkel gekleidete Gestalt zum Vorschein. Es ist Halfdan, der den Kragen bis zu den Ohren hochgezogen hat und mit schweren Schritten weitergeht, als wäre seinen Füßen danach zumute, auf der Stelle umzukehren und einen anderen Weg einzuschlagen. Gut, dass er kommt. So muss Hjalmar den Abend nicht allein mit den Eltern verbringen.
Unten in der Halle treffen sie aufeinander. Halfdan begrüßt ihn kurz und wirkt nicht sehr redselig, er klopft den Schnee von den Schuhen und hängt seinen Mantel auf.
Die Uhr schlägt ein letztes Mal, es ist an der Zeit, zu Tisch zu gehen. Die Eltern sitzen schon im Esszimmer, jeder an seinem Tischende. So weit voneinander entfernt, wie es eben geht.
Heute bleiben viele Stühle leer. Doch auf diese Weise schreit ihm Idas leerer Platz nicht so unverhohlen entgegen. Er nimmt gegenüber von Halfdan Platz.
Entgegen der Sitten in Bakkehus ist der Tisch bescheiden gedeckt. Aus der Suppenterrine steigt Dampf auf. Die Mutter hat angeordnet, eine einfache Bouillon und Fladenbrot zu servieren, niemand hat besonderen Appetit. Und keinen Alkohol.
»Greift zu.«
Es ist seltsam, wie beengt ein herrschaftliches Esszimmer solcher Größe wirken kann. Es scheint, als senke sich der Kronleuchter herab, als rückten die Wände näher heran. Halfdans Bisse in das knusprige Fladenbrot und das Schlürfen des Vaters übertönen alle Geräusche. Er sieht zu seiner Mutter, die zusammengesunken dasitzt und gedankenverloren in der Suppe rührt.
Unverhofft entgleitet dem Vater der große Silberlöffel und landet mitten auf dem Teller. Mit einer gereizten Bewegung versucht er, die Flecken auf der dunkelroten Seidenweste abzutupfen, dann befestigt er die Serviette sorgfältig über der Brust. Er räuspert sich und blickt auf.
»Der Brief vom norwegischen Militärinstitut ist heute gekommen.«
Hjalmar erstarrt und muss alle Konzentration aufwenden, um herunterzuschlucken, was er gerade im Mund hat. Der Vater betrachtet seine Zeichnungen bloß als Hobby und Zeitvertreib. Das norwegische Militärinstitut. Das besiegelt wohl sein Schicksal. Die Eltern haben eine militärische Karriere für ihn geplant. Er kneift die Augen zusammen, versucht die Bilder von Rauch, Kanonendonner und verstümmelten Körpern aus seinem Kopf zu verscheuchen. Die Geschichten zu verdrängen, die er gehört hat über den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und die Schlacht bei Waterloo.
»Der Aufnahmeprüfung für die Kavallerie steht nichts mehr im Wege.«
Schon seit einem ganzen Jahr nagt die Furcht an ihm, überschattet nur von anderen Geschehnissen während der letzten Monate. Nun ist sie also wieder da.
Er fängt Halfdans Blick auf, der so erfüllt ist von aufgestauten Frustrationen, dass es ihm kalt den Rücken herunterläuft. Besser als jeder andere weiß Halfdan, worum es hier eigentlich geht. Die Geschichte, die niemals aufhört, sich zu wiederholen. All die Manipulationen und Zwänge, die hier ausgeübt werden, sowohl was die Wahl des Berufs als auch die des Ehepartners betrifft. Es herrscht ein Mangel an Respekt, dieses ewige Lächerlichmachen der Künstlerträume. Dabei ist die künstlerische Ader doch eine Gnade, ein Geschenk, und hat in zahlreichen Zusammenhängen so manchen glänzen lassen. Doch Tradition und Vernunft haben Vorrang, sogar wenn man sie ihnen einprügeln muss.
Sein Hals schnürt sich zusammen, er räuspert sich und gewinnt ein paar Sekunden Zeit.
»Aha!«
Halfdan hat aufgehört zu kauen. Mit zusammengebissenen Zähnen sitzt er da und stiert auf den Mahagonitisch hinunter.
Über irgendetwas muss man wohl reden. Doch das Thema erscheint ihm reichlich deplatziert. Der Vater erwartet sicher keine Antwort, und außerdem bemüht er sich gerade, den heftigen Hustenanfall zu überstehen, der in seiner Brust wütet.
Wie sehr seine Augen doch glänzen. Und wie grau seine Haut aussieht. Geht es dem Vater womöglich wieder schlechter?
In ihrem schwarzen Wollkleid sitzt die Mutter gebeugt am Tisch. Sie hat kein Wort gesagt und ihre Mahlzeit kaum angerührt. Jetzt greift sie nach der kleinen Messingglocke und ruft Beate.
Die klappernden Teller lockern die drückende Stille auf. Ein einfaches Obstkompott als Dessert. Sogar das scheint die Mutter nicht zu reizen, obwohl sie Süßes doch sonst so gerne mag. Mit leerem Blick starrt sie auf die kleine Dessertschale, als ginge sie das alles überhaupt nichts an.
Es ist Abend geworden, das Mondlicht ergießt sich über die Felskluft draußen. Beate zieht die Vorhänge vor und verschwindet in die Küche.
»Frau Fougstad hat von der Beerdigung gehört.«
Erstaunt wendet sich Hjalmar der Mutter zu, die plötzlich das Wort ergriffen hat. »Ach ja? Und was ist damit?«
Die Mutter stochert in ihrem Kompott.
»Ja, sie war gestern bei den Colletts. Da wurde wohl davon gesprochen, wie ausnehmend schön die Beerdigung war.«
Ein trauriges Lächeln, ein ferner Blick.
»Und ich bin sehr froh, dass wir uns für die schönen Gestecke entschieden haben. Ein paar der Gäste haben die Lilien am Altar kommentiert. Und Frau Hansteen und Frau Fougstad konnten sich an den Schnitzereien auf dem Sargdeckel gar nicht sattsehen.«
Hjalmar hört Halfdan husten, als säße etwas in seinem Hals fest.
Er selbst hat beschlossen, den Tag zu vergessen. Er musste es zur eigenen Selbsterhaltung, mit den Erinnerungen an Idas Beerdigung kann er nicht weiterleben. Das Gewicht auf der Schulter, der schwere Sarg, der sich durch die dünne Jacke ins Schlüsselbein grub, Halfdan, der mit schleppenden Schritten vor ihm durch den Schnee stapfte, das weiße Schneetreiben, als sie sich, gefolgt von dem schwarz gekleideten, stummen Trauerzug gen Friedhof wandten. Die Erinnerungen müssen fort, müssen in eine dichte und verschließbare Kiste eingesperrt und an einem geheimen Ort verborgen werden, zu dem er keinen Zugang hat.
Er faltet die Hände im Schoß und schickt ein Gebet zum Himmel, dass die Ausführungen der Mutter bald beendet sein mögen, doch sie spricht weiter, ins Leere hinein, nur zu sich selbst, als nähme sie niemanden wahr.
»Aber dass er nicht da war, dass musste ja ein Gesprächsthema werden. Ich begreife es einfach nicht. Frau Fougstad hat irgendwo gehört, er sei zu Møller auf Gut Thorsø gefahren.«
Nach einer langen Pause schüttelt sie resigniert den Kopf.
»Dass er uns das antun konnte.«
Jetzt meldet sich der Vater vom anderen Ende des Tisches.
»Herrgott, Elisabeth, es spielt doch keine Rolle, was dieser Mann macht. Warum kannst du nicht aufhören, ihn in unserem Hause ständig zu erwähnen? Kannst du das nicht einfach lassen? Johan Sebastian Welhaven geht uns nichts an.«
Die letzten Worte werden mit soviel Nachdruck und so laut ausgesprochen, dass die Mutter einen Blick in Richtung Küchentür wirft, um sich zu vergewissern, dass sie auch ordentlich geschlossen ist. Es gibt schließlich Grenzen für das, was man über die engste Familie hinaus mit anderen teilen möchte.
Hjalmar späht zu Halfdan hinüber und weiß, dass er dasselbe denkt. Die glänzenden Augen des Vaters sind beunruhigend. Und die Krankheit stimmt ihn nicht gerade milder.
So vergehen ein paar weitere Tage. Wenn er aufsteht, weiß er nicht, wie er den Tag überstehen soll, und wenn der Abend kommt, ist er allein und rastlos, doch ganz ohne Antrieb.
Bis Weihnachten sind es noch vier Tage. Natürlich erwartet niemand, dass die Familie gerade jetzt am gesellschaftlichen Leben der Stadt teilnimmt, die Einladungen strömen jedoch trotzdem in dieses Trauerhaus, und sei es auch nur aus Höflichkeit.
An den Vormittagen bleibt Hjalmar im Wohnzimmer sitzen und blättert die Einladungen durch. Alle sind hübsch geschmückt mit Goldrand, Siegel und Seidenband. Im Laufe der kurzen Vorweihnachtstage ist in der Hauptstadt so einiges geplant. Soiréen und Theatervorstellungen, ein Hauskonzert bei Morgenstierne, eine Teegesellschaft bei Colletts, Punsch bei Hansteens und ein Diner bei der Komtesse Knuth und natürlich der legendäre Neujahrsball bei Familie Sibberen.
Er hält eine Einladung der Familie Richards in der Hand, für heute Abend, den 20. Dezember. In schmuckvollen Lettern steht da geschrieben: Willkommen zum Weihnachtsball.
Im letzten Jahr, nachdem er achtzehn geworden war, durfte er zum ersten Mal mitkommen. Er kann sich noch gut erinnern, zumindest an den ersten Teil des Abends. Trotz einiger Bedenken hatte man ihm erlaubt, mit Halfdan und Regnald zu gehen. Bevor sie losfuhren, hatte er lange vor dem Spiegel gestanden, das Haar zu einem Seitenscheitel frisiert, sich dann aber umentschieden und den Pony in die Stirn gekämmt. Die Jacke war plötzlich an den Armen viel zu kurz, in letzter Sekunde bekam er eine von Halfdan, mit schwarzem Samt an den Aufschlägen, sie passte perfekt. Als sie aufbrachen, zitterte er vor freudiger Erwartung. Endlich sollte er erleben, worüber die Brüder sonst sprachen. Die Frauen. Die Musik. Ankers waren dagewesen, er hatte ein reizendes Schwesternpaar kennengelernt, und er erinnert sich an Camilla, Bernhard und Emilie. Er hatte getanzt, bis er Blasen an den Füßen hatte und von der Tanzfläche hinken musste. Den ganzen Heimweg über hatte Halfdan ihn aufgezogen oder eigentlich nur versucht ihn aufzuziehen. Denn obwohl er ein wenig getrunken hatte, war es nicht schwer zu verstehen gewesen, dass Halfdan bloß neidisch war. Sein älterer Bruder hatte den ganzen Abend kaum getanzt, hatte bloß in einer Ecke herumgestanden und sich mit Welhaven, Schweigaard und Asbjørnsen angeregt unterhalten.
Die tief über dem Fjord stehende Dezembersonne blendet ihn. Aus dem Stockwerk unten hört er, dass Halfdan sich ans Klavier gesetzt hat. Das ist gut so.
Die Mutter hat sich wieder hingelegt, gleich nach dem Frühstück hat sie sich zurückgezogen. Nur den Pudel will sie in der Nähe haben, er war ein Geburtstagsgeschenk von Großvater Lasson. Dass der Vater Hunde nicht ausstehen kann, scheint den Wert des Tiers nur zu erhöhen.
Ein schwacher Zigarrenduft dringt aus der Bibliothek. Offenbar ein gutes Zeichen. Der Vater ist wohl nicht krank genug, um auf den Virginiatabak zu verzichten.
Im letzten Augenblick erscheint er bei den Richards. Den ganzen Nachmittag hindurch hat es geschneit, und Lasse hatte alle Hände voll zu tun, um den Hofplatz vom Schnee zu befreien und den Schlitten aus dem Wagenschuppen zu holen.
Alle Fenster sind erleuchtet. Lautes Lachen und Musik ertönen bis auf die Straße hinaus. Mit vorsichtigen Schritten erklimmt er die von brennenden Fackeln flankierte Treppe.
Zu Hause war es nicht auszuhalten. Er musste hinaus. Jetzt überkommen ihn plötzlich Zweifel. Vielleicht war es nicht richtig von ihm. Er nimmt den Lärm, die Wärme und die lebhafte Stimmung im Innern des Hauses wahr.
Sollte er vielleicht umkehren? Aber nein, schon hat Lasse die nördliche Ecke des Palais umrundet und verschwindet im angrenzenden Häuserviertel, noch kann Hjalmar die Schellen des Pferds hören, sie werden leiser und leiser. Er könnte nach Hause laufen. Auch wenn Minusgrade herrschen und er dünn angezogen ist, würde er nicht mehr als zwanzig Minuten benötigen, um nach Bakkehus zu kommen. Aber das steht jetzt nicht mehr zur Debatte, denn die Tür wird geöffnet, der Portier verbeugt sich und wünscht einen guten Abend.
»Ja, guten Abend.«
Er legt seinen Mantel über den steifen Arm, der ihm wie mechanisch entgegengestreckt wird.
In der Eingangshalle ist die Luft erfüllt von Rauch, Alkohol und warmen Körpern. Er blickt umher, sogleich bekommt er ein Tablett mit hohen, schwankenden Gläsern vors Gesicht gehalten, er nimmt sich eines und versucht, sich hinein in den Festsaal zu bewegen.
Es ist eng. Er drängt sich an weichen Kleidern mit großen Ausschnitten vorbei, an einem unförmigen Männerbauch, der ein wenig missslungen in eine etwas zu enge Militäruniform gezwängt ist, an strengen Atemgerüchen, schwerem Parfum und lautem Gelächter, das wie Gewehrsalven auf seine Ohren abgefeurt wird.
Jemand fasst nach seinem Arm. Eine feste kleine Hand hält ihn an der Jacke fest.
»Aber nein, Hjalmar, du bist hier?«
Es ist die Tochter der Richards, Anne Charlotte, die letztes Jahr auf dem Fest mit ihm getanzt hat. Jemand drängt sich an ihr vorbei und stößt ihre zarte Gestalt zu ihm hin, doch Anne Charlotte lächelt bloß und unternimmt nicht den geringsten Versuch, sich wieder zurückzuziehen, als sie die Möglichkeit dazu hat. Hjalmar lehnt sich ein winziges Stückchen zurück.
»Wie schön, dich zu sehen, Hjalmar! Das muss ja eine schreckliche Zeit für dich gewesen sein.«
Mit schräg gelegtem Kopf sieht sie ihn an, ihre Augen sind groß und blau und laufen geradezu über vor Mitgefühl. Er leert sein Weinglas zur Hälfte. Allerdings muss er gegenüber Anne Charlotte weder bestätigen noch vertiefen, wie die letzte Zeit gewesen ist, denn plötzlich zupft jemand an seinem linken Jackenärmel, und es ist niemand Geringerer als der alte Oberst Heinrich Dunker, der furchtbare Prahlhans mit den buschigen Augenbrauen.
Im Spätherbst war er zu Besuch in Bakkehus gewesen, es war eine Abendgesellschaft im Oktober. Hjalmar war die zweifelhafte Ehre widerfahren, neben dem Oberst sitzen zu dürfen, so musste es ja kommen. Der Vater ließ sich immer neue Methoden einfallen, um wenigstens den Hauch eines Interesses am Militär in ihm zu wecken. Ein ziemlich durchschaubarer Schachzug.
An jenem Herbstabend hörte er Oberst Dunker unter anderem erzählen, dass er 1769 geboren worden sei, im selben Jahr wie Napoleon, ja, ganze drei Mal wurde das voller Stolz wiederholt, in halbstündigen Abständen, und als Hjalmar dann ein weiteres Mal Halfdans Blick über den Tisch hinweg erhaschte, hatte er sich wirklich auf den Schinken auf seinem Teller konzentrieren müssen, um nicht in Lachen auszubrechen.
Jetzt steht Heinrich Dunker neben ihm und klopft ihm begeistert auf die Schulter. An die Augenbrauen kann Hjalmar sich gut erinnern. Und an die langen Nasenhaare, die zu kürzen sicherlich nicht schaden würde.
Erwähnt er Ida überhaupt? Nur ein paar kurze Bemerkungen wie ach und jaja.
Dann wechselt er das Thema. Denn von Hjalmars Vater weiß er von den Plänen, die Hjalmars Zukunft betreffen. »Faszinierend, Hjalmar. Faszinierend.« Hjalmar wird mit einem kameradschaftlichen Rippenstoß bedacht, denn bald ist er ja einer von ihnen.
Er leert sein Weinglas, während er dem Monolog des Obersten lauscht. Erneut spielt die Musik auf, jemand lacht laut, es klingt fast wie ein Schrei. Aber es ist nur eine der Frauen, die den Kopf kokett in den Nacken wirft und anscheinend versucht, die Aufmerksamkeit des großen Dunkelhaarigen zu wecken, der ein paar Meter weiter in der Mitte des Raums steht.
Die Lippen des Obersten bewegen sich, aber Hjalmar hört nicht, was er sagt. Hoffentlich ist es nichts über einen gewissen französischen General.
Er hält ein neues Glas in der Hand. Bestimmt wird gleich getanzt. Die Musik ist laut und rhythmisch.
Jemand streicht ihm über den Rücken, er dreht sich zu einer rothaarigen Frau um, die er zunächst nicht erkennt. Stampfende Tanzschritte erklingen, und sie beugt sich zu ihm, damit er sie verstehen kann.
»Du bist doch einer der Kjerulf-Brüder, nicht wahr? Hjalmar?«
Jetzt weiß er, wo er sie einordnen soll. Die tiefe Stimme kommt ihm bekannt vor. Sie war eine der Sängerinnen in dem Singspiel, das die Mutter im Sommer arrangiert hatte. Doch ja, es war im Sommer, gleich nachdem Halfdan nach Paris abgereist war. Er war ihr begegnet, als sie ihre Gesangsproben in Bakkehus abgehalten hatten. Ja, es stimmt, eine rothaarige Altistin, das muss sie sein.
»Du erinnerst dich doch an mich, oder?«, sagt sie lächelnd.
»Selbstverständlich.«
Er lacht. Wie gut sich das anfühlt. Während ihm der Wein langsam zu Kopf steigt, rasen die Gedanken durch sein Hirn, war sie nicht eine junge Witwe, Henrikke, Frederikke? Aber das ist wohl nicht so wichtig. Sein Glas ist leer, aber sie beugt sich zu ihm und reicht ihm ihres. Sie flüstert etwas, das er nicht ganz versteht, immerhin bekommt er die Gelegenheit, eine Sekunde lang ihre winterblassen, mit Sommersprossen übersäten Brüste zu betrachten.
Plötzlich werden sie von den Tanzenden mitgerissen, voller Schwung hinein in den Wirbel aus Gelächter, Schweiß und langen Blicken. Ihm wird schwindelig, doch er hält sich auf den Beinen und lässt sich einfach treiben.
Ihre Taille wirkt schmal unter dem grünen Stoff. Weshalb sieht sie ihn so an? Die Herren auf die eine, die Damen auf die andere Seite, in der Mitte trifft man sich wieder, schelmisch kneift sie ihn, bevor sie von ihm wegtanzt. Was will sie bloß?
Er fängt sie wieder ein, umfasst sie, vielleicht ein wenig zu roh, und dreht sie herum und herum. Ihm wird heiß, sie glüht geradezu.
Die Musik hört auf, sie lachen und ringen nach Atem. Sie entschuldigt sich für einen Moment, »aber geh nicht weg, Hjalmar«.
Warum sieht sie ihn auf diese Weise an? Mit zur Brust geneigtem Kopf blickt sie zu ihm auf, blinzelt und lächelt, versucht gar nicht erst zu verstecken, dass das hier eine Aufforderung ist. Soviel Erfahrung hat er seit dem letzten Jahr dazugewonnen. Er ist kein kleiner Junge mehr. Auf dem Weg hinaus dreht sie sich an der Tür noch einmal zu ihm um. Henrikke, oder war es Frederikke?
Er könnte ihr hinaus in die Vorhalle folgen, in einen der kalten Korridore, sich jäh auf sie stürzen und sie gegen eine Wand drücken, dunkle Ecken gibt es zur Genüge. Denn das wollte sie doch wohl? Ihre Schenkel würden sich unter seinen Händen ganz heiß anfühlen, und wenn sie protestierte, würde er es ignorieren, denn ein Nein könnte ebenso gut Zustimmung signalisieren, Frauen sagen oft das genaue Gegenteil von dem, was sie meinen.
Aber er hat Durst, und der Fußboden scheint zu schwanken. Er wischt sich mit dem Taschentuch über die Stirn und blickt ihr nach, während sie im Gang nach draußen verschwindet. Plötzlich wird alles so unscharf.
Im Festsaal herrscht wieder dichtes Gedränge. Warum öffnet denn niemand ein Fenster? Er streckt sich, um einen besseren Überblick zu bekommen.
In diesem Augenblick sieht er sie, ein ganzes Stück entfernt. Ihren Hinterkopf. Das dunkle Haar, den Zopfknoten, die Locken und den schmalen Hals. Und das Kleid, das elfenbeinfarbene mit der hohen Taille und den Samtbändern, zu ihrem achtzehnten Geburtstag hat sie es bekommen. Aber ja doch, es ist ihr Profil, als sie sich zur Seite dreht, erkennt er es.
Er versucht zu rufen, natürlich hört sie ihn nicht. Auch kein anderer. Er kämpft sich vorwärts, hinein in das groteske Inferno aus dampfenden Körpern und gellendem Lachen, er ruft abermals, verliert sie nicht aus den Augen, hält sie mit dem Blick gefangen, so lange es nur geht, tritt jemandem auf den Fuß. Stößt an einen Ellbogen, sodass der Wein aus dem Glas schwappt. Aber darauf kann er keine Rücksicht nehmen.
»Entschuldigung, tut mir leid, ich muss vorbei. Ich bitte um Verzeihung.«
Und dann fasst er ihren Arm und brüllt ihren Namen, während er sie gleichzeitig mit aller Macht zu sich herumreißt, ja, da erregt er einige Aufmerksamkeit, jedenfalls bei denen, die in unmittelbarer Nähe stehen.
Die Musik hört abrupt auf, aber das ist vielleicht nur ein Zufall. Es wird gemurmelt und geflüstert. Was hat er da gesagt? Ida? Wer ist er überhaupt? Er registriert das alles, ist aber völlig verwirrt. Natürlich ist das nicht Ida. Sie kann es ja nicht sein.
Ida ist tot.
Ein Skandal wird wohl nicht daraus werden. Dazu ist der Abend zu weit fortgeschritten. Viele Anwesende kennen ihn und wissen, was die Familie in letzter Zeit durchgemacht hat.
Er ist nüchtern genug, um die Blicke zu bemerken, während er eilig hinauszukommen versucht. Nachdem der Portier seinen Mantel herausgesucht hat, stolpert er nach draußen. Fast rutscht er auf der obersten Stufe aus, kann sich jedoch am schmiedeeisernen Geländer festhalten, während er die glatten, unpraktischen Ledersohlen verflucht.
Als er an der nächsten Ecke abbiegt, verflüchtigt sich der Lärm aus dem Hause Richards, er hört nur noch seine eiligen Schritte und die keuchenden Atemzüge.
Die Nacht ist sternenklar. Noch immer ist er durcheinander, ihm ist heiß, er eilt die Straße hinunter, läuft schneller, gerät ins Rutschen, kann das Gleichgewicht aber halten.
Auf dem Stortorg sind die Laternen angezündet, die übrige Stadt ist dunkel, alle Fenster sind schwarze leere Flächen. Er begegnet keinem Menschen, nicht einmal einem Nachtwächter. In Christiania sind alle Kerzen ausgeblasen, alle Petroleumlampen gelöscht, und in den Öfen ist das Feuer schon längst ausgegangen. Wie sollte es auch anders sein, wer wäre jetzt gern unterwegs, so spät, in dieser Kälte? Jeder Mensch mit ein wenig Verstand, ob groß oder klein, liegt jetzt schon längst unter Decken und Pelzen, die Nachtmützen über die Ohren gezogen und, wenn möglich, dicht aneinander geschmiegt.
Er läuft auf die Kirche zu. Die Kälte beißt in seine Wangen, seine Augen tränen. Warum hat er auch keine Mütze mitgenommen?
Die kleine Mauer um den Kirchhof liegt unter Schnee begraben, niemand hat ihn weggefegt. Weder der Weg noch das Tor sind zu sehen. Soll er einfach über die Mauer springen? Die hohen Schneewälle dahinter sehen nicht eben einladend aus. Doch dann erhellt der Mond den ganzen Friedhof, und dort, ein Stückchen weiter, ist das Eingangstor. Er stapft die letzten Meter durch den Schnee.
Das Tor ist mit einer Kette verschlossen, die um einen der Pfosten gelegt ist, und als er sie anfasst, merkt er, wie kalt seine Hände sind. Er muss heftig an der Kette rütteln, sie ist beinahe festgefroren.
Die Gräber liegen teilweise unter dem Schnee verborgen. Bis zu den Waden versinkt er und kämpft sich an den Grabreihen vorbei. Er muss hinüber auf die andere Friedhofsseite, und der schnellste Weg dorthin führt an dem kleinen Hain entlang. Er kommt vom Weg ab, stolpert beinahe, als er den Fuß auf etwas Hartes setzt, Teufel, was war das, es muss ein kleiner, unauffälliger Grabstein gewesen sein, der anscheinend gänzlich vom Schnee verdeckt wurde. Man stelle sich vor, hier zu liegen, tot und begraben, dann verschwindet sogar der Stein, und als ob das nicht genug wäre, kommt auch noch so ein gefühlloser Idiot angelaufen und stolpert darüber.
Als er an dem kleinen Hain vorbeikommt, verschwindet der Mond hinter einer Wolke, mit einem Mal ist alles dunkler.
Er zuckt zusammen. Hat er etwas gehört? Eine plötzliche Bewegung am Rande des Sichtfelds lässt ihn erschrocken zur Seite springen.
Erleichtert atmet er auf und schämt sich für seine Dummheit. Es war doch nur Schnee, der von einem Ast herabfiel.
Schließlich steht er vor Idas Grab.
Da bemerkt er die Fußspuren im Schnee. Von jemandem mit größeren Füßen als seinen. Von jemandem, der auch der Kälte getrotzt hat. Von jemandem, der heute Abend ebenfalls hier herkommen musste, so wie er selbst. Und Hjalmar weiß, wer das ist. Welhaven muss hier gewesen sein.