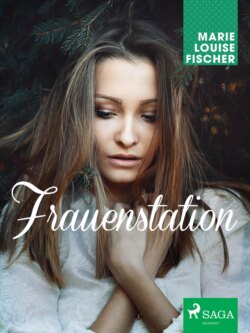Читать книгу Frauenstation - Marie Louise Fischer - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеAls die erste Wehe kam, hielt Susanne Overhoff unwillkürlich den Atem an. Aber sie empfand keine Angst, eher ein schmerzvolles Gefühl von Glück.
Es war also soweit. Alles Warten würde nun bald ein Ende haben.
Susanne Overhoff ließ das Babyjäckchen, an dem sie häkelte, in den Schoß sinken. Ihr Blick ging zu Eva, ihrer Tochter, die bäuchlings auf der Couch lag.
»Eva …«, sagte sie; »ich …« Ihr Mund war trocken. Es fiel ihr schwer, die richtigen Worte zu finden.
»Ja, Mutter?« Das junge Mädchen hob den Kopf und strich das weizenblonde Haar aus der Stirn.
»Ich glaube, es wird Zeit für mich, Eva.«
Eva setzte sich mit einem Ruck auf. »Schon?« fragte sie, nun doch erschrocken. Mit zwei Schritten war sie bei der Mutter, kniete neben dem Sessel. Susanne Overhoff fuhr ihr mit der Hand in das schimmernde Haar.
»Du weißt doch, daß ich bereits seit Tagen darauf warte.«
»Ja schon«, sagte Eva leise, »aber wenn es dann passiert, ist es doch anders.«
Susanne Overhoff beugte sich rasch zu ihr herab und küßte sie auf die Stirn. »Geh hinauf ins Schlafzimmer und hol mein Köfferchen. Ich werde es Vater sagen …«
Die zweite Wehe kam, als sie schon neben ihrem Mann, dem Chefarzt Dr. Paul Overhoff, im Wagen saß.
»Sehr schlimm?« fragte er, ohne sie anzusehen. Er glaubte, ihren Schmerz fast körperlich mitzuempfinden. Und wieder überkam ihn dieses würgende Schuldgefühl, diese quälende Angst, die ihm die letzten Monate fast zur Hölle gemacht hatte.
»Nein, nicht schlimm«, erwiderte Susanne Overhoff rasch, fast ein wenig zu schnell.
»Du brauchst keine Angst zu haben«, sagte er gepreßt.
»Ich fürchte mich nicht …«
Er schaltete so hart, daß das Getriebe aufstöhnte, dann glitt der schwere Wagen die stille Vorortstraße entlang.
»Mir ist nur«, sagte sie, die Hände wie schützend über dem hohen Leib gefaltet, »als hätte ich etwas vergessen …«
»Unwichtig. Alles, was du brauchst, kann ich dir besorgen lassen.«
»Das meine ich nicht, ich …« Sie sprach sehr langsam, um sich verständlich auszudrücken. »Es ist wegen Eva. Sie ist noch so jung. Sie versteht das alles nicht. Ich hätte ihr klarmachen müssen … es wenigstens versuchen müssen …«
»Mach dir nicht so viele Gedanken, Susanne«, erwiderte er mit einer Stimme, die unbefangen klingen sollte, aber rauh vor Beklemmung war, »morgen wird sie dich in der Klinik besuchen. Dann kannst du ihr alles erzählen, was du noch auf dem Herzen hast.«
›Hoffentlich‹, hätte sie beinahe gesagt, aber sie sagte nur: »Ja, natürlich. Du hast recht.«
Vom Haus Professor Overhoffs bis zur Frauenklinik, deren Chef er war, waren es knappe zehn Aütominuten.
Als die dritte Wehe einsetzte, lag Susanne Overhoff im Bett des schönsten Zimmers der Privatstation, das seit Tagen für sie reserviert war.
Oberschwester Helga half ihr, sich auszuziehen. Dann stand sie am Bett der werdenden Mutter und lächelte ihr aufmunternd zu. Ihr frisches Gesicht strahlte Zuversicht aus.
»Das scheint ein sehr pünktlicher kleiner Sohn zu werden, Frau Professor«, meinte sie ermutigend.
Susanne Overhoff nickte stumm. In ihren Augen war ein seltsamer Glanz.
Die junge Schwester Lilo war noch dabei, Susannes Kleid und den Pelzmantel sorgfältig auf den Bügel und in den Schrank zu hängen. Vom Bad her hörte man das Plätschern des Wassers; Professor Overhoff wusch sich die Hände. Er kam, sich abtrocknend, in das Zimmer und ließ das Handtuch achtlos fallen. Lilo bückte sich, hob es auf, half ihm in den weißen Kittel.
»Benachrichtigen Sie bitte sofort Dr. Schumann«, ordnete er an.
Schwester Lilo huschte aus dem Zimmer.
Susanne Overhoff richtete sich in ihrem Kissen auf.
»Paul«, rief sie flehend.
Er trat zu ihr und versuchte zu lächeln, aber es wurde nur eine Grimasse. »Ja?«
»Paul … kannst du die Schnittentbindung nicht selbst machen? Du weißt doch … es gibt niemanden, zu dem ich so viel Vertrauen habe wie zu dir!«
»Susanne, es ist nicht üblich, daß ein Arzt seine eigene Frau entbindet!«
»Das weiß ich ja! Aber mach eine Ausnahme! Ich bitte dich darum!«
Er setzte sich zu ihr auf den Bettrand. »Ich könnte es nicht. Selbst wenn ich wollte.« Er hielt den Arm hoch, und sie sah, wie seine flach ausgestreckte Hand zitterte.
Sie bereute es sofort, daß sie ihn gezwungen hatte, seine Schwäche zu bekennen. »Verzeih«, murmelte sie.
Oberschwester Helga, stumme Zeugin dieser Szene, versuchte die Situation zu überspielen. »Dr. Schumann ist ein wunderbarer Arzt«, sagte sie, »der beste, den ich kenne!«
Overhoff streichelte die Hand seiner Frau. »Da hörst du es selber, Liebling!«
»Entschuldigen Sie, Herr Professor«, rief die Oberschwester erschrocken, »ich wollte natürlich nicht sagen, daß …«
»Schon gut! Geben Sie mir das Stethoskop!«
Sie reichte ihm das Hörrohr. Er faßte mit der linken Hand Susannes Puls und beugte sich tief über ihren Leib, um die Herztöne seines Kindes abzuhören.
Frau Astrid Schumann hatte für diesen Abend Gäste geladen. Im offenen Kamin züngelten die Flammen eines hellen Feuers; auf silbernen Leuchtern brannten honiggelbe Kerzen.
Dr. Rainer Schumann beobachtete seine Frau. Sehr schlank und anmutig, in einem saphirblauen Cocktailkleid aus fließender Seide, stand sie zwischen den Gästen. Er sah das Leuchten ihrer tiefblauen Augen und die rötlichen Lichter, die die Flammen in ihr kurz geschnittenes, kastanienbraunes Haar zauberten. Er beobachtete die bewundernden Blicke der anderen Männer und – litt.
Dabei wußte er, daß er keinen Grund zur Eifersucht hatte. Astrids Herz war kühl, so kühl wie ihre zarte, milchweiße Haut. Sie liebte ihn, dessen war er ganz sicher. Sie liebte ihn auf ihre kühle, sehr beherrschte Art, und es war sein Pech, daß ihm diese Liebe nicht genügte, daß sie ihn tief unsicher, ja oft rasend machte.
Dr. Rainer Schumann schrak zusammen, als er sich angesprochen fühlte. Mit einer hastigen Bewegung nahm er die Pfeife aus dem Mund und ließ sie in der Jackentasche seines gut geschnittenen dunklen Anzugs verschwinden. Er drehte sich um und sah Kirsten, seine junge Schwägerin. Er lächelte sie freundlich aus seinen dunkelbraunen Augen an, die ihm unter den Schwestern der Frauenklinik den Beinamen ›der Bernhardiner‹ eingetragen hatten.
»Sei mir bitte nicht böse«, sagte Kirsten; »ich verstehe natürlich sehr gut, daß du in diesem Augenblick keine allzu große Lust zu einem fachlichen Gespräch hast …«
»Immer noch der gleiche Kummer?«
Kirstens Augen wurden dunkel. »Du weißt, wie sehr ich … wie sehr Hugo und ich uns ein Kind wünschen …«
»Ich habe dir schon vor einem Jahr den Vorschlag gemacht, einmal in meine Sprechstunde zu kommen. Oder wenn dir das peinlich ist, dann geh zu Professor Overhoff … ich bin sicher, daß er dir helfen wird.«
»Ja, vielleicht«, erwiderte Kirsten zögernd; »nur … ich bin doch eine ganz gesunde und normale Frau. Ich weiß, daß ich das bin. Und mit Hugo ist auch alles in Ordnung. Da müßte es eigentlich ohne ärztliche Hilfe möglich sein …«
In diesem Augenblick schrillte das Telefon.
Dr. Schumann war sofort alarmiert. Er legte seine Hand auf Kirstens Arm.
»Entschuldige mich, bitte«, rief er hastig und ging mit großen Schritten in seinen Arbeitsraum hinüber, nahm den Hörer, lauschte wenige Sekunden, sagte: »Ich komme sofort!« und hängte ein.
Einen Augenblick blieb er am Schreibtisch stehen und überlegte, ob es richtig wäre, sich von Astrid zu verabschieden. Vielleicht würde sie es als eine Störung ihrer Party auffassen. Bevor er einen Entschluß gefaßt hatte, kam Astrid lautlos ins Zimmer. »Du mußt fort?« fragte sie beherrscht.
»Leider. Aber wenn alles gut geht, bin ich in einer knappen Stunde wieder zurück.«
»Susanne Overhoff?«
»Ja.«
Ihm schien es, als würden ihre Lippen schmal.
»Astrid, ich …«
»Mir brauchst du nichts zu erklären. Geh!« Ihre Stimme hatte einen gereizten, ja feindlichen Ton, der ihn aus der Fassung brachte.
»Aber Astrid«, stammelte er hilflos und wollte ihr einen flüchtigen Kuß geben, doch sie wandte sich so brüsk ab, daß seine Lippen nur ihr Haar berührten. Eine Sekunde stand er wie erstarrt. Dann holte er tief Atem, straffte die Schultern und verließ mit energischen Schritten den Raum. Weder er noch Astrid hatten bemerkt, daß Kirsten hereingekommen war.
»Na hör mal«, sagte Kirsten jetzt, »so solltest du Rainer wirklich nicht behandeln!«
Astrid drehte sich langsam zu ihrer Schwester um.
»Was verstehst du schon davon!«
»Ich weiß, daß Rainer dich liebt und …« Sie unterbrach sich. »Du kannst ihm doch nicht im Ernst böse sein, weil er in die Klinik gerufen worden ist? Schließlich ist er Arzt, und du hättest damit rechnen müssen, als du ihn heiratetest!«
»Weißt du auch, wohin er geht?«
Kirsten sah sie verständnislos an. »In die Klinik natürlich!«
»Zu Susanne Overhoff!«
»Na und?«
»Sie erwartet ihr drittes Kind …«
»Die Glückliche!«
»Wenn du ein bißchen gescheiter wärest, würdest du nicht so sprechen.«
»Ich verstehe nicht …«
Astrid nahm mit einer nervösen Bewegung eine Zigarette aus der kleinen Zinndose auf dem Schreibtisch, steckte sie zwischen die Lippen, zündete sie an und inhalierte mit einem tiefen Zug, bevor sie weitersprach. »Wenn es dich wirklich interessiert, werde ich es dir erklären …«
»Bitte …«
»Susanne Overhoff hat eine sechzehnjährige Tochter. Der einzige Sohn ist vor drei Jahren verunglückt …«
»Wie schrecklich!«
»Hör nur erst weiter!« Astrid machte wieder einen Lungenzug. »Beide Kinder sind durch Kaiserschnitt zur Welt gekommen … Susannes Becken ist zu schmal, verstehst du?«
»Ja, aber …«
»Jeder Arzt wird dir bestätigen, daß ein dritter Kaiserschnitt bei schwächlicher Konstitution der Mutter lebensgefährlich sein kann.«
»Aber … das muß der Professor doch wissen! Und Rainer auch!«
»Natürlich wissen sie es. Und gerade weil sie es wissen und trotzdem nicht verhindert haben, sind sie … in meinen Augen wenigstens … Verbrecher.«
»Astrid!« rief Kirsten entsetzt.
»Entschuldige. Aber ich dachte, du wolltest die Wahrheit hören!« Astrid drückte ihre Zigarette aus.
»Wie hätte Rainer es denn verhindern können? Nun nimm mal Vernunft an. Schließlich ist er nicht der Chef, und auch nicht der Vater des Kindes. Und überhaupt … was sagt denn Frau Overhoff dazu? Weiß sie, wie gefährlich es ist?«
»Natürlich. Sie ist doch eine Arztfrau.«
»Dann hätte sie ihren Mann bitten können …«
»Sie will es haben«, sagte Astrid bitter, »sie ist streng gläubig, und dann … sie hat es sich in den Kopf gesetzt, ihrem Mann einen Sohn zu schenken.«
Kirsten schwieg einen Atemzug lang. »Sei mir nicht böse, Astrid«, sagte sie dann, »aber ich glaube … ich kann das verstehen.«
»Ja, du! Weil du den Wert einer Frau nur darin siehst, ob sie Kinder haben kann oder nicht … ob sie sie in die Welt setzen will oder nicht. Aber begreifst du denn nicht, daß das heller Wahnsinn ist? Eine Frau ist doch eine Persönlichkeit, ihr Leben hat einen Wert, eine Bedeutung, die ganz unabhängig von dieser Frage ist …«
»Ja, vielleicht«, sagte Kirsten, nicht überzeugt.
»Oder glaubst du, daß Hugo dich nicht liebt, nur weil ihr keine Kinder miteinander habt?«
»Er würde mich mehr lieben, wenn ich ihm eins schenken könnte.«
»Bist du dessen so sicher? Dann solltest du ihn stehenlassen … dann ist es nämlich nicht die wahre Liebe, dann sieht auch er in dir nur die Gebärmaschine, die …«
»Nein, Astrid, nein, so ist das nicht«, unterbrach Kirsten sie mit unerwarteter Energie. »Er liebt mich schon, aber er möchte eine Familie haben … jeder Mann möchte eine Familie haben. Söhne, Töchter.« Sie schluckte. »Und ich würde ihm diesen Wunsch erfüllen, wenn ich es könnte. Auch wenn ich mein Leben dafür aufs Spiel setzen müßte.«
»Du bist ja verrückt«, sagte Astrid angewidert. Sie wandte sich zur Tür.
Kirsten lief ihr nach. »Glaubst du wirklich, Frau Overhoff muß sterben?«
»Davon habe ich nichts gesagt. Nur daß bei ihr ein dritter Kaiserschnitt lebensgefährlich sein kann.«
»Aber dann …«
»Das ändert gar nichts. Auch wenn sie durchkommt … und ich wünsche es ihr, bei Gott … bleibt diese Geburt ein verbrecherischer und ungeheuerlicher Wahnsinn!«
Auch Dr. Rainer Schumann dachte, während er am Pförtner der Klinik vorbeieilte und die Treppen hinauflief – der Aufzug war nicht unten gewesen, und er war viel zu ungeduldig, um auf ihn warten zu können –, mit Sorge an die bevorstehende Operation. Aber er sah den Fall mit ganz anderen Augen. Nicht einen Augenblick lang dachte er daran, ob es richtig oder falsch war, daß Susanne Overhoff dieses dritte Kind haben wollte, oder ob der Professor es vielleicht nicht dazu hätte kommen lassen sollen – für ihn war Susanne Overhoff eine werdende Mutter, die seine Hilfe brauchte, nichts weiter. Eine Patientin, so wichtig wie jede andere, obwohl ihr Fall natürlich besonders kompliziert lag. Er hatte es ja immer nur mit den schwierigen Fällen zu tun, denn bei den komplikationslosen Geburten genügte die Hilfe einer Hebamme.
Er atmete tief, der Geruch der Klinik war um ihn – dieses vertraute Gemisch aus menschlichen Ausdünstungen, scharfen Desinfektionsmitteln und Bohnerwachs. Die Frauenklinik war seine Welt, hier gehörte er hin, hier fühlte er sich wohl.
In seinem Sprechzimmer im ersten Stock zog er seine Jacke aus, wusch sich die Hände, schlüpfte in seinen Kittel und knöpfte ihn zu, während er schon wieder weiterlief. Als er an der Teeküche auf der Privatstation des Professors vorbeistürmte, kam Oberschwester Helga heraus.
»Guten Abend, Herr Oberarzt! Das ist aber schnell gegangen!«
»Hatten Sie etwas anderes von mir erwartet?« erwiderte er und konnte der Versuchung nicht widerstehen, sie leicht in die feste, wohlgerundete Wange zu kneifen.
Sie nahm es ihm nicht übel. »Der Herr Professor erwartet Sie schon«, sagte sie und begleitete ihn den Gang hinunter.
»Wie steht’s?«
»Die ersten Wehen. Im Abstand von 30 Minuten.«
»Sehr schön. Lassen Sie die Sectio vorbereiten. Je eher wir es hinter uns haben, desto besser. Wer hat Nachtdienst?«
»Dr. Bley.«
»Rufen Sie ihn an. Und lassen Sie nachschauen, ob Dr. Gerber im Haus ist. Ich brauche ihn und den Anästhesisten. Wenn nötig, holen Sie die beiden per Funk herbei, ja?«
»Wird gemacht.«
»Ich weiß, daß ich mich auf Sie verlassen kann, Helga.«
Dr. Schumann blieb vor dem Eckzimmer auf der Privatstation stehen, in dem Susanne Overhoff lag. »Sagen Sie bitte Bescheid, wenn wir anfangen können.«
»Ja, Herr Doktor!« Eine Sekunde lang blieb die Oberschwester vor Dr. Schumann stehen, als ob sie noch etwas sagen wollte. Dann besann sie sich, drehte sich um und lief davon.
Dr. Schumann klopfte an die Tür. Als keine Antwort kam, drückte er die Klinke nieder und trat ein. Susanne Overhoff sah ihm aus übergroßen, glänzenden Augen entgegen. Der Professor stand über ihren Leib gebeugt und horchte die Herztöne des Kindes ab.
Dr. Schumann trat an das Bett der Patientin. »Guten Abend, Frau Professor«, sagte er. »Froh, daß es endlich soweit ist?«
»Ja, sehr!« erwiderte sie, tapfer lächelnd.
Professor Overhoff richtete sich auf. Sein Gesicht war von Sorge und Angst so entstellt, daß Dr. Schumann erschrak. Er reichte seinem Oberarzt das Stethoskop.
»Gut, daß Sie da sind«, sagte er mühsam.
»Ist irgend etwas nicht in Ordnung?« fragte Susanne Overhoff beunruhigt.
Der Professor antwortete nicht, trat an das Fenster. Sein Rücken zuckte.
»Sie dürfen sich nicht nervös machen lassen, Frau Professor«, meinte Dr. Schumann, »werdende Väter sind ein Kapitel für sich. Unsere Hebammen sagen immer: Lieber drei schwere Geburten hintereinander, als einem aufgeregten Vater Mut zusprechen müssen.«
Susanne Overhoff lachte gequält, ein kleines zitterndes Lachen.
Er setzte sich an den Rand ihres Bettes, umfaßte ihr Handgelenk, beugte sich über ihren Leib, prüfte die Herztöne des Kindes und zählte sie sorgfältig aus.
94 in der Minute. Das war sehr wenig. 120 bis 140 wären normal gewesen. Er wiederholte die Untersuchung, um sich zu vergewissern, aber das Ergebnis blieb unverändert. Mit keinem Wimpernzucken zeigte er sein Erschrecken.
Er drückte mit den Seitenkanten seiner Hände in ihren Leib. Der Uterus saß sehr hoch, berührte den Rippenbogen. Er legte die eine Hand flach an die seitliche Bauchwand, ertastete den Rücken des Kindes, erfühlte mit der anderen Hand die gegenüberliegenden Arme und Beine. Dann drückte er mit der rechten Hand, den Daumen ahgespreizt, auf den Unterleib. Sehr behutsam, um der Patientin nicht weh zu tun, tastete er tiefer, spürte die feste runde Form des kindlichen Kopfes, der gerade erst in den Beckeneingang eingetreten war.
Oberschwester Helga kam ins Zimmer. »Der OP ist vorbereitet, Herr Oberarzt«, meldete sie ein wenig atemlos; »Dr. Gerber war im Haus, nur Dr. Leopold, der Anästhesist … aber er ist benachrichtigt und wird spätestens in zehn Minuten hier sein.«
»Bringen Sie die Sauerstoff-Flasche«, sagte Dr. Schumann ruhig. »Und schickem Sie mir eine Schwester, die mir hilft, das Becken der Patientin hochzulagern.«
»Ist irgend etwas nicht in Ordnung?« fragte Susanne Overhoff noch mal angstvoll.
»Kein Grund zur Aufregung«, sagte Dr. Schumann beruhigend, »die kindlichen Herztöne sind etwas langsam …«
Zu langsam? Ja, aber das bedeutet doch …«
Professor Overhoff wandte sich vom Fenster ab, trat ans Bett seiner Frau. »Bitte«, sagte er beschwörend, »bitte, Liebling …«
»Du hast es gewußt? Paul, unser Kind darf nicht sterben, hörst du! Du mußt es retten, sonst …« Eine neue Wehe überfiel sie, sie konnte nur mühsam weitersprechen. »Sonst war alles umsonst.«
»Das Kind wird leben«, erklärte Dr. Schumann mit Nachdruck, »ich verspreche es Ihnen!«
Frau Overhoff verkrampfte die Hände über der Brust. »Und ich habe so gebetet«, sagte sie fast tonlos, »so sehr gebetet …«
»Es ist meine Schuld!« Auf Professor Overhoffs Stirn stand kalter Schweiß. »Ich hätte dir das nicht antun dürfen. Es war … unverantwortlich.«
»Aber wir haben es uns doch beide gewünscht, nicht wahr? Wir beide, Paul … hast du das denn vergessen?« Tief erregt schluchzte sie auf.
»Bitte, gnädige Frau … Herr Professor! Bitte!« sagte Dr. Schumann. »Jede Aufregung kann dem Kind schaden. Sie müssen sich entspannen, Frau Professor … ganz tief und langsam atmen. Mit dem Bauch. So, wie Sie es in der Gymnastik gelernt haben … ja, so ist es richtig!«
Oberschwester Helga kam ins Krankenzimmer. Sie brachte die Sauerstoff-Flasche und die Gesichtsmaske. Zwei jüngere Schwestern folgten ihr und machten sich auf einen Wink Dr. Schumanns daran, das Becken Susanne Overhoffs hochzulagern.
Dr. Schumann legte die Maske über Mund und Nase der Patientin. »Weiter tief durchatmen«, beschwor er sie. »Denken Sie immer an Ihr Kindchen! Es braucht Luft!«
»Dr. Leopold ist gekommen«, flüsterte Oberschwester Helga; »er ist gleich in den Waschraum gegangen.«
Dr. Schumann nickte nur. Er beugte sich erneut tief über den Leib, lauschte auf die Herztöne des ungeborenen Kindes, minutenlang.
Als er sich aufrichtete, begegnete er dem verzweifelt fragenden Blick Professor Overhoffs, schüttelte stumm den Kopf.
Laut sagte er: »Es geht schon wesentlich besser … atmen Sie weiter schön durch, gnädige Frau. Ich werde auf alle Fälle unsere Kollegin, Frau Dr. Holger, benachrichtigen, damit Ihr Kindchen sofort sachgemäß betreut wird. Ihr Gatte bleibt bei Ihnen.«
Er ging rasch zur Tür und war froh, daß Professor Overhoff ihm nicht folgte.
Tatsächlich hatten sich die kindlichen Herztöne noch weiter verlangsamt, ihr sonst gleichmäßiger Rhythmus war jetzt sogar zeitweilig unterbrochen. Die Herztöne stolperten. Das Leben des Kindes schwebte in höchster Gefahr.
Zehn Minuten später lag Susanne Overhoff im kalten, sehr hellen Licht der OP-Lampe auf dem Operationstisch.
Ihr Mann hatte sie nicht bis hierher begleitet. Ihr war es recht so. Er schien ihr plötzlich auf seltsame Art aus der Mitte ihres Lebens verschwunden. Susanne Overhoff war bei vollem Bewußtsein. Sie gab sich weiter Mühe, so tief wie möglich zu atmen – ihr ganzes Fühlen, ihr Denken, ihr heißer Wunsch galt nur dem Leben ihres noch ungeborenen Kindes.
Sie zuckte nicht einmal zusammen, als Dr. Leopold, der Anästhesist, ihr die erste Spritze gab. Ihre Lippen bewegten sich unaufhörlich im stummen Gebet.
Dr. Leopold legte die Infusionsnadel an die Vene ihres rechten Armes. Die Nadel war durch einen Schlauch mit einem erhöhten gläsernen Behälter mit Blutersatz verbunden, dem Dr. Leopold jederzeit intravenöse Narkosemittel beigeben konnte.
Aber noch war es nicht soweit. Um des Kindes willen durfte die Patientin erst in letzter Minute narkotisiert werden.
Das letzte, was Susanne Overhoff sah, waren die Ärzte, drei grün vermummte Gestalten, die in den Operationssaal traten. Sie fühlte, wie ihr Leib mit einer leicht brennenden Lösung abgewaschen wurde. Sie wurde behutsam mit Tüchern abgedeckt, sah nur noch einen grünen Himmel über sich. Eine jähe, unbeschreibliche Angst überfiel ihr Herz.
Dann wich die Angst, eine wohltuende, lähmende Müdigkeit überkam sie. Sie schloß die Augen. Sekunden später war sie eingeschlafen.
Df. Leopold öffnete ihren Mund, fand mit Hilfe des Laryngoskops den Eingang zur Luftröhre, schob den Trachealkatheter durch die erschlafften Stimmbänder sehr vorsichtig vor und preßte ihn dann von außen, indem er einen Gummiball aufblies, so gegen die Wände der Luftröhre, daß ein Verschieben oder Verrutschen unmöglich war. Das andere Ende des Katheters verband er über ein Ventil mit dem gasführenden Schlauch des Narkoseapparates.
»Anfangen!«
Dr. Schumann hatte nur auf dieses Wort gewartet. Ohne den Blick von der Patientin zu lassen, streckte er die Hände aus. Selma, eine zuverlässige ältere Operationsschwester, reichte ihm das Skalpell.
Im gleichen Augenblick nahm Edith, eine jüngere OP-Schwester, eine Pinzette von dem grünen, sterilen Tuch, das den Instrumententisch bedeckte, und gab sie Dr. Gerber.
Dr. Bley stand zwischen den Beinen der Patientin und hielt die Hauthaken bereit.
Mit sicherer Hand tat Dr. Schumann den ersten Schnitt. Dr. Bley setzte die Hauthaken. Dann durchtrennte Dr. Schumann mit einem zweiten Schnitt das Fettgewebe.
Dr. Gerber, sein erster Assistent, beobachtete aufmerksam jeden Handgriff, wußte schon im voraus, was der Operateur tun und wo er gegenhalten mußte. Frau Dr. Irene Holger war zwei Schritte zurückgetreten, um ihre Kollegen bei der Arbeit nicht zu stören. Sie hob sich auf die Zehenspitzen, um die Operation genau verfolgen zu können.
Mit einem glatten Längsschnitt durchtrennte Dr. Schumann jetzt die Muskulatur. Dr. Bley setzte die Hauthaken neu. Der Chirurg spaltete die Bauchfellfalte.
Eine der OP-Schwestern reichte sterile warme Tücher, mit denen Dr. Schumann und Dr. Gerber die freigelegten Därme abdeckten und vorsichtig beiseite schoben.
Selma hatte dem Operateur Pinzette und Skalpell abgenommen und gab ihm jetzt ein noch feineres Skalpell. Dr. Schumann machte einen kleinen Querschnitt durch den unteren Bereich des Uterus und erweiterte den Schnitt vorsichtig mit dem Finger. Dann faßte er mit der rechten Hand behutsam in die Öffnung und versuchte mit der linken das obere Ende des Uterus gegenzuhalten. Da die Geburt noch nicht weit fortgeschritten war, gelang es ihm ohne Mühe, den kindlichen Kopf aus dem Eingang des Beckens zu stemmen. Vom Uterusfundus aus unterstützte ihn Dr. Gerber durch sanften Druck von oben. In Sekundenschnelle war das Kind entwickelt. Es hatte die Nabelschnur, die nur noch schwach pulsierte, zweimal um den Hals geschlungen.
Unwillkürlich blickte der Anästhesist auf die große Wanduhr. Genau drei und eine halbe Minute hatte die Operation bis jetzt gedauert. Drei und eine halbe Minute hatten vier Ärzte und zwei Schwestern stumm und verbissen um das Leben einer Mutter und ihres Kindes gekämpft.
Dr. Schumann klemmte die Nabelschnur zweimal und durchschnitt sie. Das Kind schrie nicht. Es hing leblos in seiner Hand, blau, der Erstickung nahe, mit schlaffen Gliedmaßen. Die Hebamme nahm es entgegen, hüllte es in ein warmes Tuch und übergab es Frau Dr. Holger. Die Ärztin trug das Neugeborene in den Nebenraum, die Hebamme folgte ihr. Dr. Schumann stand über den offenen Leib der Patientin gebeugt und löste mit äußerster Vorsicht die Plazenta.
»Blutdruck 110«, meldete der Anästhesist, „Kreislauf und Atmung in Ordnung!«
Plötzlich – Dr. Schumann hatte die Plazenta schon herausgelöst – schoß aus einem fingerdicken Gefäß Blut in die Bauchhöhle.
»Klemme!« schrie er.
Seine Finger tasteten in die Wunde, kalter Schweiß trat ihm auf die Stirn. Jeder im Operationssaal hielt unwillkürlich den Atem an.
Dann hatte er das Gefäß erfaßt, klemmte es ab. Die Blutung stand.
Der Puls der Patientin war schwach geworden. Der Anästhesist transfundierte die Blutkonserve, die er vorsorglich vom Labor hatte austesten lassen und in Bereitschaft hielt. Schwester Selma reichte die runde Nadel, Dr. Schumann vernähte die Uterusmuskulatur. Darüber legte er eine Naht an, wobei er einen Teil des Gewebes einstülpte.
Dr. Gerber nahm die eingelegten Tücher aus der Bauchhöhle. Jetzt konnte Dr. Schumann beginnen, das Bauchfell zu vernähen. Er atmete tief auf unter dem beklemmenden Mundschutz.
»Puls und Blutdruck fast normal«, meldete Dr. Leopold. Das Schlimmste war überstanden. Nach menschlichem Ermessen würde Susanne Overhoff durchkommen. Aber was war mit ihrem Kind? Diesem Kind, für das sie ihr Leben ganz bewußt und freiwillig aufs Spiel gesetzt hatte?
Frau Dr. Holger hatte das Neugeborene auf den Wickeltisch gelegt. Es lag ganz schlaff, mit geschlossenen Augen, winzig, blau und jämmerlich. Man hätte es für tot halten können, aber sein Herzchen klopfte noch, wenn auch sehr schwach und erschreckend langsam.
Die Ärztin ergriff den sterilen Absaugschlauch, saugte dickflüssigen Schleim aus Mund- und Rachenhöhle, saugte die Nase frei. Die Hebamme reichte ihr das beleuchtete Intubationsgerät. Frau Dr. Holger führte behutsam den winzig kleinen Schlauch über den Kehlkopf hinweg in die Trachea ein. Die Hebamme hatte den Schlauch schon mit dem Sauerstoffgerät verbunden. Die Ärztin stellte den Apparat an – über eine Art Blasebalg wurde der kleine Junge in rhythmischen Abständen beatmet.
»Ob wir ihn durchkriegen?« fragte die Hebamme skeptisch.
»Wir müssen«, erklärte Frau Dr. Holger kurz. Sie überließ der Hebamme die Bedienung des Blasebalges, zog eine Spritze mit einem Atemstimulans auf, injizierte es.
Dann übernahm sie selber wieder den Blasebalg. Gebannt starrten die beiden Frauen auf das Neugeborene, dessen Befinden noch immer keine Änderung zeigte.
»Du machst schon Sachen, Kleiner«, sagte die Hebamme, »erst strangulierst du dich und dann …« Sie unterbrach sich. »Sehen Sie nur, Frau Doktor! Die Farbe ändert sich!«
Tatsächlich begann sich langsam, kaum merklich, die lilablaue Haut rosig zu färben. Endlich, nach fast zwanzig Minuten, tat das Kind seinen ersten Schnapper, gab es auf, versuchte es wieder und noch einmal.
»Bist doch ein tapferer kleiner Bursche«, lobte die Hebamme. »Gib nur nicht auf, mach weiter. Es lohnt sich, glaub mir! Das ganze Leben liegt ja noch vor dir!«
Als ob diese törichten Worte, die der Junge ja gar nicht verstehen konnte, eine zauberische Wirkung ausgeübt hätten, öffnete er plötzlich den Mund und tat einen Schrei – seinen ersten Schrei!
Die Hebamme und die Ärztin lächelten sich glücklich an. Die Lungen des Kindes waren entfaltet, jetzt konnte es selbständig atmen.
Der erste Schrei des Neugeborenen war bis in den OP gedrungen. Dr. Schumann hatte bereits die Nähte versorgt und war dabei, die Haut zu klammern. Unwillkürlich hob er, wie alle anderen, den Kopf, um zu lauschen.
»Patientin ist pulslos«, rief der Anästhesist entsetzt. Eine Sekunde waren alle starr vor Schrecken.
Dann riß Dr. Schumann sich mit einer wilden Bewegung den Mundschutz ab, schrie: »Reiner Sauerstoff!«
Mit dem Handballen begann er rhythmisch das Herz der Patientin zu massieren. Dr. Leopold schaltete das Ventil des Trachealkatheters auf reinen Sauerstoff, um die Patientin künstlich zu beatmen.
Im OP herrschte Totenstille.
»Kein Puls«, meldete der Anästhesist.
Dr. Schumann nahm eine Punktionsnadel und stieß sie tief in die Brust der Patientin. Sie traf das Herz. Im gleichen Augenblick entwich Luft mit pfeifendem Geräusch, und am Ende der hohlen Nadel bildete sich ein kleines Knäuel von blutigroten Bläschen. Dr. Schumann zog die Nadel zurück und setzte die Massage des Herzens fort. Er massierte unaufhörlich, verbissen, obwohl er wußte, es schon im ersten Augenblick gewußt hatte, daß alles vergebens war.
Susanne Overhoff war tot.
Aber er hoffte auf ein Wunder, denn nur ein Wunder hätte es vermocht, diese Tote zum Leben zu erwecken.
Als Frau Dr. Holger zehn Minuten später in den OP kam, um die Rettung des Neugeborenen zu melden, begriff sie sofort, daß Ungewöhnliches geschehen sein mußte, denn normalerweise wäre die Operation jetzt schon beendet gewesen. Sie trat näher, sah das wächserne Gesicht der Patientin, blickte auf Dr. Schumann. Ihre Augen begegneten sich.
»Luftembolie?« fragte die Ärztin.
Dr. Schumann nickte. Er war außerstande, ein Wort hervorzubringen.
»Und der Professor?« fragte sie. »Weiß er es schon?«
Niemand antwortete ihr.
Erst nach einer ganzen Weile sagte Dr. Gerber, der sich jetzt ebenfalls den überflüssig gewordenen Mundschutz abgenommen hatte: »Bitte, Kollegin … sprechen Sie mit ihm!«
Frau Dr. Holger sah erschrocken die drei Ärzte an – den schweren, breitschultrigen Rainer Schumann, den schmalen, intellektuellen Erich Gerber und den jungen, noch ganz unbelasteten Günter Bley. Sie alle waren Männer, starke, selbstbewußte Männer, und doch brachte keiner von ihnen den Mut auf, dem Chef die Wahrheit zu sagen. Diese Aufgabe schoben sie ihr, der Frau, zu. Warum sollte ausgerechnet sie –? Sie hatte eine Ablehnung schon auf den Lippen, da besann sie sich. Sie begriff, daß jeder dieser drei Männer am Ende seiner Kräfte war.
»Gut«, antwortete sie, »ich werde es tun.«
Dr. Schumann drehte sich um, verließ den Operationssaal und trat in den Waschraum. Dr. Gerber folgte ihm. Eine Schwester nahm ihnen Kittel und Kappen ab, drehte die Hähne auf.
»Es ist nicht deine Schuld«, meinte Dr. Gerber, während sie sich nebeneinander die Hände wuschen. »Frau Overhoff hätte dieses Kind niemals bekommen dürfen. Eine Frau, die schon bei zwei Schnittentbindungen Komplikationen hatte! Es wäre das reinste Wunder gewesen, wenn alles gut gegangen wäre.«
»Manche Menschen glauben eben an Wunder«, erwiderte Dr. Schumann und hielt sein Gesicht unter das fließende Wasser, wusch sich Nacken und Augen. »Schön und gut«, konterte Dr. Gerber, »wenn ein Laie solche Geschichten macht, will ich gar nichts sagen. Aber ein Frauenarzt!« Er warf einen vorsichtigen Blick über die Schulter, aber die Schwester stand in einiger Entfernung, war damit beschäftigt, Dr. Leopold und Dr. Bley aus ihren Kitteln zu helfen. »Wirklich leichtsinnig von dem Alten. Frau Overhoff hätte schon nach der zweiten Geburt sterilisiert gehört.«
»Das wäre gegen Professor Overhoffs Überzeugung«, sagte Dr. Schumann müde.
»Wenn ich so etwas schon höre! Auf normale Weise hätte Susanne Overhoff überhaupt kein Kind bekommen, ihr Becken war viel zu eng. Dabei hätte ihr auch der liebe Gott nicht helfen können. Ohne ärztliche Hilfe wäre sie schon bei der ersten Geburt gestorben. Weißt du, was diese Schwangerschaft war? Eine Herausforderung an das Schicksal, mein Lieber!« Er schüttelte die nassen Hände ab. »Komm mit auf meine Bude, trinken wir einen Schnaps; den können wir jetzt wohl brauchen.«
Dr. Schumann hatte wenig Lust, dieser Aufforderung zu folgen. Er wußte, daß Dr. Gerber die Gelegenheit ausnützen würde, wieder einmal seine Theorien vorzutragen, die im krassen Gegensatz zu Professor Overhoffs und auch seiner eigenen Anschauung von den Pflichten und Aufgaben eines Frauenarztes standen. Er wußte, daß er nach dieser Erschütterung ein sehr schlechter Diskussionspartner sein würde.
Aber noch mehr graute ihm vor einer Aussprache mit seiner Frau. Er warf einen Blick auf die Wanduhr. Falls er noch blieb, konnte er wenigstens hoffen, daß Astrid schon eingeschlafen war, wenn er nach Hause kam.
»Gut«, sagte er, »ich komme mit.«
Professor Overhoff saß hinter dem Schreibtisch seines Arbeitszimmers, als Frau Dr. Holger eintrat, im weißen Kittel, das blonde Haar schlicht zurückgekämmt. Overhoff sprang bei ihrem Eintritt so heftig auf, daß der schwere Aschenbecher vom Schreibtisch fiel und Zigarettenasche und Stummel sich über den Perserteppich ergossen.
»Ist es … vorbei?« fragte er.
»Ja«, antwortete Irene Holger beherrscht. »Sie haben einen gesunden kleinen Jungen bekommen, Herr Professor!«
»War die Geburt sehr schwer?«
»Ihre Gattin hat nichts davon gespürt.«
»Und wie geht es ihr? Wie geht es ihr jetzt?«
»Gut. Bitte, setzen Sie sich doch, Herr Professor!«
Irene Holger trat auf Professor Overhoff zu, drückte ihn sanft in den Sessel zurück. »Ihrer Frau geht es gut«, sagte sie noch einmal, »sie hat keine Schmerzen und keine Ängste mehr … Gott hat sie zu sich genommen.«
Professor Overhoff saß ganz starr. Sie spürte, wie sich seine Muskeln verkrampften. Er öffnete den Mund – aber der Schrei seines Herzens blieb stumm. »Sie ist in dem Augenblick gestorben, in dem sie ihr Ziel erreicht hatte … gerade als ihr kleiner Sohn den ersten Laut von sich gab. Sie hat glücklich gelebt, und sie ist glücklich gestorben. Das ist wohl mehr, als man von den allermeisten Menschen sagen kann.« Mit einer Stimme, die seltsam fremd und undeutlich klang, so als ob es ihm schwerfiele, die Laute zu artikulieren, sagte Overhoff: »Gehen Sie jetzt. Bitte, lassen Sie mich allein!«
»Wenn Sie Ihren Sohn sehen wollen …«
Er holte tief Luft. »Nein!« Seine Stimme schnappte über. Frau Dr. Holger stand ganz still und sah auf ihn herab. Sie wußte, daß es für diesen Mann keinen Trost gab und keine Rechtfertigung. Dennoch widerstrebte es ihr zutiefst, ihn in dieser Verfassung allein zu lassen.
»Herr Professor …«, versuchte sie es noch einmal, aber es gelang ihr nicht, den Satz zu Ende zu sprechen.
»Raus!« stöhnte er. »Raus!«
Wortlos, mit zusammengebissenen Zähnen, verließ Frau Dr. Holger das Arbeitszimmer des Professors. Erst als sie auf dem langen, spärlich beleuchteten Gang stand, spürte sie, daß auch ihre eigenen Nerven zu versagen drohten. Aber sie straffte die Schultern und wandte sich entschlossen zum Säuglingszimmer.