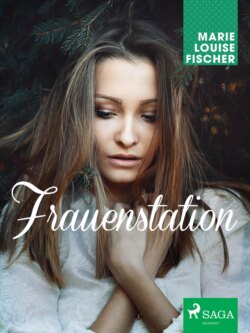Читать книгу Frauenstation - Marie Louise Fischer - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеProfessor Overhoff nahm seine Sprechstunde einen Tag nach der Beerdigung seiner Frau wieder auf. Äußerlich wirkte er völlig gefaßt, wenn auch alle, die ihn näher kannten, spürten, daß eine große Veränderung mit ihm vorgegangen war. Bei allem, was er tat und sagte, schien er innerlich völlig unbeteiligt zu sein. Es war, als sei der Kern seines Wesens vor Schmerz versteinert.
Kirsten Winterfeld merkte nichts davon. Sie war viel zu aufgeregt, zu sehr mit ihren eigenen Problemen beschäftigt, um etwas anderes in Professor Overhoff sehen zu können als den berühmten Professor, den Vertrauenswürdigen Arzt.
Sie hatte eine erste Untersuchung über sich ergehen lassen und ihm ihre Sorgen geschildert. Dreiundzwanzig Jahre war sie jetzt alt, seit vier Jahren verheiratet – aber immer wieder hatte sie vergeblich auf Anzeichen einer Mutterschaft gewartet.
Hektische, scharf abgezirkelte rote Flecken erschienen auf ihren Wangen, während sie erzählte. »Ich habe meinen Zyklus beobachtet«, berichtete sie, »ich habe genau darauf geachtet, besonders natürlich im letzten Jahr. Übrigens habe ich auch einen Regelkalender geführt, allerdings nur in meinem Notizbuch …« Sie begann in ihrer Handtasche zu kramen. »Vielleicht ist das ein bißchen primitiv, aber er stimmt ganz genau!« Sie fand ihr ledernes Notizbuch, schlug die vorderen Seiten auf und reichte es Professor Overhoff über den Schreibtisch.
Er blätterte darin. »Hm«, sagte er, »gar nicht schlecht …«
Dann legte er das Notizbuch aus der Hand. »Welche Krankheiten haben Sie gehabt?«
»Nur die üblichen Kinderkrankheiten … Masern, Keuchhusten, ein paarmal Angina. Aber die Mandeln wurden mir schon mit zwölf Jahren herausgenommen.«
»Sonst keine Operation?«
»Nein.«
»Geschlechtskrankheiten?«
Die roten Flecken auf Kirstens Wangen verschärften sich.
»Nein.«
»Vielleicht einmal eine Unterleibserkältung?«
Kirsten dachte nach. »Nicht daß ich wüßte … nein, ich glaube wirklich nicht …«
Professor Overhoff legte nachdenklich die Fingerspitzen gegeneinander. »Nun, ich denke, wir sollten trotzdem die Durchgängigkeit des Eileiters prüfen. Aber vorher möchte ich doch mit Ihrem Gatten sprechen.«
»Ist es … so gefährlich?«
»Nein. Aber ich könnte mir vorstellen … wie alt ist Ihr Gatte?«
»42 Jahre …«
»Hm. Und ist Ihnen nie der Gedanke gekommen, daß Ihre Kinderlosigkeit an ihm liegen könnte?«
Kirstens helle Augen wurden groß. »An meinem Mann?«
Professor Overhoff sah das ungläubige Staunen in Kirstens Gesicht. Er war nicht überrascht. Er hatte es unzählige Male in seiner langen Praxis als Chefarzt der Frauenklinik erlebt. Es war stets das gleiche: Fast immer suchten die Frauen bei sich selber die Schuld, wenn ihre Ehe kinderlos blieb. Daß es auch an ihren Männern liegen konnte, hielten die wenigsten für möglich.
Dr. Overhoff stand auf, ging auf sie zu, legte seine Hände auf Kirsten Winterfelds Schultern. »Versuchen Sie Ihren Mann zu überreden, daß er mich einmal aufsucht. Ich weiß, die meisten Frauen weichen einem solchen Gespräch aus. Überwinden Sie sich! Nehmen Sie nicht schon die Schuld auf sich, ehe es erwiesen ist!«
Röte schoß in Kirstens Gesicht. Schnell verabschiedete sie sich von Professor Overhoff. »Ich will es versuchen«, sagte sie schwach, schon unter der Tür. Aber sie wußte nicht, ob sie den Mut dazu finden würde.
Sie steuerte ihren kleinen Wagen durch den Mittagsverkehr. Sie fuhr nervös und unsicher und atmete erst auf, nachdem sie den Wagen auf dem Hof hinter dem Haus, in dem sie wohnte, abgestellt hatte. Durch ein dunkles, kaltes Treppenhaus stieg sie in den zweiten Stock. Im rechten Flügel hatte Dr. Hugo Winterfeld seine Anwaltskanzlei, im linken Flügel befand sich die Wohnung.
Es war zwölf vorbei. Kirsten mußte sich beeilen, um das Mittagessen rechtzeitig auf dem Tisch zu haben. Schnell schlüpfte sie aus der Kostümjacke, band sich in der Küche eine frische, bunte Schürze um, begann Salat zu waschen, vermengte ihn mit einer Joghurt-Kräuter-Sauce und trug die gläserne Salatschüssel ins Wohnzimmer.
Wenn wir ein Kind haben, dachte sie wohl zum tausendstenmal, werden wir uns eine andere Wohnung suchen müssen. Hier ist kein Platz für ein Baby. Keine Ruhe, kein Garten. Nicht einmal eine Parkanlage in der Nähe.
Träume … Und plötzlich der Gedanke wie ein Stachel: Aber wenn es an meinem Mann liegen sollte? Kirsten lief wieder in die Küche, schob den Einsatz mit den Steaks in den schon vorgewärmten Grill. Dann ging sie ins Bad, wusch sich die Hände und cremte sie ein.
Als ihr Mann Minuten später die Wohnungstür aufschloß, standen die gegrillten und gewürzten Steaks bereits auf dem Tisch. Kirsten hatte ihre Schürze abgenommen und kam ihm strahlend entgegen.
Er nahm sie in die Arme und küßte sie mit flüchtiger Zärtlichkeit. »Na, wie geht’s, mein Schatz?«
Sie reckte sich auf die Zehenspitzen, gab ihm einen Kuß auf die Nase. »Danke, Liebster … wundervoll!«
»Warst du bei diesem Professor?« begann er unvermittelt.
»Ja, natürlich. Du hast doch nicht gedacht, ich würde im letzten Moment kneifen?«
»Hm … nein!« Er fuhr sich mit einer nervösen Bewegung über das Haar, das sich bereits zu lichten begann. Er war ein schlanker, großer Mann mit schmalem Gesicht und hoher Stirn, grauen, klugen Augen und einem empfindsamen Mund. »War nicht sehr angenehm?«
»Nicht so schlimm«, erwiderte sie lächelnd. »Komm, die Steaks werden kalt.«
Er setzte sich in einen der hohen, lederbezogenen Sessel, sie nahm auf der Couch Platz.
»Möchtest du mir denn nicht erzählen …?« fragte er, während er seine Serviette langsam auseinanderfaltete.
»Später, Liebster …«, lächelte sie. Obwohl sie es selber kaum erwarten konnte, alles mit ihm zu bereden, sagte ihr der weibliche Instinkt, daß sich ein solches Gespräch zwischen zwei Bissen schlecht führen lassen würde.
Er gab sich zufrieden, plauderte zerstreut über Belanglosigkeiten. Beide waren froh, als sie diese Mahlzeit hinter sich hatten und Kirsten die Kaffeemaschine auf den Tisch stellte. Sie räumte ab, er holte Aschenbecher.
Dann, als der Kaffee in den Tassen dampfte, sah er sie prüfend an. »Also …«, begann er, »läßt sich etwas machen … ja oder nein?«
»Es ist alles ganz anders, als wir es uns vorgestellt haben!« Kirsten sah an ihm vorbei. Zögernd fuhr sie fort: »Professor Overhoff meint … genau kann er das jetzt natürlich noch nicht sagen, er will noch eine Tubendurchblasung vornehmen … aber jedenfalls hat er den Eindruck, daß bei mir alles in Ordnung ist.«
»So?« fragte er ungläubig.
»Er hat mich gründlich untersucht und nach allen möglichen Krankheiten gefragt …«
»Aber an irgend etwas muß es doch liegen! Er kann uns doch nicht einreden, daß wir es nicht oft genug versucht hätten!«
Sie errötete leicht, griff nach einer Zigarette. »Na ja, aber immerhin ist es möglich, daß wir den genauen Zeitpunkt verpaßt haben …«
»Daß wir uns verrechnet haben?« Er ließ sein Feuerzeug aufspringen, gab ihr Feuer. »Das ist ausgeschlossen.«
»Professor Overhoff hat mir erklärt«, sagte sie, »manche Kapazitäten seien der Auffassung, daß es sich bei dem Zeitpunkt, zu dem ein Ei befruchtet werden könnte, überhaupt nur um wenige Stunden handle. Es könnte also doch einfach Zufall sein, daß …«
»Nein«, rief er brüsk, »daran glaube ich nicht. Laß dir nichts einreden!«
»Aber Rainer schwört auf ihn!«
»Kunststück, Overhoff ist ja sein Chef.«
»Er ist bestimmt ein guter Arzt«, betonte Kirsten mit Nachdruck, »und wir können doch keine Wunder verlangen.«
»Verlange ich nicht. Ich will wissen, woran es liegt.«
»Wenn er die Tubendurchblasung gemacht hat, werden wir es genau wissen.« Sie zögerte, fügte dann hinzu: »Ich würde dich genauso lieben … auch wenn ich wüßte, daß wir niemals Kinder haben könnten.«
Er sah sie an. »Was soll denn das schon wieder heißen?«
Sie begegnete seinem Blick mit weit geöffneten Augen.
»Genau das, was ich gesagt habe.«
Er nahm einen Schluck Kaffee. »Hör mal, Kirsten«, sagte er, »du willst mir doch hoffentlich nicht unterstellen, daß meine Liebe zu dir irgend etwas mit dieser Sache zu tun hat? Wenn wir keine Kinder haben können, müssen wir uns eben damit abfinden. Wenn sich also bei dieser Tubendurchblasung herausstellen sollte …«
»Das wäre nicht das Schlimmste. Rainer hat mir schon erklärt, wenn einer der Eileiter verwachsen ist, läßt sich schon etwas machen. Daß beide ganz zu sind, ist höchst selten.«
»Na schön. Wann macht ihr also diese Durchblasung?«
»Bald«, sagte sie.
»Du hast noch keinen Termin?«
»Ich soll Professor Overhoff anrufen …«
»Aber warum denn so umständlich? Ihr hättet doch gleich ausmachen können, wann du …«
Sie atmete tief. »Hugo!«
Ihr Ton beunruhigte ihn. »Ja?«
»Hast du noch nie daran gedacht, daß die Ursache … vielleicht, meine ich … auch bei dir liegen könnte?«
»Also das ist es!« Er lachte plötzlich auf. »Nein, das habe ich nicht. Es ist auch völlig ausgeschlossen.«
»Professor Overhoff meint … bitte, sei mir nicht böse, Liebling … du solltest dich auch untersuchen lassen!«
»Wozu?«
»Er sagt, ein Mann merkt gar nicht selber … er kann es nicht merken … ob bei ihm alles in Ordnung ist. Das hat nämlich mit … na, du weißt schon … gar nichts zu tun, sondern …«
»Hör mal, Schatz«, erklärte Dr. Winterfeld, »ich bin dir nicht böse, wirklich nicht. Aber glaub mir: Du hast dir da etwas ganz Dummes einreden lassen.«
»Vielleicht ist es wirklich dumm«, meinte sie, »ich kann es mir ja selber nicht vorstellen! Aber trotzdem, nur zu unserer Beruhigung … wäre es nicht doch gut, wenn du einmal zu Professor Overhoff gingest? Du kannst dich natürlich auch von einem Dermatologen untersuchen lassen …«
»Nein«, sagte er hart.
»Aber warum nicht? Warum? Ich tue doch auch alles, um … wir wollen doch beide Kinder haben! Ja, ich weiß, so etwas ist ein bißchen peinlich, aber glaubst du, mir waren diese Untersuchungen angenehm? Ich bitte dich, Hugo … bitte, bitte, tu’s!«
»Hör auf damit«, rief er.
Sie schwieg. Dann, nach einer langen Pause, sagte sie bedrückt: »Ich verstehe dich nicht, Hugo.«
Er fuhr auf. »Was ist denn dabei schon zu verstehen? Du bildest dir doch nicht ein, ich würde mich vor einer solchen Untersuchung drücken? Warum sollte ich denn? Aus männlicher Eitelkeit etwa? Kennst du mich so schlecht?«
Sie beugte sich vor. Sie strich über seine Hand, die auf dem Couchtisch lag. »Bitte … tu’s … zu meiner Beruhigung … mir zuliebe!« sagte sie. »Tu’s bitte!« wiederholte sie noch einmal.
»Es liegt nicht an mir!« antwortete er. »Um das zu wissen, brauche ich mich nicht erst untersuchen zu lassen.«
»Du kannst es nicht wissen!«
»Doch«, sagte er sehr bestimmt, »ich weiß es ganz genau!«
Er stand auf, ging zur Tür. Sie wollte ihm noch etwas nachrufen, aber er war schon aus dem Zimmer gegangen. Er hatte nicht einmal seine erste Tasse Kaffee ausgetrunken.
Es dauerte eine ganze Weile, ehe Kirsten die Tragweite seiner Worte wirklich erfaßte.
Kurz nach neun Uhr abends hielt ein Taxi vor der Frauenklinik. Eine Frau stützte ein junges, leichenblasses Mädchen, das sich kaum noch auf den Beinen halten konnte. Der Pförtner schickte beide in das Untersuchungszimmer. Dr. Schumann wurde verständigt.
Er kam sofort.
Das Mädchen kauerte in einem Sessel, eine zerbrechliche, noch fast kindliche kleine Gestalt mit weit aufgerissenen, entsetzten Augen.
Die Frau konnte vor Aufregung kaum reden. »Meine Tochter«, sagte sie, »ich weiß gar nicht, was mit ihr los ist! Ich bin eben erst von der Arbeit nach Hause gekommen … wir machen augenblicklich Inventur, da wird es so spät, ich arbeite nämlich in einem Modehaus …«
Dr. Schumann wandte sich an Schwester Ruth, eine hagere ältliche Person mit verschlossenem Gesicht, die ihm offenbar nicht sehr gewogen war. »Bitte, messen Sie die Temperatur, Schwester!«
»Jawohl, Herr Oberarzt …«
Er hatte das unbestimmte Gefühl, als sei die Antwort der Schwester fast widerwillig gekommen – aber er konnte sich auch täuschen; jedenfalls hatte er jetzt keine Zeit, darüber nachzudenken, und sah wieder die Mutter des Mädchens an. »So … und was war nun weiter?«
»Angelika war so sonderbar, ganz verzweifelt. Sie stöhnte und weinte immerzu, sagte, daß sie sterben müsse. Ich konnte gar nicht herausbekommen, was eigentlich mit ihr los ist, nur daß sie schreckliche Schmerzen im Unterleib hat …«
»Seit wann?« fragte Dr. Schumann das Mädchen, das am ganzen Körper zitterte.
»Seit heute nachmittag …« Sie sprach so leise, daß es kaum zu verstehen war.
»Angelika lag schon im Bett«, erklärte ihre Mutter. »Ich war so entsetzt und wußte mir nicht zu helfen. Da habe ich gedacht, das beste ist, du bringst sie gleich zum Arzt!«
»Das Vernünftigste, was Sie tun konnten.«
»Es ist doch nichts Ernstes, Herr Doktor, nicht wahr? Sie bildet sich doch nur ein, daß sie …!?« Die Stimme der Mutter versagte.
»Auf alle Fälle sind Sie ja rechtzeitig gekommen. Ich untersuche Ihre Tochter jetzt, und dann werden wir gleich mehr wissen.«
Schwester Ruth nahm dem Mädchen das Thermometer ab.
»37,2«, meldete sie.
»Nur mäßig erhöht«, stellte Dr. Schumann fest. Er lächelte der Mutter beruhigend zu. »So schlimm kann es mit Ihrer Tochter also nicht sein. Bitte, gehen Sie jetzt mit der Schwester, und geben Sie Ihre Personalien an.«
»Ja. Ja, natürlich …« Die Frau ging zur Tür, kam aber sofort wieder zurück. »Mach’s gut, Engelchen«, rief sie ihrer Tochter zu, »du brauchst keine Angst zu haben, wirklich nicht! Der Herr Doktor wird dir schon helfen.«
Das Mädchen reagierte nicht. Ihre vom Weinen verschwollenen Augen schienen die Mutter nicht einmal zu sehen. Als die Frau gegangen war, half Dr. Schumann Angelika auf den Untersuchungsstuhl. »Wie alt bist du?« fragte er. »Na, nun rede schon! Ich weiß, daß du mich genau verstehst.«
»Fünfzehn.«
»Und wo arbeitest du?«
»Ich gehe noch zur Schule.«
»Wie lange hast du deine Tage nicht mehr gehabt?«
Das Mädchen preßte die bebenden Lippen zusammen.
»Du kannst es mir ruhig sagen«, drängte der Arzt, »ich bekomme es auch so heraus, du kannst dich darauf verlassen.«
»Seit … drei … Monaten.«
Dr. Schumann hatte sich die Gummihandschuhe angezogen und stellte den Spiegel auf den äußeren Muttermund ein. Der Muttermund war knapp fingerdick durchgängig, aus dem Uterus kam eine leichte Blutung.
Dr. Schumann richtete sich auf. »Und wie hast du es gemacht?«
»Mit einer Stricknadel«, gestand das Mädchen kaum hörbar.
Dr. Schumann holte tief Luft. Es gab einiges, was er gern gesagt hätte. Er unterdrückte es mühsam. Es war jetzt nicht der richtige Augenblick, dieses verzweifelte Menschenkind zur Vernunft zu bringen.
Schwester Ruth kam ins Untersuchungszimmer.
»Schreiben Sie«, sagte Dr. Schumann. »Leichte Blutung, ex utero.« Er untersuchte bimanuell, einen Finger innen, die Hand außen, diktierte: »Muttermund leicht vergrößert und etwas aufgelockert. Beginnender Abort.«
Angelika begann hemmungslos zu schluchzen.
»Nimm dich zusammen«, fuhr Dr. Schumann sie an, »du machst dich noch kränker, als du schon bist, wenn du dich in eine solche Aufregung hineinsteigerst! Du wirst nicht sterben, das schwöre ich dir, und dein Kind wirst du vielleicht auch behalten.«
»Nein!« Angelika schrie es heraus.
»Geben Sie ihr ein Beruhigungsmittel«, wandte sich Dr. Schumann an Schwester Ruth.
»Ich will das Kind nicht haben!« rief Angelika. »Ich kann nicht … jetzt schon. Ich gehe doch noch zur Schule und … wenn Sie das tun, bringe ich mich um!«
»Das wäre schön dumm von dir.«
»Bitte«, flehte Angelika, »bitte, helfen Sie mir … ich könnte es nicht ertragen, ich würde es nicht überleben …«
»Die Schwester gibt dir etwas zur Beruhigung und bringt dich auf die Station. Jetzt wirst du erst mal schlafen, und nachher sieht alles wieder viel besser aus. Ich komme dann zu dir, und wir besprechen die Sache in aller Ruhe, ja?«
Ohne ihre Antwort abzuwarten, trat er in den Vorraum, wo Angelikas Mutter wartete.
Sie hatte auf der Bank gesessen, nun sprang sie auf. »Was ist, Herr Doktor? Mein Kind …«
Er unterbrach sie. »Sie müssen jetzt sehr vernünftig sein. Angelika braucht Sie. Heute mehr als je zuvor in ihrem Leben.«
»Aber …was ist es? Was ist denn los mit meiner Tochter, Herr Doktor?«
»Wir müssen leider mit einer Fehlgeburt rechnen …«
»Nein«, schluchzte die Frau, »nein! Das ist nicht möglich … das kann nicht sein!«
»Leider ist es doch so.«
»Aber sie ist doch noch ein Kind, Herr Doktor, ein Kind!«
Die Mutter verkrampfte die Hände über ihrer kleinen Handtasche, ihr Gesicht verzog sich schmerzhaft. Sie mochte sonst eine gutaussehende, sehr gepflegte Frau Ende Dreißig sein; der Schock machte sie um Jahre älter.
»Das ist eben das Unglück«, erklärte Dr. Schumann, »ein Kind, das nicht wußte, worauf es sich eingelassen hat.«
»Und ich habe nichts gemerkt! Wie ist es denn möglich, daß ich gar nichts gemerkt habe?! Warum hat sie sich mir nicht anvertraut? Sie hatte doch solches Vertrauen zu mir! Seitdem ich geschieden bin … wir beide waren wie Freundinnen, wie gute Freundinnen!« Angelikas Mutter begann hemmungslos zu weinen.
»Glauben Sie mir«, sagte Dr. Schumann beruhigend, »ich verstehe sehr gut, was Sie empfinden; aber die Hauptsache ist jetzt, daß wir sie über den Berg bringen – und daß das Kind gesund zur Welt kommt. Wir müssen es versuchen.«
»Das Kind«, schluchzte Angelikas Mutter, »aber sie kann ja nicht … sie ist selber noch … sie kann unmöglich …«
»Doch«, sagte Dr. Schumann, »körperlich ist Angelika schon eine junge Frau. Es ist schwer, ich weiß, für Sie beide … aber Sie müssen ihr jetzt zur Seite stehen, ihr helfen, sie aufrichten …«
»Wie kann ich das denn? Ich habe ja keine Zeit … nicht einmal Zeit habe ich für meine Tochter! Sonst hätte es ja nie passieren können. Mein geschiedener Mann zahlt mir nichts, ich muß arbeiten, Angelika ist den ganzen Tag sich selbst überlassen … und wie soll es erst werden, wenn das Kind da ist? Angelikas Leben wäre zerstört, noch ehe es richtig begonnen hat …«
»Das glaube ich nicht«, widersprach Dr. Schumann. »Sie sehen die Dinge viel zu schwarz. Es wird sich bestimmt alles einrenken …«
»Nein, nein, versuchen Sie mir nichts vorzumachen! Sie wissen genau, was das bedeuten würde … ein fünfzehnjähriges Mädchen mit einem Kind! Und sie ist so gescheit, so gut in der Schule … sie wollte … ihr Abitur machen, und jetzt … und jetzt ist alles aus.«
»Es tut mir leid«, murmelte Dr. Schumann. Er wußte nicht, was er sonst sagen sollte.
»Bitte, helfen Sie, Herr Doktor«, flehte Angelikas Mutter, »helfen Sie! Sie können es, wenn Sie nur wollen! Bitte, seien Sie barmherzig!«
Als Dr. Schumann wenige Minuten später wieder mit Schwester Ruth allein war, fragte er: »Sie haben doch eine Blutabnahme veranlaßt?«
»Ja, Herr Doktor …«
»Sagen Sie im Labor Bescheid, daß zwei Blutkonserven bereitgestellt werden.« Als er bemerkte, daß die Schwester zögerte, fragte er: »Sonst noch etwas?«
»Herr Doktor …« Schwester Ruth stockte. »Wollen Sie wirklich eine Kürettage vornehmen?«
Dr. Schumann blickte sie überrascht an; er fand diese Frage reichlich respektlos und wollte schon heftig reagieren, besann sich aber dann. Warum sollte er sich beim Personal der Klinik unnötig Feinde machen?
»Wieso interessiert Sie das?«
»Es ist nur … eigentlich geht es mich ja nichts an … aber ich finde, daß man so etwas nicht unterstützen sollte!«
»Was meinen Sie mit … so etwas?«
»Nun, es ist doch eine Schande, wie leichtsinnig diese jungen Dinger heutzutage sind. Fünfzehn Jahre! In dem Alter hätten wir an Liebe noch nicht einmal gedacht. Und dann, wenn sie ihren Spaß gehabt haben und etwas passiert ist … dann bloß weg mit dem Kind! Nur keine Verantwortung tragen. Finden Sie das etwa richtig?«
Dr. Schumann mußte sich ein Lächeln verkneifen. Offensichtlich lag hier nichts anderes vor als ein gewisser Geschlechtsneid der ältlichen, verblühten Frau gegenüber der blutjungen Angelika. Er sah jedoch Schwester Ruth ernst in die Augen und antwortete: »Nein, absolut nicht. Ich finde es sogar sehr traurig. Wir Ärzte sind aber schließlich nicht dazu da, gute und schlechte Zensuren für das Betragen unserer Patienten auszuteilen. Unsere Aufgabe ist es einzig und allein, zu helfen.«
»Ja, aber …«
»Liebe Schwester Ruth!« unterbrach Dr. Schumann sie ungeduldig und jetzt doch ein wenig erzürnt, »überlassen Sie die Entscheidung bitte mir, was zu geschehen hat. Sie sind für meine Anordnungen nicht verantwortlich und haben auch kein Recht, ein Urteil darüber zu fällen. Im übrigen ist es ja noch gar nicht heraus, ob ich den Eingriff vornehme. Ich wünsche nur, daß alles für den Notfall vorbereitet wird und daß ich benachrichtigt werde, wenn sich der Zustand der Patientin verschlechtert. Haben Sie mich verstanden?«
»Jawohl, Herr Oberarzt!« antwortete die Schwester pikiert. Sie war ganz blaß geworden. Beleidigt, mit bösem und verbissenem Gesicht, rauschte sie von dannen.
Tatsächlich befand sich Dr. Schumann in einem quälenden inneren Konflikt. Medizinisch gesehen, war es ein Risiko, einen beginnenden Abort zu behandeln und die Schwangerschaft zu erhalten, ganz abgesehen von dem erforderlichen Aufwand an pflegerischen Maßnahmen. Andererseits widerstrebte es ihm zutiefst, das Leben eines Kindes im Mutterleib zu vernichten, wenn eine auch nur geringe Chance bestand. Eine Chance indessen, die wesentlich vom Verhalten der Mutter abhing. Nur wenn die junge Patientin mitmachte, wenn sie genau den Anweisungen der Ärzte und Schwestern folgte, unendliche Geduld aufbrachte und den festen Willen hatte, das Kind unter allen Umständen zur Welt zu bringen, war an einen möglichen Erfolg zu denken. Gerade dieser Wille aber fehlte bei der Fünfzehnjährigen ohne Zweifel vollkommen. Gab es überhaupt noch einen Weg, ihre negative Anschauung zu überwinden?
Selbst wenn Angelika, dachte er, längere Zeit hier in der Klinik bliebe, selbst wenn es gelänge, sie unter Kontrolle zu halten und die Fehlgeburt zu verhindern – würde sie nicht, entlassen und zu Hause sich selbst ausgeliefert, die gleiche Wahnsinnstat erneut begehen? Könnte sie nicht sogar ihre Drohung wahr machen und den Freitod wählen? Was konnte er ihr sagen, um sie davon abzuhalten? Ging das nicht über seine Kraft? Und würde nicht das unerwünschte Kind wirklich eine Katastrophe für dieses junge Mädchen bedeuten und sie völlig aus der Bahn werfen? Ja, wenn die Familie intakt wäre; wenn die Mutter ihrer frühreifen und doch noch so kindlichen Tochter ein Halt sein könnte – dann sähe die Sache vielleicht anders aus.
Dr. Schumann seufzte tief. Er dachte an den Eid des Hippokrates, den er wie jeder Arzt geschworen hatte und der ihn verpflichtete, für das Leben einzutreten, es zu erhalten, niemals zu vernichten. Aber würde er nicht in Angelikas Fall, wenn er zögerte, um das Kind zu retten – würde er dann nicht zwei Menschen auf dem Gewissen haben: das Ungeborene und die blutjunge Mutter?
Von Unruhe getrieben, ging er schon kurze Zeit später zu dem Zimmer, in dem Angelika lag. Schwester Gisa, noch jung und voller Mitgefühl, kam eben heraus.
»Das arme Ding!« flüsterte die Schwester, als Dr. Schumann nach dem Befinden der Patientin fragte. »Sie kann nicht schlafen. Immer nur weint und stöhnt sie. Ich habe fast die ganze Zeit an ihrem Bett gesessen. Man muß Angst haben, daß sie aus dem Fenster springt oder sonst etwas Unvernünftiges tut. Sie jammert ständig, daß sie nicht mehr leben will.
»Haben Sie ihr keine Beruhigungsmittel gegeben?«
»Doch. Mehr als ich auf meiner Liste hatte. Aber zuviel wagte ich natürlich auch nicht. Oder hätte ich …?«
»Nein!« Dr. Schumann öffnete die Tür und trat an Angelikas Bett. Die Kleine sah noch bejammernswerter aus als bei ihrer Einlieferung. Ihr rotblondes Haar war schweißverklebt, ihr Gesichtchen wirkte spitz und blaß, tiefe Schatten lagen unter den Augen.
»Na, Angelika«, sagte er betont munter, »ich hatte doch versprochen, dich zu besuchen …«
Sie antwortete nicht.
Dr. Schumann schlug die Bettdecke zurück und stellte fest, daß die Blutung eher stärker geworden war. Nachdenklich blickte er auf das Bündel Elend. Es war, als kämpfe er noch einmal einen schweren Kampf mit sich. Dann raffte er sich zu einem Entschluß auf: »Lassen Sie die Patientin zur Ausräumung fertig machen, Schwester!«
Angelika rührte sich nicht. Sie war so erschöpft und apathisch, daß sie nicht einmal begriff, was diese Anordnung für sie bedeutete.
Als Dr. Schumann in den Operationsraum trat, hatte der Anästhesist mit der Narkose begonnen. Die Beine der Patientin waren hochgelagert, ihr Körper mit sterilen Tüchern abgedeckt.
Der Chirurg wartete auf das Zeichen des Anästhesisten, dann hakte er den Uterus an, zog ihn nach vorn, weitete schnell den Muttermund mit Dehnstiften, um Zugang zu schaffen. Schwester Selma reichte ihm die Kürette. Er begann mit der Ausschabung.
Plötzlich kollabierte die Patientin. Ein Kreislaufschock!
»Verdammt!« entfuhr es Dr. Schumann. »Adrenalin! Schnell!«
Zorn auf sich selber und sein Zögern erfüllte ihn. Hätte er schon früher operiert, wäre dies gewiß nicht geschehen. Der Anästhesist machte Druckbeatmung mit Sauerstoff, Dr. Schumann injizierte Adrenalin in das Herz. Kurz darauf wurde der Puls wieder tastbar und zusehends fester. Dr. Schumann atmete auf und beendete den Eingriff.
Langsam, quälend langsam schwand die leichenhafte Blässe aus den Wangen Angelikas. Ein leichtes, zartes Rosa schimmerte durch ihre Haut. Ihr Atem wurde tiefer …
Später, als Angelika erwacht war, ging Dr. Schumann noch einmal zu ihr. Sie lächelte ihn zaghaft an.
»Na, siehst du«, sagte er beruhigend, »jetzt haben wir alles überstanden! Eine Woche mußt du noch bei uns bleiben, dann darfst du wieder zu deiner Mutter nach Hause.«
»Und ich werde nicht … angezeigt?« flüsterte Angelika.
»Nein«, erwiderte er, »wie kommst du darauf? Wir sind doch keine Polizeispitzel. Aber eines mußt du mir ganz fest versprechen …«
»Herr Doktor«, unterbrach ihn Angelika, »Sie glauben doch nicht, daß ich so etwas noch einmal machen würde?«
»Unter ›so etwas‹ verstehe ich aber auch das andere, Angelika! Du bist noch viel zu jung, um dich mit einem Mann einzulassen.«
»Er war ja mein Freund«, sagte sie leise.
»Ein feiner Freund, der dich in eine solche Situation gebracht hat. Versprichst du mir, mit ihm Schluß zu machen? Es kann wirklich zu nichts Gutem führen, Angelika!«
»Ja, ich weiß«, gab sie zu, »bloß … ich bin immer so viel allein.«
»Darüber werde ich mit deiner Mutter sprechen. Aber von dir verlange ich, daß du dir ganz fest vornimmst, mit der Liebe zu warten, bis du erwachsen bist.«
»Ja«, sagte Angelika, »ja …«
»Hand darauf?«
»Ja.« Sie reichte ihm ihre schmale, ein wenig feuchte Mädchenhand, sah ihn aus tränengroßen Augen an. Erst jetzt wurde es Dr. Schumann bewußt, daß sie mit ihrem rotblonden Haar, der zarten Haut und den leuchtendblauen Augen ein ungewöhnlich anziehendes junges Mädchen war.
»Du willst doch später einen guten Mann bekommen, Kinder haben, eine glückliche Frau werden, nicht wahr?« lächelte er. »Dann mußt du jetzt auch noch ein bißchen Geduld aufbringen. Die Liebe läuft dir nicht davon.«
»Sie würde ich auf der Stelle heiraten«, sagte Angelika überraschend.
Der Oberarzt lachte. »Tut mir leid für dich; ich bin schon vergeben. Und ein bißchen zu alt wäre ich wohl auch.«
Als Dr. Schumann nach Hause kam, war der Tisch gedeckt. Astrid empfing ihn in einem eleganten Kleid, das kastanienbraune Haar mit gewollter Nachlässigkeit aufgesteckt. Sie schlang ihre Arme um seinen Hals, legte ihr Gesicht an seine Wange. »Der Tee ist gleich fertig …«
»Nein, bitte keinen Tee. Wenn du ahntest, wieviel Kaffee und Tee ich mir in den letzten Stunden einverleibt habe! Gib mir lieber ein Glas kalte Milch.«
Sie ging in die Küche, kam mit einer Kanne Milch zurück, füllte ihm einen Becher. Er hatte schon begonnen, sich hungrig eine Scheibe Brot zu streichen. Sie schenkte ihm ein, und er leerte den ersten Becher in einem Zug.
Sie setzte sich ihm gegenüber, beobachtete ihn, ohne selber etwas anzurühren. »Du siehst so zufrieden aus.«
»Bin ich auch«, sagte er, »dabei habe ich eigentlich gar keinen Grund dazu.«
»Wieso?! Das verstehe ich nicht.«
Er überlegte eine Sekunde, dann siegte sein Bedürfnis, sich einem Menschen mitzuteilen. Wenn es jemanden gab, von dem er hoffen konnte, daß er seine Handlungsweise voll und ganz guthieß, dann war es seine Frau. Er erzählte ihr von Angelika und von der schweren Entscheidung, vor die ihn dieser Fall gestellt hatte.
»Aber eigentlich hättest du es nicht tun dürfen – oder?« fragte Astrid nachdenklich, nachdem er geendet hatte.
»Du weißt, wie ich zu diesen Dingen stehe. Man muß immer versuchen, das Leben zu bewahren. Ich weiß nicht, ob es hier noch möglich gewesen wäre, den Abort zu verhindern; jedenfalls hätte ich dazu aber in allererster Linie die Energie, den Willen der Mutter gebraucht … Nein, die Kleine konnte es nicht mehr durchstehen …«
»Glaubst du, daß sich diese Angelika wirklich das Leben genommen hätte, wenn ihr Kind geboren worden wäre?«
Er sah Astrid erstaunt an. »Wieso fragst du das?«
»Na ja, ich überlege mir einfach … es könnte doch auch sein, daß sie es darauf angelegt hat! Daß sie von Anfang an vorhatte, dich zu diesem Eingriff zu zwingen, dich sozusagen weich zu machen.«
»Schon möglich, aber meiner Meinung nach reine Theorie. Das Mädchen war ja vollkommen fertig und konnte kaum noch klar denken.«
»Meinst du nicht trotzdem, daß diese Geschichte für dich irgendwelche Folgen haben kann? In einer Klinik wird so viel getratscht.«
»Das ist doch Unsinn! Der Eingriff war notwendig und läßt sich medizinisch voll rechtfertigen.«
»Es kann aber auch andere Ansichten geben. Vielleicht kommt es zu Gerüchten. Du solltest vorsichtiger sein und dir irgendeine … irgendwie eine Rückendeckung verschaffen.«
»Rückendeckung? Warum denn das? Und vor allem: Wie?«
»Na, sprich zum Beispiel einmal mit Overhoff darüber. Er wird es sicher verstehen, daß du dich aussprechen willst.«
Er nahm einen Schluck Milch. »Wenn es dich beruhigt, werde ich es mir überlegen, Astrid!«
»Überlegen genügt nicht. Du mußt es tun!«
Er sah sie mit einem seltsamen Ausdruck an. »Merkwürdig«, meinte er, »anscheinend habe ich wirklich keine Ahnung von der weiblichen Psyche. Deine Reaktion hätte ich mir ganz anders vorgestellt.«
»Ach, Rainer«, sagte sie, »natürlich habe ich Mitleid mit diesem törichten Mädchen. Aber schließlich … ich kenne sie nicht, und sie bedeutet mir nichts. Aber du … du bist mir doch das Wichtigste auf der Welt!«