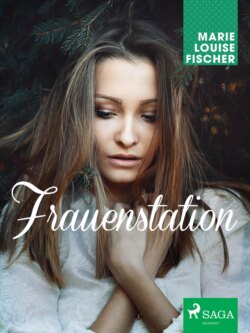Читать книгу Frauenstation - Marie Louise Fischer - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеDie Patientin Evelyn Bauer wand sich stöhnend auf dem Entbindungslager. Sie hatte die Hände zu Fäusten geballt, die Augen krampfhaft geschlossen. Ihr junges Gesicht war vor Schmerz verzerrt, das blonde Haar von Schweiß verklebt, Sie merkte nicht, daß der Arzt, gefolgt von Schwester Edith, das Zimmer betreten hatte.
Aber die Hebamme zeigte durch ihr spontanes Aufspringen, wie sehr sie auf ihn gewartet hatte. Sie kam Dr. Schumann entgegen: »Eine achtzehnjährige Erstgebärende am Termin«, berichtete sie hastig. »Die Wehen waren bis jetzt regelmäßig, die Fruchtblase ist vor einer halben Stunde gesprungen. Muttermund bis auf den Saum vollständig. Aber die kindlichen Herztöne sind seit zwei Wehenpausen schlecht. Wechselnd zwischen 80 bis 88 in der Minute …«
Mehr noch als diese nüchternen Worte verriet der Gesichtsausdruck der Hebamme große Sorge. Fräulein Lieselotte Mager war zweiunddreißig Jahre alt, arbeitete seit zehn Jahren als Hebamme und war bekannt dafür, daß sie wirklich nur im äußersten Notfall einen Arzt zu Hilfe rief.
»Die Patientin ist verkrampft«, sagte sie; »sie atmet nicht richtig. Ich habe alles versucht, aber sie stirbt fast vor Angst.«
»Keine Schwangerschaftsgymnastik?« fragte Dr. Schumann, doch es klang eher wie eine Feststellung.
»Sie hat ihren Zustand fast bis zuletzt verborgen gehalten«, flüsterte die Hebamme; »sie ist nicht verheiratet.«
»Noch nicht«, sagte Dr. Schumann, denn er kannte Evelyns Geschichte.
Evelyn Bauer war Oberschülerin, Tochter eines angesehenen Geschäftsmannes. Sie hatte sich in den Chauffeur ihres Vaters verliebt und zu ihm gehalten gegen den Widerstand ihrer Eltern auch dann noch, nachdem der junge Mann entlassen worden war. Weil der Vater mit Anzeige gegen ihren Freund drohte, hatte sie es nicht gewagt, die Wahrheit zu gestehen. Dann, als alles herauskam, zeigten sich die Eltern weit großzügiger, als Evelyn befürchtet hatte. Sie verziehen ihr und stimmten einer Heirat zu – erst aber sollte das Kind auf die Welt kommen.
Dr. Schumann beugte sich über den Leib der Erstgebärenden. Er legte das Stethoskop an und lauschte in einer der kurzen Wehenpausen. Die kindlichen Herztöne waren tatsächlich bedenklich verlangsamt.
»Becken hochlagern«, ordnete er an. »Sauerstoff …«
Mit geübten Griffen lagerten Fräulein Mager und Schwester Edith das Becken hoch, die Schwester hielt der Patientin die Sauerstoffmaske vor.
»Einen Handschuh, bitte!«
Die Hebamme hat den sterilen Gummihandschuh schon bereitgehalten. Sehr vorsichtig begann Dr. Schumann mit der vaginalen Untersuchung. Der Muttermund war jetzt nahezu vollständig geöffnet. Der Kopf des Kindes stand etwa in Beckenmitte. Es handelte sich um eine zweite Lage. Der Rücken des Kindes lag auf der rechten Seite.
Dr. Schumann streifte den Handschuh ab, richtete sich auf.
»Vorbereiten zur Zange!«
Schwester Edith verließ eilig das Entbindungszimmer. Noch einmal hörte Dr. Schumann die kindlichen Herztöne ab. Sie waren noch langsamer geworden.
»Du mußt jetzt atmen«, erläuterte die Hebamme, »tief atmen, Evelyn! Dein Kindchen braucht Sauerstoff!«
Der Körper der Patientin krampfte sich unter einer heftigen Wehe zusammen. Sie schrie auf. »Ich kann nicht … kann nicht mehr! O Gott, ich halte es nicht mehr aus!«
Dr. Schumann trat an das Kopfende. »Es geht um Ihr Kind, Evelyn«, sagte er, »um das Kind Ihrer Liebe! Sie dürfen es jetzt doch nicht im Stich lassen. Helfen Sie ihm!«
Zwei-, dreimal gelang es der Patientin, tief durchzuatmen; dann aber, bei der nächsten Schmerzwelle, schrie sie wieder: »Nein, nein, nein! Ich kann nicht mehr!«
Dr. Schumann und die Hebamme atmeten auf, als Schwester Edith mit einer Trage zurückkam. »Im OP ist alles bereit«, meldete sie.
»Gott sei Dank«, flüsterte Fräulein Liselotte erleichtert.
Die beiden Frauen betteten die Patientin auf die Trage um. Vom Eintreten des Oberarztes in das Entbindungszimmer bis zu diesem Augenblick waren knapp vier Minuten vergangen. Dr. Schumanns Indikation stand fest: Zange aus Beckenmitte wegen Verschlechterung der kindlichen Herztöne in der Austreibungsperiode.
Er eilte über den Gang in den gekachelten Waschraum, zog Jacke und Kittel aus, reinigte sich rasch unter fließendem Wasser die Hände. Schwester Edith kam aus dem OP, reichte ihm einen frischen hellgrünen Kittel, Handschuhe.
Als er in den Operationssaal trat, lag die Patientin im hellen schattenlosen Licht der Operationslampen. Ihr Stöhnen war leiser geworden, denn Dr. Leopold hatte ihr schon die erste Spritze gegeben.
»Narkose«, befahl Dr. Schumann.
Der Anästhesist begann mit der Einleitung – keinen Moment zu früh, denn das noch ungeborene Kind durfte auf keinen Fall geschädigt werden. Sekunden später war die Patientin eingeschlafen.
Mit sicheren Händen führte Dr. Schumann den ersten, dann den zweiten Zangenlöffel ein.
Schwester Bertha reichte ihm das Skalpell.
Dr. Schumann legte im Bereich des Dammes einen Schnitt an, eine sogenannte rechtslaterale Episiotomie. Dann begann er mit äußerster Behutsamkeit, rhythmisch an der Zange zu ziehen.
Es schien heiß im Operationssaal. Er spürte, wie ihm Schweiß auf die Stirn trat. In diesen Minuten war er Herr über Leben und Tod eines Menschen, und er war sich dessen bewußt. Ohne die Lippen zu bewegen, schickte er ein Stoßgebet zum Himmel.
Dann, ganz langsam, begann der Kopf des Babys sichtbar zu werden, das schwarze Haar, die kleine Fontanelle vorn.
Der Kopf schnitt durch, war geboren.
Dr. Schumann nahm die Zangenlöffel ab, begann mit beiden Händen erst die Schultern, dann den ganzen kleinen Körper zu entwickeln und hielt das Kind, einen kräftigen kleinen Jungen, während die Hebamme die Nabelschnur abklemmte und durchschnitt. Das Neugeborene war blau verfärbt, tat aber sofort seinen ersten Schnapper. Noch in den Händen des Arztes begann es kräftig zu schreien – ein jämmerliches, mißtönendes Babygeschrei, das dennoch Musik in den Ohren Dr. Schumanns war. Der Kopf des Kindes zeigte keine Quetschungen durch die Zange.
Die Hebamme strahlte, als sie es entgegennahm.
Dr. Schumann richtete sich hoch auf, reckte die Schultern, kostete eine Sekunde lang ein Siegesgefühl aus, beugte sich dann wieder über den Leib der Patientin, um die Plazenta herauszuziehen und den Uterus auf eventuelle Verletzungen zu überprüfen. Es war alles glatt gegangen.
Die Episiotomie mußte genäht werden. Während die eigentliche Extraktion des Kindes nur Minuten gedauert hatte, brauchte Dr. Schumann für diese Arbeit viel mehr Zeit.
Endlich war alles getan. Dr. Schumann dankte seinen Assistenten, ging hinaus, wusch sich die Hände und wechselte den Kittel. Dann trat er noch einmal in den Operationssaal.
Die junge Mutter war erwacht und betrachtete mit glücklichen Augen ihren kleinen Sohn, den ihr die Hebamme – gebadet und gewickelt – in die Arme gelegt hatte.
»Was für ein goldiges Kerlchen«, stammelte sie fassungslos; »mein Kind, unser Kind, ein Junge! Und ich habe gedacht, ich schaffe es nicht … ich hab’ wirklich gedacht …«
Ihre Augen füllten sich mit Tränen.
Dr. Schumann blickte auf sie herab. »Gratuliere!« sagte er herzlich. »Jetzt können Sie stolz sein …«
Sie sah zu ihm auf. »Stolz? Aber ich … ich habe mich doch schrecklich angestellt, nicht wahr? Entschuldigen Sie bitte, ich …«
»Ach was! Denken Sie doch so etwas nicht! Sie waren sehr tapfer.«
Schwester Edith trat von hinten an Dr. Schumann heran.
»Herr Oberarzt«, sagte sie; »bitte … wie lange dauert es noch?«
Er drehte sich um. »Ich bin hier fertig. Warum?«
»Ihre Gattin wartet auf Sie.«
»Meine Frau?« fragte Dr. Schumann. »Hat sie angerufen?«
Er konnte es nicht verhindern, daß seine Stimme ungläubig klang.
»Nein, sie ist hier. In der Klinik. Die Oberschwester hat sich erlaubt, sie in Ihr Arbeitszimmer zu führen.«
Oberarzt Dr. Rainer Schumann konnte sich nicht erinnern, daß seine Frau Astrid ihn jemals in der Klinik besucht hatte. Nun aber war sie zu ihm gekommen, wartete auf ihn, obwohl sie ihn in der Nacht zuvor Mörder genannt hatte und vor seiner Umarmung zurückgezuckt war. »Rühr mich nicht an, rühr mich nie wieder an!« hatte sie ihn angeschrien.
Er lief über den langen Klinikgang, bemerkte nicht den Gruß der Schwestern, Hebammen und Kollegen, die an ihm vorüberhasteten, dachte darüber nach, was dieser Besuch seiner Frau wohl zu bedeuten hatte. Wartete sie auf ihn, um sich zu versöhnen? War sie gekommen, um ihm zu sagen: „Es ist das beste, wenn wir uns trennen, unsere Ehe ist doch nur Quälerei?«
Dann stand er vor seinem Arbeitszimmer. Schon wollte er die Tür öffnen, zögerte aber noch einmal, zündete sich erst eine Zigarette an und nahm einige tiefe Züge, um sich zu beruhigen. Endlich trat er ein.
Astrid saß hinter seinem Schreibtisch. Sie blickte auf, mit einem seltsamen Ausdruck in den schönen tiefblauen Augen, den er nicht zu deuten wußte. Sie trug ein eng tailliertes schwarzes Kostüm, dessen tiefer spitzer Ausschnitt den Ansatz ihres Busens ahnen ließ. Er glaubte den Duft des kostbaren exotischen Parfüms, das sie zu benutzen pflegte, deutlich zu spüren.
»Du scheinst nicht sehr erfreut«, sagte sie, den Blick unverwandt auf ihn gerichtet.
Er trat näher zum Schreibtisch und streifte die Asche seiner Zigarette ab. »Warum bist du gekommen?« fragte er.
»Ich wollte dich sehen«, erwiderte sie einfach.
Sie erhob sich und kam hinter dem Schreibtisch hervor. Ganz nahe stand sie vor ihrem Mann. Er brauchte nur die Hand auszustrecken, um sie zu berühren. Er tat es nicht.
»Rainer«, sagte sie leise, und in ihrer Stimme war jener heisere rauhe Klang, der ihn – wie immer – erregte.
Er schob die linke Hand in die Hosentasche, seine Finger umkrampften das kalte Metall seines Schlüsselbundes.
Sie hatte es sich nicht so schwer vorgestellt. Dieser Mann im weißen Arztkittel mit dem verschlossenen, angespannten Gesicht – er schien ihr seltsam fremd und fern.
»Rainer«, wiederholte sie, »ich …« Plötzlich durchzuckte sie jähe Angst. Kam ihr Versöhnungsversuch zu spät? Hatte er sich innerlich schon von ihr abgewandt? Gab es eine andere in seinem Leben?
Fast unbewußt hob sie die Hände, packte ihn bei den Schultern. »Mein Gott«, sagte sie heftig, »sei doch nicht so unerbittlich! Was habe ich denn getan, daß du mir nicht verzeihen kannst? Ja, ich weiß, ich habe dich beleidigt, aber ich … ich wußte gestern nacht nicht mehr, was ich sagte! Ich war so aufgeregt, ganz durcheinander! Ich habe es doch nicht so gemeint!«
Er umschloß ihre Handgelenke und drückte ihre Arme mit sanfter Gewalt nach unten: »Doch, Astrid«, sagte er. »Versuche nicht, mir etwas vorzumachen. Dadurch wird es nicht besser. Du warst hysterisch, stimmt. Aber alles, was du mir vorgeworfen hast, kam aus deinem tiefsten Herzen.«
»Nein, Rainer, nein …« Sie bemühte sich, ihre Hände aus seinem Griff zu befreien. »Bitte, laß mich los, du tust mir weh.«
»Entschuldige!« Er löste seine Hände von ihren Armen und trat einen Schritt zurück.
Sie standen einander gegenüber und vermochten nicht einmal mehr, sich anzusehen. Das Gespräch war auf dem toten Punkt. Beinahe hatte Astrid, einem Impuls folgend, sich umgedreht und wäre aus dem Zimmer gelaufen. Aber sie wollte nicht aufgeben, sie durfte es nicht. Sie begriff, daß sie ihn dann für immer verlieren würde.
»Ich weiß, daß ich viele Fehler habe«, sagte sie. »Ich habe niemals behauptet, ein Engel zu sein. Aber bist du denn ohne Schuld? Du hast doch von Anfang an gewußt, daß ich an deinem Beruf wenig interessiert bin. Ich habe niemals Begeisterung für das Kinderkriegen geheuchelt. Ich habe Angst davor, ja … aber das wußtest du doch, ehe wir uns verlobten. Warum hast du mich dann trotzdem genommen?«
»Weil ich dich liebte …«
»Und jetzt … liebst du mich nicht mehr?«
»Was hat das alles für einen Sinn, Astrid?« Die Zigarette war herabgebrannt. Die Glut berührte seine Fingerspitzen. Er ließ den Stummel auf den abgetretenen Teppich fallen und trat ihn mit dem Absatz aus. »Meine Liebe hat dir ja nie viel bedeutet … Anfangs war ich ganz sicher, du würdest dich ändern. Ich wollte die Hoffnung nicht aufgeben, bis … nun, du wirst zugeben, daß du neulich in der Nacht sehr deutlich warst. Bitte, komm mir jetzt nicht wieder damit, ich müßte Geduld mit dir haben, Rücksicht auf dich nehmen. Denke doch an die vergangenen Jahre unserer Ehe, an die Tage und Nächte. Denk daran, wie oft ich Rücksicht genommen und verzichtet habe … und was ist dabei herausgekommen?«
»Verzeih mir«, sagte sie schwach.
»Ich bin dir nicht böse …«
Sie versuchte zu lächeln. »Du hast jetzt alles gesagt, was du gegen mich auf dem Herzen hattest. Darf ich dir nun endlich erklären, warum ich gekommen bin?«
Er nickte.
»Weil ich dich liebe«, sagte sie. »Weil ich es nicht ertragen könnte, dich zu verlieren. Ich habe eingesehen … ja, ich habe wirklich eingesehen, daß alles falsch war. Daß sich so keine Ehe führen läßt … und ich wollte dich bitten, es noch einmal mit mir zu versuchen, alles zu vergessen.«
Sie hob mit einer unendlich rührenden Geste die Hände, und er sah die roten Streifen, die sein Griff an ihren Handgelenken hinterlassen hatte. »Rainer, laß uns noch einmal ganz von vorn anfangen. Ich will mich ändern, ich verspreche es dir … ich habe mich schon geändert!«
Er trat einen Schritt auf sie zu. »Astrid, ist das wirklich wahr?«
Sie warf sich in seine Arme, »Bitte«, flehte sie, »bitte, glaub es mir. Du mußt nur ein wenig Geduld mit mir haben?«
Er umschloß sie ganz fest und spürte, wie seine innere Anspannung sich endlich löste, einem alles überflutenden Glücksgefühl wich. »Und wenn wir ein Kind bekämen?«
»Ich habe Angst, immer noch Angst«, flüsterte sie, »aber ich werde es überwinden … ich werde mich freuen. Um deinetwillen. Um unserer Liebe willen. Ach, Rainer …«
Sie hob ihr blasses Gesicht zu ihm auf, er küßte ihr die Tränen aus den Augenwinkeln, ihre Lippen fanden sich. Noch nie hatte sie seine Leidenschaft so vorbehaltlos erwidert.
Endlich löste er sich von ihr, atemlos und fast schwindelig.
»Und nun, Astrid, werde ich dir meine Kinder zeigen!«
Er nahm sie bei der Hand und führte sie aus dem Zimmer.
Es war kurz vor der vierten Trinkzeit des Tages. Die Schwestern eilten im großen Säuglingssaal geschäftig hin und her, nahmen die Neugeborenen aus ihren Bettchen und packten sie auf flache Wagen. Ohrenbetäubendes Geschrei erfüllte die Luft.
Astrid Schumann hätte sich am liebsten die Ohren zugehalten, aber sie beherrschte sich, um ihren Mann nicht zu kränken. Sie fühlte sich unbehaglich in dem viel zu weiten Kittel, den er ihr geliehen hatte, und kam sich fehl am Platz vor. Sie glaubte aus den neugierigen Seitenblicken der Schwestern Mißtrauen und Ablehnung zu lesen.
Dr. Schumann spürte nichts von der Beklemmung seiner Frau. »Na, nun sag selber«, forderte er sie auf, so stolz und zufrieden, als ob er persönlich der Schöpfer all dieses brüllenden, strampelnden Lebens wäre, »ist das nicht etwas Wunderbares?«
Astrid zwang sich zu einem Lächeln. »Schreien sie immer so?« fragte sie.
Er lachte. »Nein. Nur jetzt, weil sie Hunger haben. Die Energischen fordern ihre Nahrung, und die anderen brüllen zur Gesellschaft mit … wenn sie ins Bettchen zurückgebracht werden, sind sie wieder ganz friedlich.« Er wandte sich an eine der Schwestern, die in ihrer Nähe wieder einen Wagen vollgepackt hatte.
»Nicht wahr, Schwester Rosa?«
»Die meisten«, erwiderte die Schwester. »Nur Mäxchen kann nie genug haben, und auch die kleine Großfuß müssen wir nachfüttern. Ihre Mutter hat kaum etwas.« Sie sagte es in einem Ton, der ihre Bewunderung für das immer hungrige Mäxchen und ihr Mitleid für die unglückliche Frau Großfuß, die ihr Kind nicht ausreichend nähren konnte, deutlich machte.
Astrid schauderte leicht. »Können Sie alle die Babys so ohne weiteres auseinanderhalten?« fragte sie. »Sie sehen doch alle gleich aus!«
Schwester Rosa gab Astrid mit einem einzigen Blick zu verstehen, was sie von einer solchen Laienfrage hielt, und Dr. Schumann antwortete rasch an ihrer Stelle: »Erstens sehen sie nicht gleich aus, Astrid, das kommt dir nur so vor, und außerdem ist jedes Kind eine kleine Persönlichkeit … Unsere Schwestern schwören darauf, daß schon bei den Neugeborenen die Grundzüge des Charakters deutlich werden. Es gibt lebhafte Neugeborene und auffallend stille; quengelige und geduldige; zornige und heitere. Eine unserer Nachtschwestern behauptet zum Beispiel, daß sie allein am Ton des Geschreis erkennen kann, wer aufgewacht ist, noch bevor sie nach dem Rechten gesehen hat …«
»Wirklich?« fragte Astrid ungläubig. »Aber …«
Dr. Schuhmann zog sie mit sich tiefer in den Saal hinein.
»Du hast natürlich ganz recht. Wir verlassen uns nicht auf unsere Babykenntnisse. Das wäre ja auch unmöglich, weil wir zeitweilig über hundert Neugeborene hier haben und es täglich Ab- und Zugänge gibt. Siehst du diese Schleifchen an den Bettchen?«
»Ja«, sagte Astrid, »sie sind sehr hübsch.«
»Sie dienen nicht der Verschönerung, sondern der Unterscheidung. Jedes Bett, in dem ein Junge liegt, hat ein blaues, jedes Mädchenbett ein rosa Schleifchen.« Er blieb stehen, nahm einer Schwester ein Neugeborenes aus dem Arm und streifte den linken Ärmel ein wenig hoch. »Und sieh mal hier! Ein blaues Bändchen mit der Nummer 47 … weißt du, was das bedeutet? Diese Nummer schließt jede Verwechslung aus. Mutter und Kind bekommen sofort nach der Geburt solch ein Bändchen mit einer gleichlautenden Nummer ums Handgelenk.«
Er gab der Schwester das jämmerlich ziepende Kind zurück. »Schon gut, schon gut, mein Kerlchen, bekommst ja gleich etwas zu essen!« sagte er tröstend.
Der Saal hatte sich inzwischen fast geleert, das Geschrei hallte draußen über die Gänge. Einige Schwestern begannen die Bettchen zu richten und die Fenster zu öffnen.
Dr. Schumann sah sich um. »Schade«, sagte er, »wir kommen in einem ungünstigen Moment. Wir hätten zur Badezeit kommen sollen, dann ist es natürlich viel lustiger.«
»Und der kleine Overhoff?« fragte Astrid mit Überwindung. »Wo ist der?«
»Oben auf der Privatstation. Möchtest du ihn sehen?« Astrid bereute schon ihre Frage. Sie hätte am liebsten gesagt, daß ihr Bedarf an Babys für diesen Tag reichlich gedeckt sei. Nur um ihren Mann nicht zu enttäuschen, nickte sie.
Erst als sie draußen auf dem Gang waren, sagte sie zaghaft:
»Aber dann, Rainer, gehen wir doch nach Hause?«
Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr. »Natürlich, Liebling, ich habe sowieso eigentlich schon dienstfrei.«
»Wäre es dann nicht besser, wenn wir …«
Er lächelte sie an. »Es dauert ja nur fünf Minuten, und ich muß sowieso noch übergeben.«
Während sie im Lift zur Privatstation fuhren, erzählte er ihr von seiner Sorge um ein Neugeborenes mit einer allzu heftigen Gelbsucht und von dem Vorschlag Frau Dr. Holgers, den kleinen Overhoff bei einer anderen jungen Mutter trinken zu lassen. Aber sie hörte kaum, was er sagte, lauschte nur dem warmen Klang seiner Stimme, war dankbar, daß sie ihm so nahe sein durfte – und vergaß keinen Augenblick, daß dieses Glück auf einer Lüge aufgebaut war.
Auf dem breiten, lichtüberfluteten Gang der Privatstation kam ihnen Schwester Patrizia entgegen. Das Häubchen saß ihr wie immer ein wenig schief auf den blonden Locken, aber der Griff, mit dem sie ein schreiendes Neugeborenes umfaßt hielt, war sehr sicher, fast mütterlich.
»Hallo, da ist er ja!« rief Dr. Schumann und faßte Astrid beim Arm. »Da kannst du ihn dir gleich ansehen, Liebling!« Der kleine Overhoff schrie mit rotem Kopf, den zahnlosen Mund weit aufgerissen. Er unterschied sich in Astrids Augen durch nichts von all den anderen Babys, die sie bisher schon hatte begutachten müssen, abgesehen davon, daß er vielleicht noch lauter, noch zorniger brüllte.
»Eine tolle Stimme hat er«, sagte sie gezwungen.
Schwester Patrizia strahlte. »Nicht wahr? Eine wunderbare Lunge!« Sie war bei der Begegnung mit dem Oberarzt und seiner Frau leicht errötet. »Ich bringe ihn eben nach unten, die Frau Doktor hat angerufen. Frau Elfie Peters hat sich bereit erklärt, ihn zu nähren.«
»Ausgezeichnet«, sagte Dr. Schumann erfreut. »Eine sehr gute Lösung. Wir müssen nur überlegen, ob es nicht besser wäre, ihn dann überhaupt unten zu lassen …«
»O nein!« rief Schwester Patrizia impulsiv und zog das Kind noch fester an sich. »Sie dürfen ihn uns nicht wegnehmen, Herr Doktor!«
Die lebensfrohe, hübsche Schwester bot ein reizendes Bild, wie sie mit erschrockenen Augen das Kind an ihr Herz drückte, als ob sie fürchtete, man könnte es ihr auf der Stelle rauben – ein wirklich zauberhaftes Bild; aber in Astrid stieg der Verdacht auf, daß sich Schwester Patrizia dessen voll bewußt war.
»Es wird Ihnen zusätzliche Arbeit bringen«, sagte Dr. Schumann.
»Das macht nichts!« rief Schwester Patrizia. »Hier oben können wir uns viel besser um ihn kümmern!«
›Du Schlange!‹ dachte Astrid, und ihre Antipathie gegen die Schwester wuchs.
Dr. Schumann und Schwester Patrizia wechselten noch ein paar rasche Worte über den kleinen Weyrer und dessen verdächtige Gelbsucht. Astrid fühlte sich während dieses Gesprächs seltsam ausgeschlossen. Sie war froh, als ihr Mann die Schwester verabschiedete und sich wieder ihr zuwandte.
»Was hast du, Liebling?« fragte er. »Du bist ja ganz blaß? Irgend etwas nicht in Ordnung?«
»O doch, nur …« Sie lächelte schwach. »Vielleicht habe ich mich einfach überfreut.«
»Ich weiß, was dich wieder auf die Beine bringen wird«, sagte er und legte seinen Arm um ihre Schultern. »Eine Flasche Champagner … wie wäre es damit? Ich habe eine Idee. Wir gehen jetzt nach Hause, ziehen uns um …« Er berichtigte sich sogleich: »Unsinn, das brauchst du nicht. Ich kann so bleiben, wie ich bin, und du bist immer schön. Wir fahren ins ›Chalet‹, essen ganz delikat zu Abend, trinken eine Flasche Sekt dazu, und nachher gehen wir noch ein bißchen tanzen! Na, wie wär’s?«
»Wunderbar«, sagte sie ehrlich.
»Na also … dann komm!«
Sie faßten sich bei den Händen und gingen dahin wie Kinder, die unerwartet schulfrei bekommen haben. Aber sie hatten kaum den Lift erreicht, als jemand hinter ihnen herlief. Sie drehten sich um und sahen Oberschwester Helga.
»Herr Doktor«, rief sie atemlos, »wie gut, daß ich Sie noch erreicht habe …« Sie unterbrach sich. »Guten Abend, gnädige Frau!«
»Was gibt’s?« fragte Dr. Schumann kurz angebunden.
»Der Labortest ist eben durchgegeben worden. Es handelt sich um den kleinen Weyrer: Erythroblastose!«
»Verdammt!« entfuhr es Dr. Schumann. Er warf einen raschen Blick auf seine Frau. »Entschuldige bitte, Astrid!«
»Frau Dr. Holger hat schon alles zum Blutaustausch vorbereiten lassen …«
»Schön! Dann benachrichtigen Sie sofort Dr. Gerber. Sie wissen ja, ich bin eigentlich nicht mehr im Dienst.«
»Dr. Gerber ist bei einer Operation.«
»Und Professor Overhoff?«
Die Oberschwester zuckte stumm die Achseln.
»Pech«, sagte Dr. Schumann. Er wandte sich an seine Frau.
»Ich kann dir nicht sagen, wie leid mir das tut. Aber eigentlich immer noch besser, als wenn sie mich mitten aus unserem festlichen Dinner abberufen hätten, wie?«
Astrid schluckte. »Bestimmt«, flüsterte sie tapfer.
»Also: Du gehst jetzt nach Hause, Astrid, und wartest auf mich. Du hast keinen Grund, traurig zu sein. Versprochen ist versprochen … wir gehen heute abend noch aus.« Er küßte seine Frau flüchtig und eilte mit Oberschwester Helga davon. Astrid stand mit hängenden Armen und sah ihm nach. Es dauerte eine ganze Weile, bis sie sich wieder gefaßt hatte. Dann streifte sie langsam den Arztkittel ihres Mannes ab, betrachtete ihn gedankenverloren.
Sie legte den Kittel achtlos auf die Fensterbank, drehte sich um und ging mit müden Schritten die Treppe hinab.
Das Neugeborene war in das Untersuchungszimmer von Frau Dr. Holger gebracht worden. Es lag auf dem Tisch und gab keinen Laut von sich, während die Ärztin behutsam den Bauch abtastete.
Sie blickte kurz zur Tür, als Dr. Schumann eintrat.
»Milz und Leber sind erheblich vergrößert«, sagte sie. Dr. Schumann trat näher, sah mit besorgten Blicken auf das nackte kleine Wesen, dessen gelb-bräunliche Verfärbung inzwischen noch stärker geworden war.
»Der Coombs-Test ist positiv?«
»Ja, Bilirubin im Blut, 20 Milligrammprozent.«
»Ist die Blutgruppe bestimmt worden?«
»Im Labor wird bereits die Kreuzprobe gemacht.«
»Ausgezeichnet«, sagte Dr. Schumann. »Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als zu warten.« Es war eine Erfahrungstatsache, daß eine Kreuzprobe, bei der die Verträglichkeit des Spenderblutes mit dem Blut des Empfängers getestet wurde, nicht unter dreißig Minuten durchzuführen war.
Er untersuchte das Kind noch einmal. »An der Diagnose besteht kein Zweifel.« Dr. Schumann sah die Schwester an, die neben dem Untersuchungstisch stand. »Bitte, den Nabelverband, Schwester, und ziehen Sie das Kind wieder an. Sie können es inzwischen in den kleinen OP bringen. Sorgen Sie für Wärmflaschen!«
»Jawohl, Herr Doktor.«
»Sollten wir nicht der Mutter Bescheid sagen?« fragte Frau Dr. Holger leise.
»Lieber wäre es mir, wir könnten den Vater erreichen. Ich beunruhige eine Frau, die eben eine Geburt hinter sich gebracht hat, nicht gern.«
Eine halbe Stunde später war es soweit. Winzig und nackt lag das Neugeborene im hellen Licht der Operationslampe, von Wärmflaschen umgeben. Es hatte nicht die leiseste instinktive Ahnung von der tödlichen Gefahr, in der es schwebte, und saugte selbstverloren an einem Schnuller, den Schwester Edith ihm in den Mund gesteckt hatte.
Dr. Schumann wusch sich inzwischen draußen im Vorraum die Hände, gründlich, wie zu einer großen Operation. Er hatte mit Herrn Weyrer, einem Bankkaufmann, telefoniert. Er hatte seine Worte vorsichtig gewählt, um dem jungen Vater keinen Schock zu versetzen.
Frau Dr. Holger befand sich schon im Operationssaal und überwachte die letzten Vorbereitungen. Eine junge Schwester half Dr. Schumann in den grünen Operationskittel, reichte ihm die Gummihandschuhe. Das Kleine lag immer noch friedlich, mit geschlossenen Augen. Man hätte glauben können, es schliefe – wären nicht die Saugbewegungen des Mündchens gewesen.
»Desinfizieren«, befahl Dr. Schumann kurz.
Schwester Edith bestrich das Gebiet um den Nabel sorgfältig mit Sepso-Tinktur, deckte den nackten Körper des Kindes bis auf das Operationsgebiet mit sterilen Tüchern ab. Dann reichte sie Dr. Schumann das Skalpell.
Vorsichtig schnitt der Arzt ein Stückchen des Nabelschnurrestes ab. Die Nabelblutgefäße waren deutlich zu sehen. Sehr zart und behutsam schob er den Kunststoff-Katheter durch die Nabelvene in den Körper des Kindes. Plötzlich schoß Blut heraus. Die Spitze des Katheters war bis in die große Nabelvene vorgedrungen.
»Vetren!«
Die Schwester gab ihm die Spritze mit Vetren, einem Präparat, das die Blutgerinnungsfähigkeit vorübergehend herabsetzt. Er injizierte es durch den Katheter. Als er 4 ccm gespritzt hatte, gab Frau Dr. Holger der Schwester ein Zeichen. Schwester Edith reichte Dr. Schumann das Anschlußstück der Dreiwegehahnspritze. Er setzte es auf den Katheter, befestigte es mit Fäden, schloß die Rotandaspritze an.
Der eine Schlauch dieser Spritze, die drei verschiedene Zu- beziehungsweise Abgänge hatte, wurde von Schwester Edith an einen hochhängenden Glasbehälter, in dem sich das Spenderblut befand, angeschlossen.
Nun erst konnte der eigentliche Blutaustausch beginnen. Ganz langsam ließ Dr. Schumann 20 ccm Blut durch den Katheter einfließen, schaltete um und zog 20 ccm des kranken Blutes aus der Vene des Kindes heraus, das in einem anderen Glasgefäß aufgefangen wurde. 800 ccm mußten auf diese Art ausgetauscht werden.
»Wie geht es dem Kleinen?« fragte er von Zeit zu Zeit.
»Gut«, erwiderte Frau Dr. Holger. »Es saugt am Schnuller. Atmung und Puls normal.«
Unendlich langsam vergingen die Minuten. Nach ein und einer halben Stunde war über die Hälfte des Blutes ausgetauscht. In dieser Zeit hatte Frau Dr. Holger dreimal Calcium gespritzt.
Plötzlich sagte Schwester Edith erschreckt: »Das Kind atmet nicht mehr richtig!«
Dr. Schumann warf einen raschen Blick auf das Gesicht des Kleinen, das halb von den Tüchern verdeckt war. Es hatte sich bläulich verfärbt.
»Lobelin!« befahl er. »Ein Kubikzentimeter!«
Mit geübten Händen zog Schwester Edith die Spritze auf, Frau Dr. Holger nahm sie ihr aus der Hand, spritzte den Inhalt in den Arm des Kindes. Ein paar bange Sekunden lang schien jede Wirkung auszubleiben. Dann ging die bläuliche Verfärbung zurück, die Haut des Kleinen war auch nicht mehr so dunkelgelb wie zu Anfang, sondern hatte einen rosigen Schimmer angenommen.
Dr. Schumann atmete auf.
Eine Stunde später war der Kampf um dieses fast schon verlorene junge Leben gewonnen.
Dr. Schumann nahm die Dreiwegehahnspritze vom Katheter ab, als Dr. Gerber das Operationszimmer betrat.
»Hallo«, grüßte er, »Ablösung erwünscht?«
»Nicht mehr«, erwiderte Dr. Schumann, ohne die Augen von seiner Arbeit zu heben, »wir haben es schon geschafft.«
»Schönes Gefühl, wie?« Dr. Gerber rieb sich die Hände. »Langsam mußt du dich ja für den lieben Gott persönlich halten.«
»Nicht ganz«, sagte Dr. Schumann. Er zog mit äußerster Vorsicht die Hohlnadel aus der Bauchvene des Kindes. »Ich hätte dir diesen Eingriff liebend gern überlassen, Kollege. Ich hatte heute abend eigentlich etwas Besseres vor.«
»Ärzteschicksal«, erklärte Dr. Gerber nicht ohne leise Genugtuung. Er folgte Dr. Schumann, der die weitere Versorgung des Kindes der Ärztin und den Schwestern überließ, in den Waschraum.
Dr. Schumann hatte beide Hähne über dem Waschbekken aufgedreht und ließ sich das heiße Wasser über die Hände laufen.
»Warum hast du das Unglückswürmchen nicht zur Kinderklinik überweisen lassen?«
»Du weißt doch, wie die drüben sind … die hätten sich bestimmt nicht auf unsere Laboruntersuchungen verlassen, sondern neue angefertigt und mindestens eine Stunde Zeit verloren. Das konnte ich nicht riskieren.«
»Verstehe.« Dr. Gerber stand gegen das Waschbecken gelehnt und sah an Dr. Schumann vorbei. »Sag mal, hast du heute mit dem Alten gesprochen?«
»Ja.«
»Na und? Was hattest du für einen Eindruck von ihm?«
»Es hat ihn sehr mitgenommen.«
»Wenn du ihn auf dem Friedhof gesehen hättest …«
Dr. Schumann schlüpfte aus seinem Kittel, warf ihn zu Boden, krempelte sich die Hemdsärmel herunter, zog sich die Jacke an.
»Armer alter Knabe«, sagte Dr. Gerber. »Warum sitzt er hier herum? Zur Arbeit ist er im Augenblick ja doch nicht zu gebrauchen. Ich an seiner Stelle nähme mir jetzt erst einmal einen Urlaub.«
»Wo soll er denn hin?« Dr. Schumann rückte sich vor dem Spiegel die Krawatte gerade und fuhr sich mit der Hand glättend über das dichte braune Haar. »Nach Hause etwa? Das ist wahrscheinlich mehr, als er vertragen kann.«
»Tja, er kann einem fast leid tun.«
»Fast? Mir tut er leid!« Dr. Schumann steckte sich eine Zigarette zwischen die Lippen, Dr. Gerber reichte ihm Feuer.
»Obwohl es seine ureigene Schuld war?« fragte er. »Obwohl er bei der Konstitution seiner Frau befürchten mußte, daß sie die Operation nicht übersteht? Obwohl eine medizinische Indikation für die Schwangerschaftsunterbrechung durchaus gegeben gewesen wäre?«
Dr. Schumann zuckte die Achseln. »Nun laß doch«, wehrte er ab, »dieses Thema haben wir inzwischen schon zu Tode geritten.«
»Ich will dir doch nur klarmachen«, sagte Dr. Gerber und begleitete ihn zur Tür, »daß ich … so tragisch die Sache natürlich ist … diesen Schock geradezu für heilsam halte. Wenn der Alte nicht ganz in Selbstgerechtigkeit versteinert ist, muß der Tod seiner Frau ihn wachrütteln!«
Nach einer kleinen Pause, während der sie schweigend durch den jetzt nur noch spärlich beleuchteten Gang gingen, fügte Dr. Gerber hinzu: »Und dich auch!«
Dr. Schumann blieb stehen, rief ärgerlich: »Sag mal, was willst du eigentlich von mir? Ich habe einen verdammt anstrengenden Tag hinter mir! Vielleicht erinnerst du dich daran, daß ich seit heute früh im Dienst bin. Eigentlich könntest du ruhig ein bißchen Verständnis zeigen, statt mich mit unbegründeten Anschuldigungen zu bewerfen!«
Aber Dr. Gerber gab nicht nach. »Was ich dir klarmachen will … und ich werde das nicht aufgeben, bis du mich eines Besseren belehrt hast … ist doch einfach: Wir sind Frauenärzte. Wir können unser Berufsziel nicht einzig und allein darin sehen, Kindern auf die Welt zu helfen, sondern wir müssen den Frauen selber helfen! Begreifst du das denn nicht?«
»Ich tue nichts anderes.«
»Das sagst du! Aber tatsächlich stehst du doch immer auf seiten der ungeborenen Kinder gegen die Mütter!«
»Soll ich mich etwa auf seiten der Mütter gegen die ungeborenen Kinder stellen? Das ist doch Quatsch, Erich. Eine Mutter und ihr ungeborenes Kind sind doch eine Einheit. So sollte es wenigstens sein.«
»Und wenn es nicht so ist? Wenn die Mutter das Kind nicht haben will?«
»So muß man sie dahin bringen, es zu wollen.«
»Sehr einfach. Aber ich sage dir, Rainer, unsere Arbeit muß viel früher einsetzen. Wir mussen mehr Gewicht darauf legen, die jungen Mädchen aufzuklären und auch die verheirateten Frauen. Wir müssen erreichen, daß nur noch heißerwünschte Kinder zur Welt kommen. Wir müssen die Frauen von ihrer Angst, ihrer verzweifelten Sorge befreien, wir müssen sie von ihrem biologischen Schicksal erlösen!« Dr. Gerber hatte sich in Fahrt geredet. »Und wir sollten auch nicht zu viele Bedenken haben, eine unerwünschte Schwangerschaft zu unterbrechen, wenn nur der entfernteste Anlaß zu einer medizinischen Indikation gegeben ist!«
»Wenn du wirklich so denkst«, sagte Dr. Schumann hart, »würde ich dir raten, die Klinik zu verlassen und eine Privatpraxis zu eröffnen … als Abtreibearzt!« Er bereute dieses Wort im gleichen Moment, da es ausgesprochen war – aber es war zu spät.
»Das war sehr deutlich«, bemerkte Dr. Gerber eisig.
»Ich glaube, die Fronten sind jetzt geklärt!«
Er drehte sich auf dem Absatz um und ging.
Dr. Rainer Schumann lief, wie immer, den kurzen Weg aus dem Klinikviertel bis zu dem kleinen Haus, das er gemietet hatte, zu Fuß. Die frische Abendluft tat ihm wohl und kühlte seine brennenden Schläfen.
Er war sehr unzufrieden mit sich. Diese Auseinandersetzung mit Gerber erschien ihm jetzt gänzlich unnötig. Zwischen ihm und Gerber bestand seit frühesten gemeinsamen Studienjahren eine gute Kameradschaft, die sich schon mehr als einmal bewährt hatte. Es war unverzeihlich, daß er diese Männerfreundschaft durch einen einzigen unüberlegten Satz zerstört hatte.
Und dann Astrid! Er versuchte, sich auf das Heimkommen zu freuen, aber er brachte es beim besten Willen nicht fertig. Bestimmt war sie wieder tief gekränkt und enttäuscht, weil sie stundenlang auf ihn hatte warten müssen. Es war nicht seine Schuld, gewiß nicht, aber was nutzte das – es schien aussichtslos, ihr die Zusammenhänge zu erklären. Er fand es zermürbend, immer wieder um die Liebe und das Verständnis seiner eigenen Frau kämpfen zu müssen, sogar in Situationen, in denen er selber Trost oder wenigstens einen Zuspruch sehr nötig gehabt hätte. Sicher würde er auch jetzt wieder eine Szene über sich ergehen lassen müssen.
Er seufzte, ohne sich dessen bewußt zu werden, tief auf, als er die Haustür aufschloß, und machte sich innerlich auf das Schlimmste gefaßt.
Aber Astrid empfing ihn ganz anders, als er erwartet hatte. Sie lag in einem weißseidenen, spitzenbesetzten Hausmantel auf der Couch im Wohnzimmer, erhob sich jedoch sofort, als er eintrat, und kam ihm lächelnd entgegen.
»Rainer«, rief sie, »endlich!« Die Ärmel des Hausmantels glitten zurück, als sie ihre Arme um seinen Nacken schlang.
Ihm war, als sei er mit einem Schritt aus dem grauen Alltag in ein Zauberreich getreten. Er küßte ihren Mund, ihren Hals, ihren zarten weißen Nacken. »Es ist doch wieder spät geworden«, sagte er.
Sie stemmte lächelnd ihre Hände gegen seine Brust und sah zu ihm auf: »Als ob ich nicht wüßte, daß du nur deine Pflicht getan hast!« Sie wandte sich ab, trat zum Kamin, in dem Feuer knisterte. »Ist es gut ausgegangen?« fragte sie. »Hast du das Kindchen retten können?«
»Ja«, sagte er, »Gott sei Dank!«
»Und die Mutter? War sie sehr glücklich?«
Er schüttelte den Kopf. »Sie hat nichts davon gewußt. Ich wollte sie nicht beunruhigen.«
Plötzlich wurde ihr erst die ganze Tragweite des Geschehens bewußt. »Aber dann«, sagte sie erschrocken, »wenn …«
»Denk nicht darüber nach! Es ist ja gut gegangen.«
Er sah sie an, ihre schlanke Gestalt, die unter dem weißseidenen Mantel nur zu ahnen war, den stolzen kleinen Kopf mit dem kastanienbraunen Haar, in das vom Kaminfeuer rötliche Reflexe gezaubert wurden. »Nur unser schöner Abend ist uns verdorben!«
Sie lächelte ihm zu. »Er fängt jetzt an!« Sie trat zum Tisch, zog eine Flasche Sekt aus einem eisgefüllten Kübel. »Du wolltest doch heute Champagner trinken … habe ich es richtig gemacht?«
Er nahm ihr die Flasche aus der Hand, löste geschickt den Korken und schenkte ein.
»Auf uns!« sagte sie und hob ihm ihr Glas entgegen.
Er leerte es mit einem Zug. »Weißt du, wie schön du bist?« Eine zarte Röte überflutete ihr schmales Gesicht. Sie hob den Kopf, wollte etwas sagen. Aber er hatte sie schon in die Arme genommen und verschloß ihren Mund mit seinen Küssen. Noch nie hatte sie sich so an ihn geschmiegt, noch nie seine Leidenschaft mit solcher Glut erwidert.
»Astrid«, flüsterte er atemlos, »du hast keine Angst mehr davor …?«
»Nie mehr!«
Er hob sie auf die Arme und trug sie zur Couch. Knisternd loderte das Feuer.