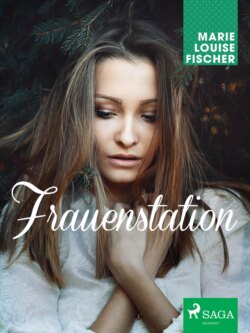Читать книгу Frauenstation - Marie Louise Fischer - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеAls Dr. Rainer Schumann nach Hause kam, war es zwei Uhr vorbei. Erleichtert stellte er fest, daß das Haus im Dunkel lag. Die Party war vorüber.
Er schloß die Haustür auf, so lautlos wie möglich, hängte seinen Mantel in die Garderobe und stieg auf Zehenspitzen die Treppe hinauf. Sein Gang war nicht mehr ganz sicher, denn er hatte zusammen mit seinem Kollegen eine volle Flasche Kognak geleert. Aber der Alkohol hatte nicht vermocht, seine bohrenden Gedanken zu beruhigen.
Er ging ins Bad, stellte fest, daß die Verbindungstür zum Schlafzimmer seiner Frau nur angelehnt war und wollte sie sacht ins Schloß ziehen.
Aber Astrid hatte ihn schon gehört. »Rainer!« rief sie, und ihre Stimme klang sehr wach.
Wohl oder übel mußte er eintreten.
Astrid hatte das Nachttischlämpchen angeknipst. Sie lag in den weißen Kissen, verführerisch schön. Das Dekolleté ihres zartblauen Nachthemdes war verrutscht, ihre schlanken, glatten Arme waren bloß, ihr Haar leicht zerzaust.
»Du kommst spät«, sagte sie kühl.
»Ja, ich weiß …« Er fuhr sich mit der Hand über die Stirn. »Entschuldige, bitte, ich …« Er trat näher.
»Du hast getrunken«, stellte sie sehr sachlich fest.
»Ja.«
»Gab es einen Anlaß zu feiern?«
»Ich verstehe nicht«, sagte er unbehaglich, obwohl er sie nur zu gut verstand.
»Ist Susanne glücklich? Hat sie endlich ihren heißersehnten Sohn?« fragte Astrid spöttisch.
Dr. Schumann mußte sich räuspern. »Ja. Es ist ein Junge.«
»Und Susanne?«
Er antwortete nicht sofort, und plötzlich begriff sie alles.
Sie setzte sich mit einem Ruck steil in den Kissen auf, ihre Augen flammten. »Mörder!« schrie sie. »Du Mörder!«
Oberarzt Dr. Rainer Schumann zuckte zusammen wie unter einem Schlag. Dennoch klang seine Stimme fast kalt, als er erwiderte: »Astrid, du tust mir unrecht. Ich habe alles getan, was in meiner Kraft stand, um Susannes Leben zu retten. Mich trifft keine Schuld.«
Sie sah nicht, daß er die Hände zu Fäusten geballt, die Nägel in die Handflächen gebohrt hatte, um seine Beherrschung nicht zu verlieren. Seine Ruhe, die sie für Gleichgültigkeit hielt, machte sie rasend.
»Grausam bist du!« schrie sie. »Gemein! Du und dein Professor … ihr beide habt sie auf dem Gewissen …«
Er ertrug es nicht länger. »Du weißt nicht, was du redest! Es war Susanne Overhoffs freier Wille …«
»Freier Wille!« rief sie höhnisch; aber ein kleiner zitternder Bruch in ihrer Stimme zeigte, wie nah ihr die Tränen waren. Dr. Schumann sah sie an. Sie war schön in ihrer Erregung. Sie war seine Frau. Er liebte sie; begehrte sie in diesem Augenblick, da es zum erstenmal in ihrer Ehe zu einem offenen Ausbruch zwischen ihnen gekommen war, vielleicht mehr denn je.
»Astrid«, sagte er und trat einen Schritt näher an ihr Bett, »glaub mir, ich verstehe deine Erregung … ich liebe dich doch!«
»Liebe, was ist Liebe? Ihr wollt alle dasselbe … eine Frau, die euch Kinder gebärt. Wir sind doch nur Mittel zum Zweck!« Sie hob die schlanken nackten Arme, preßte die Hände auf die Ohren. »Ich kann es nicht mehr ertragen! Aus freiem Willen, hast du gesagt? Als wenn ich nicht wüßte, wie dieser freie Wille ausgesehen hat! Arme, arme Susanne. Tag für Tag und Stunde für Stunde mußte sie im Gesicht ihres Mannes lesen, daß er nur einen einzigen Wunsch hatte … einen Sohn. Oh, mach mir nichts vor. Er hat sie mürbe gemacht, dein berühmter Professor, dieser große Ehrenmann! Genau wie du es mit mir versucht hast. Von Anfang an!«
»Astrid«, sagte er beherrscht, »ich gebe ja zu, daß ich mir unsere Ehe anders vorgestellt habe. Ist es denn ein Verbrechen, sich Kinder zu wünschen?« Er lächelte plötzlich. »Es brauchen keine Söhne zu sein. Mädchen wären mir genauso lieb.«
»Hör auf«, sagte sie, »hör auf!« Ihre tiefblauen Augen standen voller Tränen. Mit einer rührenden Geste der Resignation ließ sie die Arme sinken.
»Astrid!« beschwor er sie, »glaub mir doch, daß ich dich verstehe. Du hast Angst …«
»Angst? Ja, ich habe Angst. Aber es ist nicht das allein. Ich möchte frei sein, ich möchte leben, ich möchte geliebt werden … um meiner selbst willen.«
»Aber das tue ich doch, Astrid. Spürst du das denn nicht?«
Er beugte sich zu ihr und strich zärtlich über die kühle, glatte Haut ihres Armes.
Sie zuckte zurück. »Rühr mich nicht an!« rief sie. »Wenn du mich noch einmal anrührst … ich werde dieses Haus verlassen. Für immer.« Als ob sie erst jetzt ihre Blöße bemerkt hätte, zog sie mit einer jähen Bewegung die Daunendecke über die Schultern.
Er sah auf sie herab und war sich seiner Kraft bewußt. Er spürte die Versuchung, ihren Widerstand zu brechen. Ihr schmaler Körper zeichnete sich unter der Seidendecke ab, starr und gespannt und voller Abwehr bis in die letzte Faser. Er war ein Mann, er war ihr Mann – und er hatte das Recht, sie zu besitzen.
Ihre Blicke begegneten sich, und sie erkannte, was in ihm vorging.
»Geh!« schrie sie ehtsetzt. »Geh! Ich … ich hasse dich!«
Er holte Luft, mit einem tiefen keuchenden Atemzug. Dann drehte er sich wortlos um und verließ das Schlafzimmer seiner Frau.
Als die Tür wie mit tödlicher Endgültigkeit hinter ihm ins Schloß fiel, starrte Astrid ihm noch immer angsterfüllt nach.
Drei Tage später wurde Susanne Overhoff beerdigt.
Kopf an Kopf drängte sich die Trauergemeinde. Die Ärzte der Frauenklinik waren vollzählig erschienen, soweit sie sich vom Dienst hatten frei machen können, auch die Schwestern, Laborantinnen, Hebammen. Dr. Leopold, der Anästhesist, stand neben dem jungen Dr. Bley, einen Schritt hinter ihnen Dr. Gerber, ein kleines süffisantes Lächeln um die Mundwinkel. Frau Dr. Irene Holger, mit weit aufgerissenen Augen, hatte die Lippen fest zusammengepreßt. Oberschwester Helga, statt in gewohnter Tracht mit schwarzem Mantel und schwarzer Persianermütze, hielt ein weißes Tüchlein in der Hand, das sie immer wieder an die Augen führte. Die junge Schwester Patrizia von der Kinderstation schien hinter ihrem kräftigen Rücken Schutz zu suchen.
Kollegen des Professors aus anderen Fakultäten waren zum Begräbnis gekommen, Studienfreunde, Vertreter der Universität, der Stadt, Journalisten, Patientinnen, Neugierige.
Die Stimme des Pfarrers, eines mageren, lebhaften kleinen Mannes, hätte selbst bei voller Lautstärke die hinteren Reihen nicht mehr erreicht, und er machte auch gar nicht den Versuch dazu.
Professor Overhoff hielt die Augen starr, mit einem Ausdruck angestrengter Konzentration, auf ihn gerichtet. Er sah zwar das Mienenspiel des Pfarrers, die Bewegungen seiner Lippen, aber er war nicht imstande, den Sinn der Worte aufzunehmen, die wie eine unbarmherzige Flut gegen seine Ohren brandete. Hin und wieder drangen Satzfetzen in sein Bewußtsein: »… ein wahrhaft christliches Leben … eine gute, reine Frau … das höchste Opfer … Gottes Liebe …« Aber die Worte ergaben keinen Sinn, schienen weder etwas mit ihm noch mit dem Schicksal seiner Frau zu tun zu haben. Der Professor befand sich in einem Zustand dumpfer Betäubung. Es war nicht Trauer um seine Frau, was er empfand; es war viel mehr. Ihr Tod hatte ihn wie eine körperliche und seelische Verstümmelung getroffen; wie eine riesige Wunde, an der seine Persönlichkeit verblutete. Er konnte nicht mehr weinen, und er konnte nicht mehr beten. Sein Kopf schmerzte, als habe er ihn gegen eine Mauer von Granit gestoßen.
Er begriff nicht, wie dies hatte geschehen, wieso gerade ihm dieser Schmerz hatte zugefügt werden können. Obwohl er Arzt war und der Tod zu seinen täglichen Erfahrungen gehörte; obwohl er wußte, welches Risiko die dritte Geburt für seine Frau bedeuten mußte, hatte er es im tiefsten Herzen nicht eine Sekunde lang für möglich gehalten, daß es Susanne treffen könnte. Er glaubte sie und sich selber gefeit durch die lebendige Kraft ihrer Liebe, ihres Glaubens und ihrer Gebete. Doch Gottes Hand, in der sie beide sich so sicher und geborgen gefühlt, hatte sie fallenlassen. Warum? Warum?
Ein Bild tauchte in Professor Overhoffs Erinnerung auf, das Bild eines jungen Mädchens, an das er seit vielen Jahren nicht mehr gedacht hatte, das er völlig vergessen zu haben glaubte. Jetzt plötzlich sah er Sibylle Kalthoff vor sich, so deutlich und greifbar wie damals, als sie zu ihm in die Praxis kam, kurz bevor man ihn mit der Dozentur betraut hatte. Ein blasses Mädchen, Tochter aus gutem Hause, neunzehn Jahre. Sie war im dritten Monat.
Sie weinte nicht, als er es ihr bestätigte. Nur ganz still wurde sie. »Sie müssen mir helfen, Herr Doktor!« Es war ihm, als höre er noch ihre kleine brüchige Stimme. »Sie müssen!« Und dann hatte sie ihre Geschichte erzählt, die Geschichte einer Vergewaltigung. »Dieses Kind darf nicht zur Welt kommen«, hatte sie gefleht, »meine Eltern … nein, ich könnte es nicht ertragen.« Und er? Er hatte das übliche gesagt, ihr vom Segen der Mutterschaft erzählt und daß alles ganz anders aussehen würde, wenn das Kind erst da wäre; daß sie dann sehr glücklich sein würde und ihre Eltern sich damit abfinden und ihr Enkelkind liebhaben würden.
»Das Kind einer Bestie?« hatte Sibylle geantwortet. Einer Bestie, ja, er erinnerte sich noch genau an diese Worte. Er war betroffen gewesen. Aber er hatte ihr nicht geholfen. Weil es verboten war? Oder weil er um seinen guten Ruf fürchtete, seine Karriere nicht aufs Spiel setzen wollte? Oder wirklich nur deshalb, weil er es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren konnte?
»Wie unbarmherzig Sie sind«, hatte Sibylle gesagt.
Das waren ihre letzten Worte gewesen. Er sah sie nie wieder. Ein paar Wochen später erfuhr er von ihrem Tod. Durch eine Anzeige in der Tageszeitung. »Tragischer Unglücksfall«, hatte es dort geheißen. Es kam nie heraus, ob sie sich einem Kurpfuscher in die Hände gegeben und daran gestorben war oder ob sie ihrem Leben selbst ein Ende gesetzt hatte. Den Eltern war es gelungen, die Sache zu vertuschen.
Er, Paul Overhoff, fühlte sich damals von diesem Tod nicht betroffen. Er glaubte, sich keine Vorwürfe machen zu müssen, denn er war sicher, sich richtig entschieden zu haben. Der Sinn des Lebens, der Sinn von Zeugung und Fortpflanzung, die Gebote Gottes und der christlichen Kirche – das war seine Richtschnur.
Er hatte das Rechte getan. Aber vielleicht war es nicht genug, das Rechte zu tun? Ist es überhaupt das Rechte gewesen?
»Wie unbarmherzig Sie sind!« Diese Worte dröhnten in Professor Overhoffs Ohren, übertönten die Grabrede des Pfarrers, waren so laut, daß er plötzlich befürchtete, alle, die mit ihm am offenen Grab seiner Frau standen, müßten es hören.
In panischer Angst blickte er um sich, sah Augen, unzählige Augenpaare, neugierig, mitleidig, sensationslüstern auf sich gerichtet. Ihm war, als wenn alle diese Menschen um seine innere Qual wüßten, seine Schuld und sein Elend.
Der Pfarrer hatte seine Rede beendet, die letzten Gebete gesprochen. Der Sarg wurde in die Grube gesenkt und stieß polternd gegen die Wände des Grabes, Der Pfarrer nahm dreimal eine Handvoll Erde von der Schaufel, die der Mesner ihm reichte, warf sie mit segnender Gebärde auf den Sarg, der schon in der Tiefe verschwunden war. Professor Overhoff folgte dem Beispiel des Pfarrers.
Frau Dr. Holger führte Eva vor. Zögernd warf auch sie eine Handvoll Erde in das Grab. Dann blieb das junge Mädchen starr und steif am Grab der Mutter stehen und nahm die Kondolationen der Trauergäste entgegen, von denen ihr kein Trost kommen konnte – eine erbarmungswürdige, ganz und gar verlorene kleine Gestalt.
Oberarzt Dr. Rainer Schumann nahm nicht an der Beerdigung teil. Ihn hatte das Los dazu bestimmt, »die Festung zu halten«, wie Dr. Gerber es nannte, und er hatte diese Entscheidung mit kaum verhüllter Erleichterung zur Kenntnis genommen.
Seit er als Student am Seziertisch lernen mußte, Muskeln, Nerven, Hirn und Organe von Leichen zu präparieren, war es ihm nie mehr gelungen, in einem Toten, solch einem entseelten Stück Fleisch, einen Menschen zu sehen. Deshalb hatte für ihn auch der starre kalte Körper, der heute in einer feierlichen Zeremonie ins Grab gesenkt wurde und bald in Verwesung übergehen würde, nichts mehr mit der lebenden, gütigen Susanne Overhoff zu tun, deren Bild er für alle Zeiten in der Erinnerung behalten wollte.
Dr. Schumann war viel zu stabil, als daß ihn der tragische Tod dieser Frau hätte aus dem Gleichgewicht werfen können. Aber er war tief beunruhigt. Er konnte der Versuchung nicht widerstehen, jene verhängnisvolle Operation immer wieder in allen Einzelheiten durchzudenken, ehrlich bemüht, den Ansatzpunkt eines menschlichen Versagens, eines Irrtums oder Fehlers zu finden. Obwohl er sich mit gutem Gewissen freisprechen konnte, gelang es ihm nicht, die heftigen Anklagen seiner Frau einfach abzutun. Ein Unbehagen blieb.
Seit jener nächtlichen Szene hatten Astrid und er nur noch das Nötigste miteinander gesprochen. Eine Kluft war zwischen ihnen aufgebrochen, über die keine Brücke mehr zu führen schien.
Während draußen auf dem Nordfriedhof das Begräbnis stattfand, machte er eine kurze Visite, ohne großen Stab, nur von einer Schwester begleitet. Er besaß die Fähigkeit, Menschen zum Sprechen zu bringen und sie anzuhören – einer der Gründe, warum die Patientinnen ihn liebten. Aber diesmal verhielt er sich kurz angebunden, fast schweigsam, stellte nur die allernotwendigsten Routinefragen. Er las in den fragenden Augen der Patientinnen den Wunsch, über den Tod der Frau des Professors mit ihm zu reden, und gerade das wollte er natürlich auf jeden Fall vermeiden.
Später ging er ins Kinderzimmer der Privatstation – allein, denn die wenigen Schwestern, die an diesem Nachmittag in der Klinik geblieben waren, hatten alle Hände voll zu tun. Zwanzig Bettchen, von denen augenblicklich zwölf belegt waren, standen in diesem sehr hellen, freundlichen Raum. Die Säuglinge hatten ihre dritte Fütterung hinter sich und schliefen nun satt und zufrieden. Nur Karin, ein acht Tage altes kleines Mädchen, das morgen mit seiner Mutter entlassen werden sollte, bewegte die winzigen Hände und babbelte vor sich hin. Dr. Schumann ging das Herz auf. Der scharfe Desinfektionsgeruch konnte den warmen, atmenden Duft jungen Lebens nicht verdecken. Er schritt von Bett zu Bett. Zwei der Säuglinge zeigten eine leichte Gelbverfärbung. Das war normal. Der sogenannte Ikterus neonatorum tritt bei drei Viertel aller Kinder in der Neugeburtszeit auf. Als aber Dr. Schumann an das Bettchen eines am vergangenen Abend geborenen kleinen Jungen kam, stutzte er. Die Haut des Kleinen war stark verfärbt, zeigte ein tiefes Gelb, das fast schon ins Bräunliche ging. Die Säuglingsgelbsucht war zu früh und zu heftig aufgetreten.
Er warf einen Blick auf die Tafel über dem Bett, las den Namen der Mutter. Inge Weyrer. Alle Anzeichen wiesen auf eine Blutkrankheit des Säuglings hin.
Im Bettchen gleich nebenan lag der Sohn Professor Overhoffs, ein kräftiges Kerlchen mit einem ungewöhnlich gut ausgebildeten Schädel. Es schlief tief und fest, die winzige Faust an die Wange gepreßt, unschuldsvoll und ahnungslos, ein Neugeborener wie Millionen andere – und doch schon im Augenblick der Geburt vom Schicksal gezeichnet. Er würde ohne Mutterliebe aufwachsen, würde nie jene zärtliche, behütende Fürsorge spüren, die jedes junge Wesen ebenso dringend braucht wie Licht, Luft, Wärme und Nahrung. Und eines Tages würde er erfahren, daß er mit seinem Leben das der Mutter vernichtet hatte, ohne Wollen und Wissen, vom ersten Atemzug an mit tragischer Schuld beladen.
Dr. Schumann richtete sich auf, als die Tür zum Säuglingszimmer aufgerissen wurde. Schwester Patrizia wirbelte herein, atemlos, das Häubchen schief auf den blonden Locken. Als sie den Oberarzt sah, vertiefte sich das Rot ihrer Wangen. »Oh«, stieß sie verlegen hervor, »entschuldigen Sie bitte, Herr Doktor! Ich … die Beerdigung …«
»Aber ich weiß ja«, sagte Dr. Schumann ruhig, »Sie waren beurlaubt …« Er sah, wie sie nervös an ihren Schürzenbändern nestelte, wie ihre Finger zum Kopf tasteten, um das Häubchen geradezurücken, und irgend etwas trieb ihn dazu, sie zu reizen. »Na, ich hoffe, Sie sind wenigstens auf Ihre Kosten gekommen … oder?« fragte er.
»Auf meine …?« wiederholte sie arglos, dann erst begriff sie, sagte bestürzt: »Aber nein! Wie können Sie denken!«
Er betrachtete sie nicht ohne Wohlgefallen. Sie hatte ein pikantes kleines Gesicht mit großen runden, kindlichen Augen und eine gutgewachsene Figur mit sehr schmaler Taille. Sie wirkte wie ein sehr junges Mädchen, doch wußte er, daß sie vierundzwanzig Jahre alt war; eine tüchtige und bei aller äußerlichen Verspieltheit durchaus zuverlässige Schwester auf der Säuglingsstation.
»Entschuldigen Sie«, sagte er betont gelassen, »wenn ich Ihnen unrecht getan habe.«
Sie holte tief Luft. »Herr Doktor!« Dann änderte sie unvermittelt den Ton, zeigte lächelnd runde Grübchen. »Na ja, ein bißchen stimmt’s schon. Neugierig sind wir Frauen ja alle, und wir Schwestern, fürchte ich, ganz besonders. Aber ich bin froh, daß ich dort gewesen bin. Wenn Sie den Pfarrer gehört hätten … er sprach wirklich wundervoll.«
›Das ist sein Beruf‹, hätte er beinahe gesagt, aber er verkniff sich diese Bemerkung.
Schwester Patrizia nahm sein Schweigen als Interesse. »Er hat genau gesagt, was ich selbst gefühlt habe«, plauderte sie, während sie mit flinken Fingern Stöße von Windeln, Hemdchen, Jäckchen zu sortieren begann, »nur hätte ich es nie so formulieren können. ›Diese Mutte‹ – hat er gesagt, »brachte das größte Opfer, das ein Mensch überhaupt bringen kann. Sie hat ihr eigenes Leben hingegeben, um die Seele ihres Kindes ans Licht zu bringen …!‹ – und, nicht wahr, das stimmt doch? Es muß wunderbar sein, so sterben zu dürfen … einen so sinnvollen Tod!« Sie hielt in der Bewegung inne und sah Dr. Schumann an.
»Wenn man es so sieht …«, sagte er schwach.
»Aber man kann es doch nur so sehen!« rief sie eifrig.
»Die Frau Professor hat ja gewußt, daß sie ihr Leben aufs Spiel setzte … sie hat es freiwillig und ganz bewußt hergegeben, um …« Sie unterbrach sich. »Mir fehlen die richtigen Worte, aber es ist bestimmt das Größte, das eine Frau tun kann.«
Er beobachtete sie mit Interesse. »Glauben Sie, daß Sie es auch können?«
»Ich!? Nein … o nein. Dazu bin ich viel zu … zu egoistisch, sie, die Frau Professor, war eine Heilige. Aber verstehen kann ich es. Kinder zu bekommen ist das Wunderbarste, was es gibt.«
Wie eine Vision sah Dr. Schumann Astrid vor sich, erinnerte sich ihrer heftigen Worte, ihres Entsetzens, ihres Abscheus. Aber ganz rasch schüttelte er dieses Bild von sich ab, ärgerte sich über sich selber, daß er seine Frau mit dieser jungen Schwester verglich.
»Dann wundert es mich, daß Sie noch nicht ans Heiraten gedacht haben«, sagte er gewollt spöttisch.
Sie lächelte zu ihm auf. »Ich tu’s dauernd«, bekannte sie, »aber den Richtigen habe ich noch nicht gefunden. Meine Mutter sagt immer man kann den Vater seiner Kinder gär nicht sorgfältig genug auswählen!«
Die Tür öffnete sich, Frau Dr. Holger trat ein, Dr. Schumann glaubte zu fühlen, daß er rot wurde. Hatte er ein schlechtes Gewissen?
»Gut, daß Sie kommen, Frau Kollegin«, sagte er rasch, »sehen Sie doch, bitte, den kleinen Weyrer einmal an … sieht wie ein Rhesus aus. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie eine Blutabnahme durchführen und die Probe sofort ins Labor geben würden.«
»Sie haben recht«, erwiderte die Ärztin, die an das Bett des Kindes getreten war, »das ist sehr rasch gekommen. Heute früh war noch nichts zu sehen.«
»Eventuell müssen wir einen Blutaustausch vornehmen. Bitte, unterrichten Sie mich auf jeden Fall über das Labor-Ergebnis.« Dr. Schumann wandte sich zur Tür.
»Einen Augenblick noch«, bat die Ärztin, »ich hätte gern mit Ihnen über den kleinen Overhoff gesprochen …«
»Irgend etwas nicht in Ordnung?«
»Er ist vollkommen gesund. Herztöne, Reaktionen, alles großartig. Ich möchte nur einen Vorschlag wegen der Ernährung machen … Elfie Peters hat Milch in Hülle und Fülle, ihr Kerlchen kann’s gar nicht bewältigen. Ob wir den Kleinen nicht bei ihr anlegen sollten?«
»Ist sie einverstanden?«
»Ich habe noch nicht mit ihr gesprochen. Aber ich bin überzeugt, sie wird es gern tun. Das Abpumpen ist ihr nicht gerade angenehm, und sie ist ein nettes Mädchen.«
»Ledig?«
»Ja. Sehr schlechtes Zuhause. Sie würde sicher gern vierzehn Tage hierbleiben. Man müßte mit Herrn Professor darüber sprechen.«
Dr. Schumann zögerte. »Heute wird er sicher nicht mehr kommen …«
»Doch. Ich habe mich erkundigt. Er ist schon da.«
»Ob es dann richtig ist, wenn ich gerade jetzt, nach der Beerdigung …«
»Wir müssen versuchen, ihm darüber hinwegzuhelfen, ihn an seinem Sohn zu interessieren. Gerade jetzt …«
»Warum sprechen Sie dann nicht selber mit ihm, Frau Kollegin?« wandte Dr. Schumann unbehaglich ein. »Sie sind eine Frau, Sie könnten sicher am ehesten …«
»Haben Sie vergessen, daß ich es war, die ihm den Tod seiner Frau mitgeteilt hat?« sagte die Ärztin sehr ruhig. »Im Altertum ließ man die Boten einer Unglücksnachricht töten. Nicht ganz unverständlich. Mein Anblick würde vielleicht alles von neuem in ihm aufreißen …«
Professor Overhoff saß, den Kopf in die Hände gestützt, hinter seinem leeren Schreibtisch, als Dr. Schumann ins Zimmer trat. Er machte nicht die geringsten Anstalten, Haltung vorzutäuschen.
Unwillkürlich blieb Dr. Schumann nahe der Tür stehen. Wohl hatte er erwartet, einen schmerzgebeugten Mann anzutreffen, aber er erschrak dennoch über das Ausmaß dieses Zusammenbruchs. War das Haar des Professors wirklich über Nacht so grau geworden? Oder täuschte er sich? Lag es an dem schwarzen Anzug, der schwarzen Krawatte, dem bleichen Gesicht, die ihn um Jahre gealtert erscheinen ließen?
Er wagte nicht, ihn anzusprechen, sondern wartete stumm, bis der Professor endlich den Kopf hob und ihn aus Augen ansah, die, ohne Ausdruck, in weite Fernen gerichtet zu sein schienen.
»Ja?« fragte Professor Overhoff müde. »Was gibt es?«
»Entschuldigen Sie bitte, daß ich Sie störe, Herr Professor«, sagte Dr. Schumann und war sich seiner eigenen Unbeholfenheit quälend bewußt, »aber ich komme … es ist wegen des Jungen.«
»Des Jungen?« wiederholte der Professor verständnislos.
»Wegen Ihres Sohnes«, sagte Dr. Schumann mit Nachdruck. Das Gesicht des Professors blieb völlig unbewegt, zeigte nicht die Spur einer Anteilnahme.
»Frau Dr. Holger hat den Vorschlag gemacht … einen Vorschlag, den ich übrigens unterstützen möchte … ihn einer Wöchnerin der dritten Station anzulegen, einer sehr gesunden jungen Frau, die …«
Professor Overhoff unterbrach ihn. »Ja, dann tun Sie das doch«, sagte er in einem Ton, der deutlich zeigte, daß er sich durch diese Frage im Augenblick nur belästigt fühlte.
»Danke, Herr Professor.« Dr. Schumann suchte nach Worten, die diese Wand, mit der der Witwer sich umgeben hatte, hätten durchbrechen können. »Es ist ein prächtiger Kerl«, begann er, »wenn Sie ihn sich einmal ansehen würden …«
»Wozu?«
Eine Sekunde lang verschlug es Dr. Schumann die Sprache. Dann fuhr er eindringlich fort: »Es ist Ihr Sohn, Herr Professor … das letzte Vermächtnis Ihrer Frau!« Er hielt inne, hatte das Gefühl, zu weit gegangen zu sein.
Aber der Professor reagierte überhaupt nicht.
Dr. Schumann gab es auf. »Dann werde ich also anordnen …«, sagte er und wollte sich zurückziehen.
Ganz plötzlich rührte sich die Gestalt hinter dem Schreibtisch. »Bitte«, sagte er, »bleiben Sie doch noch …«
Dr. Schumann trat näher, folgte der Handbewegung seines Chefs und ließ sich auf einen der harten, lederbezogenen Stühle nieder.
In die Hände des Professors war Unruhe gekommen, sie glitten nervös über die blanke Fläche des Schreibtisches, nahmen den schweren goldenen Kugelschreiber auf, legten ihn wieder fort. Dr. Schumann wartete geduldig.
»Mir geht da immerzu ein Gedanke im Kopf herum«, sagte Professor Overhoff endlich mühsam; »ein an sich vielleicht abwegiger Gedanke … seien Sie, bitte, ganz ehrlich! Hat jemand Sie schon einmal … unbarmherzig genannt?«
»Doch«, gestand Dr. Schumann; »dies und noch mehr. Meine Frau. Sie hält mich für einen kalten, grausamen Egoisten.«
»Das meine ich nicht. Eine Patientin.« Professor Overhoffs Atem ging schwer. Es war deutlich, wieviel Überwindung ihn dies Gespräch kostete. »Sicher sind doch auch zu Ihnen schon Frauen gekommen … blutjunge Mädchen, verlassene Bräute, Frauen trunksüchtiger Männer, die ihr Kind nicht haben wollten?«
»Natürlich«, antwortete Dr. Schumann verständnislos; »das gehört doch zu den täglichen Erfahrungen jedes Frauenarztes …«
»Und? Haben Sie geholfen?«
»Nein.«
»Waren Sie auch nie … in Versuchung gekommen, es zu tun? Oder … ich will die Frage anders formulieren … sind Sie überzeugt, daß Ihre Weigerung in jedem Fall richtig war?«
»Ich begreife nicht …«
»Doch, doch, weichen Sie mir nicht aus! Sie begreifen sehr gut. Hat Ihnen noch nie jemand gesagt … haben Sie noch nie gespürt, daß Ihre Haltung unbarmherzig war?«
»Wir Ärzte dienen dem Leben«, sagte Dr. Schumann; »und das Leben ist unbarmherzig.«
»Die Natur, meinen Sie …«
Ätzend fielen die Worte in sein Bewußtsein, mit denen Astrid ihn zu verletzen gesucht hatte. »Nein, das Leben!« erwiderte er heftig. »Die Natur will oft auch den Tod. Er allein ist unser Feind, ihn müssen wir bekämpfen. Auch das ungeborene Kind besitzt ein Recht auf sein Leben.«
»Und wenn wir wissen, daß ohne unser Eingreifen beide verloren sind, die Mutter und ihr Kind? Weil so ein blutjunges Ding oder so ein verzweifeltes Wesen die Verantwortung gar nicht tragen kann oder will? Daß sie ihr Leben wegwerfen wird, wenn wir nicht …« Die Stimme des Professors versagte.
»Wir dürfen niemals und in keinem Fall zum Helfershelfer des Todes werden«, erklärte Dr. Schumann mit fester Stimme, »auch wenn er gnädig scheint. Ich weiß, er kann es manchmal, denn …«
Das Schrillen des Telefons unterbrach seinen Satz.
Professor Overhoff nahm den Hörer ab, meldete sich, lauschte. »Ja«, sagte er, »nein … der Herr Oberarzt kommt sofort.« Er legte den Hörer auf, sah Dr. Schumann an. »Sie müssen ins Entbindungszimmer, Kollege … es scheint Komplikationen gegeben zu haben. Die junge Evelyn Bauer.« Dr. Schumann war schon aufgestanden. »Aber, Herr Professor, das ist doch Ihr Fall!«
Professor Overhoff hob die Schultern, ließ sie mit einer resignierten Gebärde fallen. »Bitte, entlasten Sie mich! Sie dürfen mich gern für einen Schwächling halten. Aber ich habe keine Kraft mehr … weder Kraft noch Sicherheit.«
Er versuchte seine Hände ruhig zu halten, aber Dr. Schumann war es nicht entgangen, daß sie flatterten wie die Hände eines sehr alten Mannes.
Astrid Schumann kauerte in dem Sessel am Kamin und blätterte in einer Illustrierten. Sie hörte das Klingeln der Haustürglocke, aber sie dachte nicht daran, aufzustehen. Es war die Aufgabe Fannys, der jungen Hausangestellten, die Tür zu öffnen.
Kurz darauf trat Astrids Schwester Kirsten ein – sehr schick in einem kleinen hellblauen, frühlingshaften Kostüm.
»Fein, daß du da bist«, rief Kirsten munter, lief auf die Schwester zu, küßte sie zärtlich auf beide Wangen, »und gut siehst du aus! Dieser Hausanzug ist ja ganz prachtvoll … reine Seide, wie?«
»Ja«, erwiderte Astrid und änderte unwillkürlich ihre Haltung, um den honiggelben, schimmernden Hausanzug besser zur Geltung zu bringen. »Aber du bist doch nicht extra deshalb gekommen, um mir Komplimente zu machen?«
Kirsten lachte. »Natürlich nicht. Ich war zufällig ganz in der Nähe, da kam ich auf die Idee … du bist mir doch hoffentlich nicht böse, daß ich dich so überfalle?«
»Unsinn. Aber wenn du früher gekommen wärst, hätten wir zusammen Tee trinken können.«
»Danke. Ich habe schon.« Kirsten zog ihre hellgrauen Lederhandschuhe aus, trat an das Feuer und wärmte sich die Hände an den Flammen. »Eigentlich hatte ich gar nicht damit gerechnet, dich zu Hause anzutreffen …« Sie machte eine Pause, und erst als Astrid nicht reagierte, fügte sie hinzu: »Ich dachte, du seiest noch auf der Beerdigung.«
»Nein«, sagte Astrid kurz.
»Dein Mann muß aber wohl jeden Moment kommen.«
»Das weiß ich nicht.«
Kirsten drehte sich um und sah ihre Schwester an. »Aber du mußt doch wissen, ob …« Sie unterbrach sich, fragte bestürzt: »Ist etwas nicht in Ordnung mit euch?«
»Nichts ist in Ordnung, wenn du es genau wissen willst …«
Astrid nahm einen letzten Zug aus ihrer Zigarette und warf den Stummel in weitem Bogen ins Feuer. »Wir sprechen seit Tagen nicht mehr miteinander.«
»Ach!« Kirsten war so schockiert, daß sie einen Augenblick lang einfach nicht wußte, was sie sagen sollte.
»Aber … ich meine«, brachte sie endlich heraus, »liebt er dich denn nicht mehr?«
»Was ein Mann schon unter Liebe versteht!« antwortete Astrid bitter.
Kirsten sah sie verständnislos und mit erstaunten Augen an.
»Ich habe gewußt … ich war ja kein Kind mehr … daß die Männer immer nur das eine wollen«, sagte Astrid mühsam; »aber ich habe gedacht … ich hatte so gehofft … daß das in der Ehe anders sein würde. Es gibt doch tiefere Bindungen, geistig-seelische Beziehungen, die wichtiger sind als das Körperliche.«
Kirsten runzelte die Stirn. »Ist er dir … so zuwider?« fragte sie und errötete über ihre eigene Frage.
»Natürlich nicht. Dann hätte ich ihn doch nicht geheiratet.«
»Aber …?«
»Er quält mich mit seinem ewigen Begehren«, sagte Astrid verzweifelt; »kannst du das denn nicht verstehen? Ich spüre ja deutlich, daß er gar nicht mich will, sondern immer nur … das Kind!«
»Aber das ist doch gerade der Beweis seiner Liebe!«
»Ach, Kirsten«, seufzte Astrid und nahm sich eine neue Zigarette; »was hat es für einen Zweck, mit dir darüber zu reden. Du weißt nicht, wie das ist. Wenn man jeden Monat immer wieder voller Angst darauf wartet, ob man auch seine Tage bekommt … wenn man sein Gesicht im Spiegel betrachtet, voller Furcht, eine Veränderung zu entdecken … sein Gewicht prüft, ob der Leib nicht vielleicht schon schwerer geworden ist …es ist grauenhaft.«
»O doch, das kenne ich«, sagte Kirsten mit gepreßter Stimme; »nur umgekehrt. Ich warte jeden Monat wie du … nur mit verzweifelter Hoffnung statt mit Angst. Und werde wieder, immer wieder enttäuscht. Wenn mein Mann zu mir kommt … du bist die einzige, mit der ich darüber spreche … es ist entsetzlich, ich kann mich nicht mehr richtig entspannen, kann nichts mehr empfinden, muß immer nur denken, denken, denken. Wird es diesmal klappen? Haben wir alles richtig gemacht? Habe ich mich nicht verrechnet?« Sie schluckte schwer. »Eigentlich bin ich nur gekommen, um Rainer zu bitten, mich bei Professor Overhoff anzumelden …«
»Ich würde liebend gern mit dir tauschen«, sagte Astrid.
»Nein, das würdest du nicht. Niemand hilft dir, wenn du ein Kind haben willst … aber ein Kind zu verhüten gibt es Hunderte von Mitteln.« Kirsten sah ihre Schwester an.
»Sag mal, hast du das noch nie versucht?«
»Ich weiß nicht …«, sagte Astrid unbehaglich.
»Aber du solltest es tun!Oder willst du deinen Mann verlieren?«
»Natürlich nicht!«
»Es wird soweit kommen, wenn du so weitermachst. Du mußt etwas unternehmen. Wenn du dich nicht überwinden kannst, ein Kind zu empfangen …«
»Nur das nicht!«
»Dann mußt du den anderen Weg gehen. Ich habe so viele Bücher gelesen, daß ich inzwischen Expertin geworden bin. Willst du meinen Rat haben? Du brauchst nur ein Wort zu sagen, und ich erzähle dir alles, was ich weiß …«
Astrid tat einen tiefen Atemzug, der fast wie ein nervöses Schluchzen klang. »Ja«, flüsterte sie, »bitte … sag es mir!«