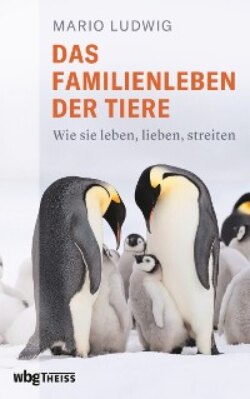Читать книгу Das Familienleben der Tiere - Mario Ludwig - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Sache mit der Treue
Оглавление„Kein Zweifel, der Hund ist treu. Aber sollen wir uns deshalb ein Beispiel an ihm nehmen? Er ist doch nur dem Menschen treu und nicht dem Hund.“ Recht hat er, der begnadete österreichische Satiriker und Publizist Karl Kraus. Mit der Treue haben es Tiere nicht so. Der weitaus größte Teil der Tiere lebt polygam, hat also Sex mit mehreren Partnern. Einige wenige treue Tiere finden wir beispielsweise bei den Vögeln: Großpinguine, Schwäne und Albatrosse. Bei den Säugetieren sieht es noch schlechter aus als bei den Vögeln, hier lebt gerade mal ein Prozent monogam. Bei den Nagetieren ist das zum Beispiel der Biber, bei den hundeartigen Raubtieren sind das Fuchs und Schakal und bei den Affen die Krallenaffen und die Gibbons. Und ausgerechnet unsere nächste Verwandtschaft im Tierreich, die berühmt berüchtigten Bonobos, die sogenannten Zwergschimpansen aus Zentralafrika, die rein genetisch gesehen mit uns zu fast 99 Prozent übereinstimmen, sind geradezu wild polygam und auch sexuell gesehen sehr experimentierfreudig.
Allerdings ist, wo Treue draufsteht, nicht immer auch Treue drin. So war sich die Wissenschaft lange Zeit ziemlich sicher, dass sich Herr und Frau Seepferdchen ein Leben lang treu sind. Zurückzuführen ist diese, für einen Fisch doch ziemlich bemerkenswerte Tatsache auf eine Studie aus dem Jahr 1992, in der australische Wissenschaftler eine einzige Seepferdchenart, das „Whites Seepferdchen“, in Sachen Treue einmal etwas genauer unter die Lupe nahmen. Und siehe da, die kleinen Fische blieben sich auch dann treu, wenn andere möglicherweise attraktivere Partner zur Verfügung standen. Ein Resultat, das von den Medien begeistert aufgegriffen und schnell für alle Seepferdchen verallgemeinert wurde. Und fortan schrieben Journalisten nur allzu gerne von der unverbrüchlichen Liebe der niedlichen kleinen Tiere mit dem Pferdekopf. Aber bald tauchten erste Meldungen von Aquarien und auch von privaten Seepferdchenhaltern auf, die das Bild von der ewigen Seepferdchentreue gewaltig ins Wanken brachten. Nicht nur, dass einige Seepferdchenarten anscheinend alles andere als monogam waren oder sich, wie das Dickbauchseepferdchen, noch nicht einmal zu Paaren zusammenfanden, sondern bekennende Singles waren.
Diese ersten Beobachtungen wurden durch eine Studie an Westaustralischen Seepferdchen aus dem Jahr 2000 bestätigt, nach der mindestens die Hälfte der Tiere ihre Partner nach jedem Brutvorgang wechseln. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2004 an australischen Kurzkopfseepferdchen zeigte, dass diese Seepferdchenart in Gruppen lebt, wobei sich die Gruppenmitglieder, egal ob Männchen oder Weibchen, mit jedem gerade verfügbaren Partner paaren. Ähnliches gilt für europäische Seepferdchenarten. Dort kommt es offensichtlich auf die Größe an. Als man im Versuch einem Seepferdmann der Art „Langschnäuziges Seepferdchen“, das in einer scheinbar festen Beziehung mit einem Weibchen lebte, ein größeres Weibchen präsentierte, verließ der treulose Ehemann sofort schnöde sein angestammtes Weibchen und wandte sich der neuen und wohl auch attraktiveren Partnerin zu.
Im Jahr 2006 wurde an den neun deutschen Sea Life Aquarien eine überaus interessante Untersuchung in Sachen Seepferdchentreue durchgeführt: Für diese Studie hat man insgesamt 45 Seepferdchen aus drei verschiedenen Arten mit farbigen Halsbändern ausgestattet. Anhand dieser Halsbänder konnte man erkennen, welches Männchen zu welchem Weibchen gehört. Anschließend wurde über einen Zeitraum von vier Monaten das Liebesverhalten der Pärchen streng protokolliert. Das Ergebnis der Studie war eindeutig: Monogamie ist zumindest für die Seepferdchen in den Aquarien in den allermeisten Fällen ein Fremdwort. Nur ein einziges Seepferdchenpaar war sich während des gesamten Untersuchungszeitraumes treu geblieben, der Rest hatte oft sogar mehrfach die Partner gewechselt, gleichgeschlechtliche Interaktionen übrigens inklusive. Offensichtlich muss die Mär vom ach so treuen Seepferdchen heute wohl endgültig ad acta gelegt werden.
Aber auch bei den Treusten der Treuen gibt es Seitensprünge. Tannenmeisen etwa führen im Regelfall eine lebenslange Ehe. Aber neuere Untersuchungen zeigen: Tannenmeisen gehören unter Singvögeln zu den Top 10 in Sachen Seitensprung. Jedes dritte Küken der Erstbrut ist ein „Kuckuckskind“ (stammt von einem anderen Männchen), bei der Zweitbrut ist es sogar jedes zweite.
Aber was passiert, wenn ein Weibchen ein Männchen beim Fremdgehen erwischt? Da kann es durchaus passieren, dass ähnlich wie bei uns Menschen der Haussegen in eine gewaltige Schieflage kommt. Etwa beim amerikanischen Rotrückensalamander, einem Lurch, der, sein Name verrät es schon, in den feuchten Laubwäldern und Sumpfgebieten der USA und Kanadas zu Hause ist. Kehrt ein Rotrückensalamandermann nach einem außerehelichen Tête-à-Tête zu seinem angestammten Weibchen zurück, kann dieses den Seitensprung des Gatten im wahrsten Sinne des Wortes riechen. Bleiben doch die Pheromone der Lurchgeliebten an der Haut des Fremdgängers haften und überführen so das treulose Männchen. Und das hintergangene Eheweibchen versteht in Sachen Treuebruch gar keinen Spaß: Wissenschaftler der Universität von Louisiana konnten beobachten, dass sich die betrogenen Ehefrauen bei der Heimkehr des treulosen Männchens regelrecht in Positur stellen, um möglichst groß und drohend zu erscheinen und anschließend den Sünder meist auch noch kräftig ins Bein beißen.
Weshalb die Salamanderweibchen im Gegensatz zu allen anderen Amphibien bei ihren Männern derart auf Treue bestehen, hat die Wissenschaft noch nicht geklärt. Monogame Amphibien sind selten.
Untreue wird aber auch im Tierreich ab und an nicht nur von der Gattin, sondern auch vom Leben bestraft. Zumindest bei den Marienkäfern ist das so, genauer gesagt, bei den Zweipunkt-Marienkäfern: Diese kleinen Käfer, die im englischen Sprachraum auf den hübschen Namen „Lady Beetle“ hören, halten von Treue nicht allzu viel. Wie anders wäre es zu erklären, dass sie etwa alle zwei Tage ihren Sexualpartner wechseln. Für diese Untreue zahlen die Käfer mit den beiden charakteristischen Flecken auf den Flügeldecken jedoch einen hohen Preis: Sie handeln sich eine Art Geschlechtskrankheit ein, denn bei der Kopulation wird auch eine winzige Milbe namens Coccipolipus hippodamiae übertragen, die die unangenehme Eigenschaft besitzt, weibliche Marienkäfer unfruchtbar zu machen. Und das hat durchaus unangenehme Folgen: Durch die häufig wechselnden Geschlechtspartner sind manchmal bis zu 90 Prozent der Marienkäferweibchen einer Population unfruchtbar. Aber existenzbedrohend ist diese Promiskuität der Marienkäfer nicht: Die Weibchen werden nicht sofort unfruchtbar, sondern erst drei Wochen nach dem Milbenbefall. Genug Zeit, um Eier abzulegen und eine neue Generation zu gründen.
Einen noch höheren Preis für ihre Untreue zahlen Hummeln, folgt man Untersuchungen von Wissenschaftlern der ETH in Zürich: Bei Hummeldamen verkürzt Untreue sogar die Lebenserwartung. Warum das so ist, haben die Wissenschaftler allerdings noch nicht herausgefunden.
Die ganz große Treue fürs Leben findet man dagegen bei Tieren, die bei uns in Deutschland kaum ein Mensch kennt, bei den Präriewühlmäusen. Präriewühlmäuse sind, der Name verrät es schon, in den nordamerikanischen Prärien zu Hause. Dort sind die kleinen Nager jedoch nicht gerade übermäßig beliebt, da sie die Felder der Farmer mit ihren Bauten unterminieren und deshalb als „Schädlinge“ verfolgt werden. Beobachtungen im Freiland, aber auch Laborversuche zeigen, dass Präriewühlmäuse streng monogam leben. Und das betrifft sowohl Männchen als auch Weibchen. Die „Einehe“ beginnt und das ist offensichtlich entscheidend, mit einer bis zu 40-stündigen Dauerkopulation. Danach bleiben beide Partner unzertrennlich und tauschen bei jeder Gelegenheit Zärtlichkeiten aus. Nach außen grenzt sich das Wühlmauspaar deutlich ab und verteidigt sein Revier sehr aggressiv gegenüber Konkurrenten. Die Treue bei Präriemäusen geht sogar über den Tod hinaus: Stirbt bei den Präriewühlmäusen ein Partner, verbandelt sich der Witwer oder die Witwe nicht mehr neu.
Kuschelhormon macht Menschen monogam
Das als Kuschelhormon bekannte Hormon Oxytocin macht nicht nur Präriewühlmäuse treu, sondern auch Menschen. Vielleicht nicht im wirklichen Leben, aber zumindest im Experiment ist das so: Eine winzige Dosis Oxytocin und schon bleibt der Ehemann sehr wahrscheinlich treu. Das konnten Wissenschaftler der Universität Bonn mithilfe eines einfachen Experiments nachweisen: Die Forscher zeigten 40 heterosexuellen, männlichen, in einer festen Beziehung lebenden Probanden Fotografien ihrer eigenen Partnerin, aber auch Bilder unbekannter Frauen. Zuvor hatte die Hälfte der Versuchsteilnehmer mithilfe eines Nasensprays eine kräftige Dosis Oxytocin, die andere Hälfte lediglich ein Placebo verabreicht bekommen. Während des Experiments wurde die Gehirnaktivität der Probanden aufgezeichnet. Und siehe da: War den Herren der Schöpfung Oxytocin verabreicht worden, zeigte sich im Gehirn der Probanden, im Nucleus accumbens, dem Sitz des menschlichen sogenannten „Belohnungssystems“, eine starke Aktivität. Eine Aktivität, die bei den Versuchsteilnehmern, die lediglich ein Placebo erhalten hatten, nicht auftrat. Will heißen, durch die Oxytocinzufuhr empfanden die Probanden die eigene Partnerin attraktiver und begehrenswerter als die fremden Damen. Um zu überprüfen, ob dieser Effekt wirklich nur bei der eigenen Partnerin auftritt und nicht etwa auch bei weiblichen Bekannten oder Freunden, zeigten die Wissenschaftler in einem zweiten Experiment, bei gleichem Versuchsdesign, den Versuchsteilnehmern anstelle von Bildern der Partnerin, Bilder von Arbeitskolleginnen bzw. langjährigen Bekannten. Im Gegensatz zu Bildern von der Partnerin war hier jedoch keine Aktivität im Belohnungssystem zu verzeichnen. Demnach reicht reine Vertrautheit nicht aus, um einen Bindungseffekt zu stimulieren, es muss schon Liebe im Spiel sein. Und das wiederum bedeutet nach Ansicht der Wissenschaftler, dass Oxytocin zumindest dazu beiträgt, die Bindung zwischen zwei Liebenden aufrechtzuhalten, und damit natürlich auch einen wichtigen Beitrag leistet, Monogamie zu fördern.
Übrigens, der 40-stündige Begattungsmarathon findet immer nur am Beginn einer Beziehung statt. Im weiteren Verlauf des rund zweijährigen Wühlmauslebens ist der Sex dann durchaus normal. Will heißen, deutlich kürzer und wohl auch leidenschaftsloser.
Die Wissenschaft hat sich lange gefragt, woran es liegt, dass bei den Präriewühlmäusen sowohl Männchen als auch Weibchen so treu sind, während die nah verwandten Wiesenwühlmäuse beiderlei Geschlechts viele verschiedene Partner haben. Eine Erklärung macht zwei Hormone verantwortlich: Vasopressin, ein Hormon, das positiv auf das Sozialverhalten und auf die Paarbindung einwirkt, und das sogenannte „Kuschelhormon“ Oxytocin, das ebenfalls das Sozialverhalten, aber auch das Vertrauen stärkt. Bei den treuen Präriewühlmäusen fanden amerikanische Wissenschaftler im Gehirn bei den Männchen deutlich mehr Rezeptoren für Vasopressin und bei den Weibchen deutlich mehr Bindungsstellen für Oxytocin als bei den polygamen Wiesenwühlmäusen. Und diese Rezeptoren reagieren auch empfindlicher auf das Hormon, das heißt, die Hormone wirken bei ihnen stärker.
Amerikanische Forscher der Emory University in Atlanta haben vor einigen Jahren das Gen, das für die Bildung dieser Vasopressinrezeptoren verantwortlich ist, aus den treuen Präriewühlmausmännchen auf die untreuen Wiesenwühlmausmänner übertragen. Und siehe da: Plötzlich waren aus notorischen Fremdgängern treue Ehemänner geworden. Nach dem Gentransfer haben sich die manipulierten Wiesenwühlmausmänner nicht mehr nach anderen Weibchen umgeschaut. Aber bevor jetzt die ein oder andere Leserin sagt: „So ein Gentransfer wäre genau das richtige für meinen Ehemann“ – ein derartiger Transfer klappt nur bei diesen beiden Wühlmausarten. Schon andere Mäuse besitzen ebenfalls dieses „Treuegen“ und sind dennoch polygam. Offensichtlich ist das sogenannte Treuegen zwar eine notwendige, aber nicht die alleinige Voraussetzung für Monogamie. Dazu müssen nach Ansicht der Wissenschaft noch andere Gene in bestimmten Variationen vorliegen.
Den umgekehrten Fall, sprich, ob Wiesenwühlmausweibchen nach einem Transfer des Gens, das für die Bildung der Oxytocinrezeptoren verantwortlich ist, auch treu werden, hat man bisher noch nicht untersucht.
Oxytocin steuert übrigens auch das Empathieverhalten bei Präriewühlmäusen, wie Forscher des Yerkes National Primate Research Centers der Emory Universität im US-Bundesstaat Georgia herausgefunden haben. Die amerikanischen Forscher hatten Präriewühlmauspaare, die vorher zusammengelebt hatten, getrennt und anschließend einer dieser getrennten Wühlmäuse leichte Elektroschocks versetzt. Anschließend wurden die beiden Nager wieder zusammengesetzt und tatsächlich wurde die „geschockte“ Wühlmaus sofort von ihrem Partner durch Ablecken und Fellpflege getröstet. Eine Verhaltensweise, die offensichtlich von Oxytocin gesteuert wird. Nachgewiesen wurde das mit einem weiteren Experiment: Als man bei den Wühlmäusen den Rezeptor für das Hormon Oxytocin im Gehirn blockierte, fanden keine Tröstungen mehr statt.
Dass übermäßiger Alkoholgenuss bei uns Menschen schnell einmal zur Untreue führen kann, ist hinreichend bekannt. Und auch die treusten der treuen Tiere sind vor dieser Tatsache nicht gefeit. Amerikanische Wissenschaftler konnten in einer hochinteressanten Studie zeigen, dass die Super-Treue der Präriewühlmäuse unter Alkoholeinfluss, zumindest teilweise, ganz schön ins Wanken gerät. Alkoholexperimente lassen sich mit Präriewühlmäusen relativ einfach durchführen, da Präriewühlmäuse, im Gegensatz zu vielen anderen Nagetieren, ausgesprochen gerne Alkohol trinken und ihn mitunter sogar reinem Wasser vorziehen. Setzt man Präriewühlmäuse im Experiment unter Alkoholeinfluss, reagieren überraschenderweise die Geschlechter deutlich unterschiedlich. Während Weibchen nach reichlich Alkoholkonsum offenbar eine noch stärkere Bindung zu ihrem Partner verspüren, neigen betrunkene Präriemausmänner zum Fremdgehen. Warum das so ist, ist noch nicht vollständig geklärt worden, da besteht noch Forschungsbedarf.
Der Grund für die weit verbreitete Untreue im Tierreich liegt klar in den unterschiedlichen Fortpflanzungsstrategien von Männchen und Weibchen begründet. Die Männchen im Tierreich wollen nichts mehr, als ihre Gene so breit gestreut wie möglich weiterzugeben. Das heißt, sie wollen möglichst viele verschiedene Sexualpartnerinnen haben. Und bei so einer Strategie ist Treue dann eher hinderlich. Untreue zahlt sich auch aus dem Blickwinkel der Evolution gesehen aus, weil sie – Moral hin Moral her – eine größere genetische Variabilität gewährleistet.
Die Weibchen im Tierreich haben einen ganz anderen Ansatz. Sie wollen immer das Männchen mit den besten Genen als Sexualpartner haben, es soll ja diese guten Gene an die gemeinsamen Kinder weitergeben. Deshalb herrscht im Tierreich in den allermeisten Fällen Damenwahl und auch da ist Treue nicht gerade förderlich.
Der Vorteil für die Tiere, die treu sind, liegt offensichtlich bei der Aufzucht der Jungen, die sehr energie- und zeitaufwendig ist. Da ist es allemal hilfreich, wenn einem ein Partner unterstützend zur Hand geht. Von Möwen etwa weiß man zum Beispiel, dass diejenigen Paare, die am längsten zusammen sind, die meisten Jungen durchbringen, weil die Eltern ein eingespieltes Paar sind, das sich gut ergänzt. Da zahlt sich eben Treue aus.