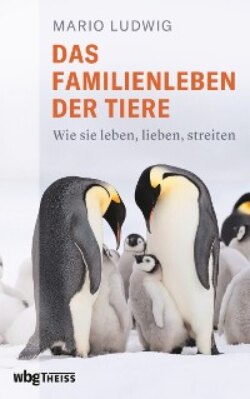Читать книгу Das Familienleben der Tiere - Mario Ludwig - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Supereltern
ОглавлениеEs gibt kaum ein Synonym, das so für schlechte Eltern steht wie der Begriff „Rabeneltern“. So werden gemeinhin Eltern bezeichnet, die ihre Kinder vernachlässigen. Genau das Gegenteil von sogenannten „Helikopter-Eltern“, überfürsorgliche Eltern, die sich ähnlich wie ein Beobachtungshubschrauber ständig in der Nähe ihrer Kinder aufhalten, um sie mit großer Liebe zu überwachen und zu behüten. Lange Zeit standen Raben tatsächlich im Ruf, sich nicht nur herzlich wenig um ihren Nachwuchs zu kümmern, sondern ihm sogar noch aktiv Schaden zuzufügen. Alles Unsinn, Raben sind keine schlechten Eltern. Der schlechte Ruf der schwarzen Vögel geht auf eine falsch interpretierte Naturbeobachtung zurück: Junge Raben, die von der Wissenschaft zu den sogenannten Nesthockern gezählt werden, verlassen ziemlich oft auf eigene Faust das Nest, bevor sie überhaupt fliegen können, und sitzen dann oft scheinbar völlig einsam und verlassen unter dem Nest.
Dieses auf den ersten Blick bedauernswerte Bild, das die Jungraben abgaben, führte zu der Vermutung, die kleinen Raben wären von ihren Eltern im Stich gelassen oder noch schlimmer, sogar aus dem Nest geworfen worden. Die Geschichte von der Rabenmutter bzw. vom Rabenvater als schlechte Eltern geht aber auch zum Teil auf die Bibel zurück. Im Buch der Bücher heißt es im Alten Testament, Buch Hiob, Kapitel 31, Vers 41, in der Rede Gottes zum frommen Mann: „Wer bereitet dem Raben seine Nahrung, wenn seine Jungen schreien zu Gott und umherirren ohne Futter?“ Es war kein Geringerer als Martin Luther, der aus dieser Textstelle den Schluss zog, Rabeneltern würden ihre Jungen sträflich vernachlässigen. Kein Wunder also, dass sich schon im 16. Jahrhundert der negativ besetzte Begriff von den Rabeneltern in diversen Erziehungsratgebern wiederfindet. Doch genau das Gegenteil ist richtig: Raben sorgen sich geradezu rührend um ihren Nachwuchs, auch wenn die Jungen das Nest bereits verlassen haben. Die scheinbar schnöde im Stich gelassenen, am Boden hockenden Jungraben werden noch mehrere Wochen von ihren Eltern mit Futter versorgt und auch mit großem Eifer vor Fressfeinden geschützt.
Wer die beste Mutter im Tierreich ist, darüber lässt sich trefflich streiten. Nach Meinung einiger Zoologen ist die beste Mutter jedoch nicht etwa, wie das zu erwarten wäre, bei den Säugetieren oder Vögeln zu finden, sondern bei den Spinnen, genauer gesagt, bei der australischen Spinnenart Diaea ergandros. Die Weibchen dieser rund zwei Zentimeter großen, zur Familie der Krabbenspinnen gehörenden Spinnenart legen im Frühjahr etwa 40 Eier, aus denen dann im Sommer die Jungtiere schlüpfen. Nach dem Schlupf fängt die Mutterspinne kräftig Insekten, die sie jedoch nicht nur fleißig an ihre Jungtiere verfüttert, sondern auch nutzt, um sich selbst einen gewaltigen Bauch anzufuttern. Bricht jedoch der Winter an und es gibt kältebedingt keine Insekten mehr zu fangen, beginnt der Opfergang der Mutter, die sich ihrem Nachwuchs als lebende Speisekammer anbietet. Und die lassen sich das nicht zweimal sagen, sondern fressen die Frau Mama allmählich Stück für Stück bei lebendigem Leib auf. Sich nicht nur für die eigenen Kinder zu opfern, sondern sich von ihnen auch noch bei lebendigem Leib auffressen zu lassen – mehr Mutterliebe geht wohl nicht. Für dieses selbstlose Verhalten der Mutter hat die Wissenschaft übrigens auch eine stringente Erklärung gefunden: Es ist die sicherste Methode, um die Art zu erhalten, denn nur so wird verhindert, dass die Jungen sich bei Hunger gegenseitig auffressen.
Von ebenfalls sehr guten, aber mit Sicherheit den ungewöhnlichsten Müttern im Tierreich weiß man erst seit relativ kurzer Zeit, dass sie überhaupt existieren: Die Weibchen der sogenannten Magenbrüterfrösche. Der Südliche Magenbrüterfrosch wurde erst 1973 nahe der australischen Stadt Brisbane entdeckt, der nahe verwandte Nördliche Magenbrüterfrosch sogar noch neun Jahre später im Norden von Queensland. Magenbrüterfrösche haben, wie schon der Name verrät, eine höchst ungewöhnliche Art der Brutpflege: Das Weibchen verschluckt das vom Männchen besamte Eigelege und bewahrt es wohlgeschützt vor hungrigen Fressfeinden im Magen auf. Nach einer Weile schlüpfen im Magen dann die Kaulquappen und entwickeln sich innerhalb von zwei Monaten zu Jungfröschen. Das Weibchen kann aus verständlichen Gründen in dieser Zeit keine Nahrung zu sich nehmen. Um zu verhindern, dass sie von den Magensäften verdaut werden, produzieren die Larven im Magen der Mutter das Hormon Prostaglandin E2, das die Produktion von Magensäure hemmt. Die fertigen Jungfrösche schlüpfen dann nach einem kurzen Marsch durch die Speiseröhre aus dem Maul der Mutter. Ab und an spuckt die Mutter die Jungfrösche allerdings auch in hohem Bogen aus. Allerdings hat man seit mehreren Jahren keine Magenbrüterfrösche mehr entdeckt und geht heute davon aus, dass beide Arten leider „ausgestorben“ sind. Es wird vermutet, dass nicht etwa die etwas seltsame Brutpflege für das Aussterben verantwortlich war, sondern eine Pilzkrankheit.
Klein, aber trinkfest
So langsam hat es sich herumgesprochen: Nicht nur viele Menschen, sondern auch viele Tiere sind einem guten Tropfen nicht abgeneigt. Gesoffen wird dabei quer durchs Tierreich: Vögel, Igel, Elefanten, Eichhörnchen, Hunde, Elche und sogar Insekten – man hat schon eine Menge Tiere beim Alkoholkonsum beobachtet. Dabei gibt es Tierarten, die ausgesprochen trinkfest sind, andere Tierarten torkeln schon nach dem Konsum geringer Dosen Alkohol unkontrolliert durch die Gegend. Elche, die im Herbst gerne vergorenes Obst konsumieren, sind beispielweise relativ schnell betrunken, während Stare, so haben Frankfurter Wissenschaftler errechnet, außergewöhnlich trinkfest sind: Wären sie so groß und so schwer wie ein Mensch, könnten sie alle acht Minuten eine Flasche Wein trinken, ohne jemals betrunken zu werden. Eine relativ neue Studie von Wissenschaftlern der Universität von Alaska in Anchorage zeigt jetzt, dass auch Campbells Zwerghamster der Gruppe Tiere zuzuordnen ist, die sich problemlos eine ganze Menge Alkohol hinter die Binde gießen können. Bei Laborversuchen konnten die Wissenschaftler feststellen, dass die Hamster, rechnet man das Körpergewicht mit ein, rund zehnmal so viel Alkohol wie ein Mensch trinken können, bevor sie Anzeichen von Betrunkenheit zeigen. Aber wer oder was ist für diese verblüffende Tatsache verantwortlich? Die amerikanischen Forscher vermuten, dass der Grund für diese „Alkohol-Immunität“ mit dem Enzym Alkoholdehydrogenase zusammenhängt, das im Körper für den Alkoholabbau verantwortlich ist. Dieses Enzym kommt beispielsweise bei oben erwähnten Staren in rund 14-fach höherer Konzentration vor als bei Menschen, das heißt, die Piepmätze können Alkohol wesentlich schneller abbauen als wir. Nach Ansicht der Wissenschaftler handelt es sich bei der guten Alkoholverträglichkeit mancher Tiere um eine Präadaption der Evolution, die es Tieren ermöglichen soll, alkoholhaltige Nahrung, wie zum Beispiel im Herbst vergorene Früchte, zu verzehren, ohne gleich die Kontrolle über ihre Körperfunktionen zu verlieren.
Wenn es um den besten Vater im Tierreich geht, dann steht Campbells Zwerghamster im Ranking mit Sicherheit ganz weit oben. Von dem können sogar die allermeisten menschlichen Väter zumindest in Sachen Geburtshilfe noch eine Menge lernen. Die Männchen der kleinen Nager, die in den Steppen Russlands, der Mongolei und China zu Hause sind und sich dort von Kräutern und Grassamen, aber auch Insekten ernähren, stehen der Mutter ihrer Kinder schon beim Geburtsvorgang bei. Eine Hilfe, die sich jedoch nicht nur wie bei menschlichen Vätern auf mitfühlendes Pfötchenhalten bei den Strapazen der Geburt beschränkt. Nein, die Männer der rund neun Zentimeter großen Hamster leisten aktive Geburtshilfe und ziehen, ähnlich wie eine Hebamme, ihren Nachwuchs aus dem Geburtskanal des Weibchens. Danach befreien sie ihren Sprössling aus der Fruchtblase und belecken liebevoll die Nasenlöcher des Neugeborenen, um so für freie Atemwege zu sorgen. Nachdem der Geburtsvorgang unter tüchtiger Mitthilfe des Vaters erfolgreich absolviert worden ist, kommt es zu einem äußerst harmonischen, aber aus menschlicher Sicht doch gewöhnungsbedürftigen „Dinner for Two“. Herr und Frau Zwerghamster verspeisen in schönster Eintracht die Nachgeburt – sozusagen ein kulinarischer Abschluss der gemeinsamen Geburtsbemühungen.
Kanadische Wissenschaftler von der Queen’s University in Ontario haben mittlerweile auch herausgefunden, dass der Grund für diese im Tierreich wahrscheinlich einzigartige Hebammentätigkeit der Zwerghamsterväter in ihren Hormonen steckt. Im Gegensatz zu anderen Hamsterarten zeigen die Männchen von Campbells Zwerghamster in den Tagen vor der Geburt erstaunlicherweise Hormonveränderungen, die denen der werdenden Mutter ähneln und damit ihr fürsorgliches Verhalten plausibel machen: Vor der Geburt steigt im werdenden Vater der Östrogen- und Cortisolspiegel an. Unmittelbar nach der Geburt wird reichlich Testosteron ausgeschüttet und dadurch der Schutzinstinkt des Vaters aktiviert. Übrigens: Die geradezu rührende Fürsorge der Zwerghamstermänner hört keineswegs mit der Geburt des Nachwuchses auf. Ganz im Gegenteil: Die Männchen der kleinen Nager konterkarieren regelrecht das Bild vom Vater im Tierreich, dem die Zukunft seiner Jungen ziemlich egal ist. Sie betätigen sich nicht nur, entsprechend dem menschlichen Klischee, als Heimwerker und übernehmen Reparaturarbeiten am Bau, sondern halten Mutter und Kinder im Nest warm und sind sogar pflichtbewusste Babysitter, wenn sich das Weibchen auf Nahrungssuche begibt.
Eine Brutstrategie, die im Tierreich wohl einmalig ist, finden wir bei den vielleicht beliebtesten Aquarienfischen der Welt, den Diskusfischen. Sowohl das Weibchen als auch das Männchen dieser ausgesprochen farbenprächtigen Fische, die im Stromsystem des Amazonas leben, haben nach erfolgreicher Paarung eine ziemlich ungewöhnliche Funktion: Sie dienen ihrem frisch geschlüpften Nachwuchs als eine Art lebende Futterstelle oder lebendes Kinderrestaurant. Die Diskusfische produzieren in speziellen Hautdrüsen einen nährstoffreichen Schleim, einen regelrechten Powermix, der den Jungfischen als Nahrung dient. Will heißen, sie stellen ihre Babynahrung einfach selbst her. Die hungrigen Sprösslinge des Paares müssen sich zur Nahrungsaufnahme also lediglich an die Bauchseite von Mama und Papa begeben und dort nur noch das Nährstoffsekret direkt aus der Haut knabbern. Die Fütterung des Nachwuchses folgt dabei stets dem gleichen Prozedere: Wurde ein Elternteil komplett „abgeweidet“, übergibt es die Jungfische an den Partner respektive die Partnerin und macht sich dann sofort daran, in einer Art Regenerationsphase neuen Nahrungsschleim zu produzieren. Die Übergabe der hungrigen Fischsprösslinge ist dabei regelrecht ritualisiert. Das abgeweidete Elternteil schüttelt die Jungfische durch heftige Körperbewegungen ab und das noch mit reichlich Schleim ausgestattete Elternteil winkt sie mit den Flossen herbei.
Die Diskusfischeltern sorgen aber nicht nur für eine ausreichende Ernährung ihres Nachwuchses, sondern kümmern sich auch um die Gesundheit ihrer Kinder: Sie versorgen ihre Sprösslinge über die „Schleimmahlzeit“ mit großen Mengen lebensnotwendiger Mineralstoffe, wie etwa Kalium, Kalzium und Natrium. Und das nicht nur nebenbei, sondern ganz gezielt: In der freien Natur leben Diskusfische oft in sehr mineralstoffarmen Gewässern, müssen also mit ihrem Mineralhaushalt äußerst sparsam umgehen. Aus diesem Grund hat die Schleimschicht der Fische im Normalfall nur einen geringen Gehalt an Mineralstoffen. Produzieren die Diskusfische allerdings Schleim für den Nachwuchs, erhöhen sie den Mineralstoffgehalt um das Zehnfache. Dadurch ist eine ausreichende Mineralstoffzufuhr für die Jungtiere gesichert. Und als ob das alles noch nicht genug wäre, erhalten die Jungfische mit jeder Mahlzeit noch eine ordentliche Portion an Immunglobulinen – Eiweißen, die eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Krankheitserregern im Blut spielen. Die Immunglobuline, die typischerweise eine Y-Form haben, halten Krankheitserreger wie eine Zange fest und lassen sie verklumpen, bis sie von sogenannten Killerzellen endgültig unschädlich gemacht werden. Die Jungfische sind dringend auf diese „Immunglobulingabe“ der Eltern angewiesen, da ihr eigenes Immunsystem zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig ausgebildet ist. Es handelt sich also um eine elterliche „Abwehrkräftespende“, wie sie – wenn auch in anderer Form – auch bei uns Menschen vorkommt. Auch wir nehmen als Säugling Immunglobuline mit der Muttermilch auf.
Die ersten drei Tage ihres Lebens ernähren sich die Jungfische ausschließlich vom Nahrungsschleim ihrer Eltern. Aber etwa ab dem vierten Lebenstag beginnen die kleinen Fische damit, so allmählich auf „frei lebendes“ Futter umzusteigen und verputzen das eine oder andere kleine Krebschen. Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass der Nachwuchs immer noch fast zwei Wochen lang auf den Schleim als Grundnahrungsmittel angewiesen ist. Aber irgendwann schließt auch ein „lebendiges Kinderrestaurant“ und ab der dritten Woche kann man einen regelrechten Abnabelungsprozess beobachten, der aktiv von den Eltern betrieben wird: Mutter und Vater Diskusfisch lassen die hungrigen Sprösslinge gerade noch mal eine Minute an ihrem Schleim knabbern, bevor sie den Nachwuchs ziemlich ungehalten durch kräftige Körperbewegungen abschütteln. Und ab der vierten Woche geht in Sachen Kinderrestaurant gar nichts mehr: Nähert sich ein hungriger Jungfisch, um eine leckere Schleimhautmahlzeit zu sich zu nehmen, suchen die Elternfische mit großer Konsequenz das Weite. Schließlich muss ihre Haut nun wieder über einen längeren Zeitraum regenerieren.