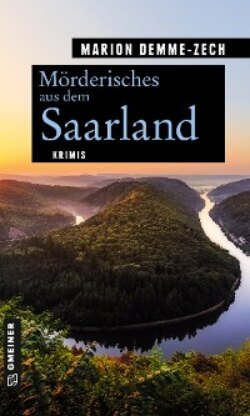Читать книгу Mörderisches aus dem Saarland - Marion Demme-Zech - Страница 7
Wir haben es uns nicht ausgesucht
ОглавлениеManche ergänzen sich perfekt, so wie Tim und Struppi oder Flipper und sein Freund Sandy, andere wiederum stoßen sich ab wie die Pole zweier Magneten. Sie sind so harmonisch wie Feuer und Wasser oder – um es noch eindrücklicher zu beschreiben – wie die Kombination von Fleischkäse und Tofuwurst. Da passt rein gar nichts, und es liegen ganze Welten, wenn nicht sogar Sonnensysteme, dazwischen. Genau diese Rahmenbedingungen treffen auf Wolfgang und mich zu. Ich kann den Kerl nicht ausstehen, und ihm geht es allem Anschein nach mit mir kein bisschen anders.
Ungeachtet dessen haben mich Siggi und Hanne dieser Situation ausgeliefert, aus reinem Egoismus. Während sie die Sechstageradtour auf dem Saar-Radweg antreten, ihr Aufbruch ist noch keine drei Stunden her, soll ich die Zeit bei Gabriele in ihrem Haus in Besseringen verbringen. Ein pures Lockangebot, einzig um mich gefügig zu machen, und ich bin eiskalt auf die Nummer hereingefallen. So wie die armen Omas beim Enkeltrick.
Ein paar Tage bei Gabriele, das klang in meinen Ohren wie ein Wellnessurlaub. Hannes beste Freundin liebt mich abgöttisch, und genau wie ich pflegt sie mit Hingabe ihre romantische Ader. Immer nennt sie mich »Güntherlein« und überdies schaut sie nicht nur für ihr Leben gerne Liebesfilme, sie liest auch unglaublich viel. Allesamt Romanzen. Während ich also an diesem ersten Morgen der Fremdunterbringung zu ihren Füßen liege und von der südenglischen Küste träume, lausche ich Gabrieles zarter Stimme und meine Nase verrät mir, der Tag wird noch besser. Schließlich köchelt der Schmorbraten seelenruhig in der Küche. Gabriele ist kulinarisch eine Virtuosin, was man von Herrchen und Frauchen leider nicht behaupten kann. Nur deshalb gönne ich Siggi und Hanne die Woche Urlaub von Herzen. Sollen sie sich ruhig in ihren freien Tagen abstrampeln, ich habe hier mein ganz eigenes kleines Paradies.
Zumindest hat es zu Beginn diesen Anschein. Viel zu schnell muss ich erkennen, dass es sich lediglich um halbherzige Zusicherungen gehandelt hat, die der Realität schon am ersten Tag nicht standhalten. Gerade eben haben Siggi und Hanne den Drahtesel bestiegen und sind damit für mich unerreichbar, da klingelt bei Gabriele das Telefon.
»Och ne, oder? Das ist die Nummer vom Gartenbistro, da muss ich leider ran«, höre ich neben mir. Meine Vorleserin klappt »Mitten hinein in den Sturm der echten Liebe« zu und legt das Buch zurück auf den Wohnzimmertisch. Verstört schaue ich auf: Was ist denn das? Genau jetzt, wo es spannend wird. Ich will unbedingt wissen, ob der französische Winzersohn Didier der bezaubernden, aber etwas naiven Gutsbesitzerin Rose trotz Verlobung mit einer gutdotierten Bauunternehmertochter einen Antrag macht. Oder ob er sich von den gemeinen Intrigen seiner Mutter täuschen lässt. Sie arbeiten mit perfiden Methoden dort in Südengland.
Ungnädig spähe ich von der Kuschelecke auf der Ledercouch hinaus in die doch oft so ungerechte Welt. Gabriele hat mir ein federweiches Lager bereitet, damit ich nicht wegen des kalten Leders friere, und mein festes Vorhaben ist es, diese perfekten Umstände maximal zum Essen zu verlassen und höchstens einmal, um einen Bach zu machen. Obwohl mir gerade eben der Gedanke im Kopf herumgeschwirrt ist, dass es Gabriele sicher eine Freude bereiten würde, mich direkt vor Ort zu füttern. Sie liebt es, andere zu bemuttern, und ich tue alles dafür, dass es ihr gut geht.
Doch all diese wundervollen Pläne stehen mit einem Mal auf der Kippe.
»Aber diese Woche sollte ich eigentlich frei haben. Das war doch …« Kurze Pause. Mein Teilzeit-Frauchen legt die Stirn in Falten. Von der anderen Seite hört man erneut hektisches Gemurmel. Keine Ahnung, was die Kollegen vom »Garten der Sinne« von meiner Gabriele wollen. Was immer es ist, sie ist fest gebucht für die kommenden Tage, sage ich mir. Die Gartenanlage oben auf der Ell wird auch mal eine Woche ohne Gabriele zurechtkommen müssen. Da gibt es kein Wenn und Aber und Diskutieren! Versprochen ist versprochen.
Gabriele allerdings ist, was die Bedürfnisse anderer angeht, viel zu gutherzig, und so sagt sie doch wahrhaft den Satz, der das Kartenhaus schon halb zum Einstürzen bringt: »Ich komme!«
Na super!
Kurz darauf beendet sie das Telefonat und setzt mich schonungslos über ihr Vorhaben in Kenntnis: »Güntherlein, kleine Programmänderung. Was hältst du davon, wenn du Hendrik für ein paar Stündchen besuchst? Vielleicht hat er Zeit. Gegen sechs bin ich wieder da.«
Ich überlege. Zugegeben, die Idee ist noch recht okay. Hendrik, Gabrieles Sohn, der in Saarbrücken in einer Studenten-WG wohnt, ist ein cooler Typ. Es ist zwar nicht ganz das, was mir versprochen wurde, doch wir könnten mit dem alten 3er, den Gabrieles Sohn meinem Herrchen Siggi abgeschwatzt hat, auf Tour gehen.
Na gut, denke ich mir, wenn jemand flexibel ist, dann wohl ich. Gabriele zuliebe akzeptiere ich das Angebot, erwarte jedoch für das selbstlose Einlenken später die doppelte Portion Schmorbraten. Von dieser Idee getragen, erhebe ich mich gut gelaunt aus dem Kuschelnest und signalisiere mit aufgeregter Rute meine Bereitschaft, den Deal einzugehen.
»Na, mal schauen, ob er überhaupt Zeit hat.« Gabriele lächelt mir zu, während sie seine Nummer eingibt.
Auf der anderen Seite der Leitung meldet sich jemand mit: »Jep.«
»Hendrik, hab ich dich geweckt?«
Ich rücke dichter an Gabriele heran, um mitzuhören. Hendrik klingt verschlafen. Aber kein Problem: Soll er erst mal eine Tasse starken Kaffee trinken, und wenn wir später bei all der Frischluft im Cabrio durch die Gegend touren, wird er schon richtig munter werden.
»Ähm, hab bis eben gedöst«, nuschelt mein potenzieller Aufpasser. Er hört sich nicht gut an, Gabriele muss die Nummer mit der Vertretung wohl oder übel canceln. Der Stimme nach zu urteilen, hat ihr Sohn eine beachtliche Menge Restalkohol im Blut.
»Ist Leonie da?«
»Öh, ne. Ich glaube … Moment, warte, sie ist gerade auf der Toilette …« Hendrik redet im Flüsterton. »Ich glaube, sie heißt Svenja.«
»Svenja? Kenne ich nicht.«
»Na, ich auch erst seit gestern Abend. Ist ein bisschen älter als ich, aber ganz lustig. Sie hatte ziemlichen Liebeskummer und na ja …« Hendrik ist weit ehrlicher, als es für seine Mutter nötig wäre.
Gabriele sieht mich an und schüttelt den Kopf. Ganz eindeutig: Ihr Sohn ist für heute keine Lösung. Da sind wir beide einer Meinung.
»Nun, da will ich nicht länger stören. Ich melde mich später. Bis dann«, beendet sie das Gespräch und legt auf.
Na gut, denke ich mir. Wir haben es versucht, aber da ist leider kein Ersatz in Sicht. Demzufolge muss Gabriele wohl die Geschichte mit dem Garten der Sinne abblasen. Doch meine Aufpasserin ist da anderer Ansicht. Statt das Telefon zur Absage zu nutzen, verfügt sie: »Ach, weißt du was? Ich rufe einfach mal den Wolfgang an. Er hat heute frei und wollte am Mittag sowieso zu uns kommen. Ist doch prima! Vielleicht kann er einspringen.«
Äh ne, der Wolfgang, schießt es mir durch den Kopf. Dass Gabriele unbelehrbar ist und ihrem Exmann eine zweite Chance gibt, ist für mich nicht zu verstehen. Wo die Liebe hinfällt, kann man da nur sagen. Oder vielleicht eher: Liebe macht blind. Im Falle von Gabriele so blind wie ein Maulwurf.
Was das angeht, muss jeder selbst entscheiden. Da bin ich tolerant, solange mir dieser überkorrekte Hilfssheriff, der Hanne und Siggi immerzu predigt, mich mit einem der furchtbar engen Halsbänder an die Kette zu legen, von der Pelle bleibt. Mich dem zu überlassen, grenzt an Fahrlässigkeit.
Tag und Nacht prahlt er, wie wahnsinnig toll ihre Polizeihundestaffel im Saarland sei und was da für pfiffige Strebertypen dabei wären. Durch die Blume will er Siggi und Hanne damit natürlich etwas anderes sagen: Das sind alles keine verwöhnten Vierbeiner wie euer Günther. Wenn der selbstgefällige Freund und Helfer so daherredet, hört er sich an wie diese Opas, die stundenlang vom Krieg erzählen. Dass heute bei einem Hund andere Werte zählen, checkt er nicht.
Auf die Nummer mit Oberschlauberger Forsberg, dem Spaßkiller schlechthin, hat mich niemand vorbereitet und den Wolfgang wiederum auch nicht. Gabriele überfährt ihn am Telefon einfach mit ihrer Frage. Als sich Herr Neunmalklug von der Idee ebenfalls nicht sehr begeistert zeigt, sagt sie sofort: »Früher wolltest du immer einen Hund.«
»Ja, einen Hund, aber Günther …« Er bringt den Satz nicht zu Ende. Einzig und allein, weil er es sich nicht mit Gabriele verscherzen möchte. Statt hart zu bleiben und mir den Nachmittag zu retten, lässt er sich erweichen: »Nun gut, wenn du Hilfe brauchst, springe ich natürlich ein!«, balzt er durchs Telefon. »Für dich, mein Schatz, mache ich alles. Sogar auf den verzogenen Fiffi aufpassen.«
Verzogenen Fiffi! Ich vergrabe mich in meine Kuschelhöhle, und ich schwöre, bis 18 Uhr – denn dann ist Feierabend an der Kasse der Gartenanlage – nicht herauszukommen. Das gehörte nicht mit zur Abmachung. Mir hat vorab niemand mitgeteilt, dass Herr Oberlehrer Dauergast in meinem Feriendomizil sein wird.
»Hast du gehört? Der Wolfgang kommt. Das wird ein Spaß«, droht mir Gabriele in bester Laune an, nachdem sie aufgelegt hat. »Ich mache schnell noch den Schmorbraten fertig, und dann habt ihr zwei das Haus für euch alleine.«
Beim Wort Schmorbraten hebe ich kurz den Kopf. Immerhin gibt es noch den Braten zum Trost, sage ich mir. Immerhin!
Es dauert keine Viertelstunde, da ist der Gute-Laune-Killer vor Ort und setzt sich prompt an die gedeckte Tafel.
»Oh, schau an. Da habe ich ja richtig Glück gehabt, als Hundedompteur engagiert worden zu sein.« Mit lüsternen Augen fixiert er den Schmorbraten auf dem Tisch, genau wie ich. Die Rotweinsoße kitzelt in meiner Nase. Gabriele hat das kulinarische Kunstwerk mit ganzen gedünsteten Möhren und Kohlrabi-Stiften drapiert, über die sie einen Klecks zerlassene Butter gegeben hat. Was für ein Anblick – was das angeht, sind Wolfgang und ich uns zu 100 Prozent einig.
»Die Möhrchen mit etwas Grün sehen toll aus«, stellt er fest und Gabriele lächelt. »Und erst die Spätzle«, schleimt er sich weiter ein. »Sag nur, das sind …«
»Kastanienspätzle!«, vollendet meine Gabriele seinen Satz und gibt dem Superkommissar dazu auch noch einen Kuss auf die Wange. Bäh! Ich schaue lieber weg und sinne über die Aufteilung nach: Gemüse und Spätzle für den Herrn, der Braten für mich, entscheide ich großzügig und mache mit einem Wimmern auf mich aufmerksam – anders geht es heute anscheinend nicht.
»Gibst du Günther bitte auch gleich ein Stück? Sein Napf steht in der Küche.«
»Du willst dem Hund doch nicht etwa vom Tisch geben?«, brummt Wolfgang.
»Hanne meinte, das wäre kein …«
»Dass die beiden den Hund restlos verziehen, ist mir klar«, wirft der Besserwisser ein.
Da ist er eingeladen in unserem Haus und lässt die Gastgeberin nicht mal ausreden, denke ich empört. Gabriele schluckt ebenfalls und springt heldenhaft für mich in die Bresche. Die Gutherzige. »Die eine Woche kann doch wohl kaum schaden«, hält sie dagegen. »Güntherlein soll sich schließlich wohl bei uns fühlen.«
»Güntherlein«, murmelt Wolfgang in einem Tonfall, der Bände spricht. Mir wird ganz komisch und ich lasse die Ohren hängen.
Ein weiteres Mal versucht Gabriele zu vermitteln. »Ach, Wolfgang. Gibt dir einen Ruck, unser Güntherlein ist so ein süßer Kerl. Machst du das bitte? Versprochen?« Sie sieht Wolfgang mit großen Augen an und dem Blick kann niemand widerstehen – schon gar nicht der Hilfssheriff vor uns.
»Hm, also gut«, lenkt er ein und sein Mund verzieht sich zu einem Grinsen. Es ist ein eiskaltes, frostiges Lächeln, das mir Angst macht.
Gabriele offensichtlich nicht. »Super, du bist ein Riesenschatz«, lobt die Gutgläubige den Widerling, der sie noch zur Tür begleitet. Dort folgt wieder Knutscherei, und schon fällt die Tür ins Schloss. Ich schlucke. Jetzt bin ich mit dem Bluthund allein.
»So, Güntherlein«, tönt es bissig aus dem Flur. Wolfgang kehrt zurück, um erneut am Tisch Platz zu nehmen. Provozierend setzt er sich mir gegenüber, nimmt sich eine Scheibe vom Schmorbraten und legt ihn auf seinen Teller. Er überlegt kurz und platziert dann ein zweites Stück darauf.
»Jetzt kommt die Zeit der Neuorientierung«, kündigt er an und greift zur Sauciere. »Es weht ein anderer Wind, verstehst du, was ich meine, Güntherlein?«
Nein, ich verstehe gerade rein gar nichts. Der Geruch und der Anblick des Essens auf Wolfgangs Teller nehmen meine Sinne vollends in Anspruch. Er will mir doch hoffentlich nicht noch mehr von meinem Anteil rauben, befürchte ich. Da langt das Monster wieder zu.
Ein, zwei, drei, nein, sogar vier Schöpflöffel ergießen sich über den mittlerweile in Soße ertrunkenen Braten. Die Maronenspätzle häufelt Wolfgang von allen Seiten dazu, um zuletzt drei Möhrchen obenauf zu stapeln. Der Teller ist so brechend voll, dass ein einziges Reiskorn vermutlich eine mittelschwere Lawine auslösen würde.
Nervös tripple ich von einem Pfötchen auf das andere. Huhu! Ist da nicht noch etwas? Ein Versprechen? Für einen Paragrafenreiter wie den Forsberg muss so was doch eine Bedeutung haben?
»Ah, du wolltest auch was?«, reagiert Wolfgang endlich. Wie gesagt, ich mag den Kerl nicht, aber ich schätze, was sein Wort betrifft, ist er zuverlässig. Voller Vorfreude schlecke ich mir mit der Zunge über meine Schnauze. Hunger, das ist das Gefühl, das in dieser Sekunde vorherrscht. Wolfgang nimmt den Salatteller, den Gabriele für ihn bereitgestellt hat, und platziert darauf das winzig kleine Endstück vom Schmorbraten. Einen Daumen oder höchstens anderthalb breit.
»Versprochen ist versprochen«, sagt Wolfgang in einer derart gehässigen Weise, dass ich ihn am liebsten ins Hosenbein beißen würde. Aber bei einem Polizisten spare ich mir das besser, die wissen sich zu wehren.
»Das kleine Güntherlein kommt dann mal mit«, fordert er in einem zuckersüßen Ton und steht auf. Von der gedeckten Tafel greift er sich im Vorbeigehen noch ein paar Kohlrabistifte und zwei, drei Möhrchen. Was soll denn das, frage ich mich. Will er mich etwa zum Veganer umerziehen? Davon kann ich krank werden.
»Vitamine können nie schaden«, behauptet mein Aufpasser, trabt in die Küche und macht sich auf einem Schneidebrett an sein ungeheuerliches Werk. Mit einem großen Fleischmesser hackt er alles, was er zuvor aufgetürmt hat, lieblos in hässliche Fetzen – das Drama schiebt er mit der Klinke vom Brett direkt in meinen Plastikfressnapf. Den, den Siggi und Hanne nur pro forma eingepackt haben, denn für gewöhnlich speise ich von feinster Keramik. Ich blicke geknickt auf das Ergebnis im Napf, fiepe und sehe Wolfgang erwartungsvoll an. Das traurige Etwas da soll ich doch nicht ernsthaft meinem Körper zuführen? Das kann nicht sein Ernst sein: Erst mal ist das viel zu spärlich und zweitens absolut unter meiner Würde.
»Ist das nicht gut genug für den kleinen Feinschmecker?«, stellt Wolfgang nun endlich die richtige Frage.
Korrekt, denke ich, der Junge hat es erkannt.
Doch gar nichts checkt er. Wolfgang packt das Trockenfutter aus der Ecke, das Gabriele sicherheitshalber besorgt hat, falls es mir nicht schmecken sollte, was eigentlich bis eben außer Frage stand. Er reißt die Packung auf und schüttet eine Ladung davon in den Napf. Mir wird fast übel bei dem Anblick.
»Besser so?«, fragt der Soziopath gehässig.
Ich drehe meinen Kopf weg – schon lange hat mich niemand mehr so beleidigt. Bevor ich den Fraß anrühre, sterbe ich lieber.
»Ist dem Herrn Günther wohl nicht exquisit genug«, säuselt Wolfgang. »Na, da kann ich helfen.«
Er greift in Gabrieles Kräutertopfecke und pflückt ein Stück Petersilie heraus, das er zwischen die Trockenfutterkringel steckt. Die Freude, die ihm all das bereitet, ist unübersehbar. Mit einem fiesen Lächeln fügt er hinzu: »Lass es dir schmecken, Güntherlein.«
Ich hasse ihn. Abgrundtief. Weit mehr, als je ein Hund einen Menschen gehasst hat. Doch auch das kümmert den Tierfeind wenig. Als wäre nichts geschehen, macht er auf dem Absatz kehrt und lässt mich mit dem Elend an Hundefraß allein.
Aus dem Wohnzimmer höre ich ihn schmatzen und das, während ich in der Küche quasi am Verhungern bin. Das interessiert Wolfgang nicht die Bohne, anscheinend hat er sich sogar den Fernseher angemacht. Irgendetwas Brutales, das passt zu ihm. Laute Schüsse fallen und ich wünsche mir, die wären echt.
Eine gute halbe Stunde tripple ich in der Küche auf und ab. Bei Hanne und Siggi zieht das immer. Irgendwann traben sie mit einem schlechten Gewissen an, und spätestens da ist eine dicke Scheibe Lyoner fällig. Doch Wolfgang ist immun gegen jede Form von Mitgefühl – ein Herz aus Vulkangestein. Er gibt nicht nach und ich schon fünfmal nicht. Keinesfalls! Die Pampe im Napf rühre ich nicht an, selbst wenn mein Magen bereits ein wahres Konzert veranstaltet.
Keine Ahnung, wie lange ich in der Küche schon vor mich hin geschmort habe – ganz ohne Schmorbraten –, als die Unglücksbotschaft eintrifft. Die Titelmusik vom Tatort, der Klingelton des Hilfssheriffs, mischt sich in die Dauerschießerei im Wohnzimmer und bereitet der Essenstragödie urplötzlich ein Ende. Wie schnell werden solcherlei Querelen nebensächlich – wenn ein echtes Unglück passiert.
»Hallo, Hase. Ist bei dir alles klar?«, höre ich. Im gleichen Moment schweigt der Fernseher.
Heimlich, still und leise tapse ich in den Flur. Das will ich haarklein mitbekommen. Bombensicher macht Gabriele Wolfgang wegen der Schmorbratenaktion in dieser Sekunde die Hölle heiß, überlege ich.
»Was sagst du? Ein Kerl mit Sturmmaske … schließt die Türen! Sofort! Und bringt euch in Sicherheit. Weiß die Polizei Bescheid? Gabriele, hallo … Hase, hörst du mich?« Wolfgangs Miene verdüstert sich. Als er noch einmal versucht, Gabriele an den Apparat zu bekommen, meldet sich niemand. »Gar nicht gut«, murmelt er und tippt erneut auf seinem Handy herum. »Herbert, hier ist Wolfgang. Schick bitte mal zwei Streifenwagen hoch zur Ell zum Garten der Sinne. Da scheint sich ein vermummter Typ herumzutreiben. So schnell wie es geht, bitte!«
Mir wird heiß. Irgendetwas stimmt bei Gabriele nicht. Das macht mir Angst. Was, wenn ihr etwas passiert? Das wäre eine Katastrophe. Wo soll ich dann die Woche über unterkommen?
»Super. Danke! Ich bin auch gleich da«, sagt Wolfgang in meine Gedanken hinein und springt auf. Der Teller mit dem Schmorbraten steht halb verzehrt vor ihm. Was für eine Verschwendung!
Obwohl …, denke ich. Mit ein bisschen Glück bin ich den Knaben bald los. Was soll ich als Dackel dort schon ausrichten können? Ich halte hier die Stellung, und er kann den großen Retter spielen und am besten Gabriele gleich danach mit nach Hause bringen. Doof nur, dass jetzt der Fernseher aus ist.
»Los, auf, Günther!«
Der Schlachtplan von Wolfgang sieht offensichtlich anders aus: Ich soll mit. Warum gerade ich? Sonst heißt es doch immer, ich sei ein verhätscheltes, kleines Schoßhündchen. Sind in einer solchen Angelegenheit die Helden von der Hundepolizeistaffel nicht weit eher gefragt?
Doch Herr Hauptkommissar kennt keine Gnade. Ein paar Augenblicke später stehen wir vor seinem Kombi.
»Rein mit dir!«, sagt Wolfgang mit einer Stimme, die keinerlei Widerspruch zulässt. Der Kerl bugsiert mich in den Kofferraum und dort muss ich hinter den hochgezogenen Gittern verharren wie ein Strafgefangener. Voller Angst und halb verhungert, so fährt er mich in einem Affenzahn in die Kampfzone, dabei bin ich Pazifist.
Von Besseringen aus brauchen wir länger als Wolfgangs Kollegen. Als wir oben am Parkplatz des Gartens der Sinne vorfahren, sichern Beamte das Gelände ab.
»Mensch, was ist denn hier los?«, höre ich Wolfgang zu sich selbst sagen.
Sogar ein Krankenwagen mit Blaulicht steht parat. Das komplette Programm. Die Atmosphäre ist noch finsterer als bei einer Folge vom Saar-Tatort, und da kann ich schon kaum hinsehen.
Wolfgang steigt aus und ich bete, dass er mich hier hinten vergisst. Doch Pustekuchen, auch dieser Wunsch erfüllt sich nicht. Herr Kommissar öffnet mir mit der Instruktion »Du bleibst bei Fuß« den Kofferraum. Bedauerlicherweise, denn im Auto hätte ich mich weitaus sicherer gefühlt als dort draußen, wo es nur so von aufgeregten Sicherheitskräften wimmelt.
Wolfgang zückt seinen Dienstausweis und zeigt ihn einem Kollegen, der nervös an einem Polizeiwagen mit dem Funkgerät hantiert und vermutlich auf weitere Anweisungen wartet.
»Forsberg, Kripo Saarbrücken, was ist passiert?«, erkundigt Wolfgang sich.
»Fiedler. Es gab eine Bombendrohung.«
»Was?« Wolfgang schüttelt ungläubig den Kopf. »Das ist bestimmt ein Dummejungenstreich. Kommt doch ständig …«
»Diesmal eher nicht«, fällt ihm der Kollege ins Wort. »Der Bombenleger hat sich mit einer Reihe von Geiseln im Bistro verschanzt, und so wie er sich eben angehört hat, ist es ihm todernst.« Nervös knabbert der Beamte auf seinen Lippen herum und blickt auf das Bistrogebäude, das circa 150 Meter von uns entfernt liegt.
»Geiseln?« Wolfgang wird blass. »Wissen Sie, wer sich dort drinnen aufhält?«
»In jedem Fall der Attentäter, ein paar der Angestellten vermutlich und eine Handvoll Gäste. Wir schätzen etwa zehn bis zwölf Personen.« Der Polizist wirkt überfordert. »So was hatten wir noch nie hier. Die Saarbrücker schicken das SEK. Bis dahin müssen wir die Stellung halten.«
»Hat der Geiselnehmer sonst noch was gesagt?«
Der Beamte strafft die Schultern, als er weiterredet: »Ja, hat er. Das ist ein Psychopath, wenn Sie mich fragen. Als wir am Eingang eintrafen, sahen wir den Kerl hinter der Scheibe. Komplett in Schwarz, er wirkte vollkommen irre. Er hatte einen Fernzünder in der Hand und drohte uns, die Bombe zu zünden, falls wir auch nur einen Schritt näher kommen. ›Zwei Millionen!‹, brüllte er. ›Und keinen Cent weniger.‹ Er will einen Wagen. ›Sonst geht hier innerhalb von Sekunden alles in die Luft‹, das waren seine Worte. Wir haben nur eine Stunde, um Geld und Auto zu besorgen.«
»Zwei Millionen? In einer Stunde?«, wiederholt Wolfgang und schüttelt fassungslos den Kopf. Er denkt wohl das Gleiche wie ich, die Forderung wird man in der Kürze der Zeit nicht erfüllen können.
Dieser Fiedler nickt. »Wahnsinn«, sagt er mit gepresster Stimme. »Eigentlich hatte ich heute frei und bin nur für einen kranken Kollegen eingesprungen.«
Das riecht verdammt nach Ärger, resümiere ich für mich. Ein Blick in Wolfgangs Gesicht verrät mir, dass wir uns immerhin in dem Punkt einig sind. Vermutlich sind seine Gedanken in diesem Moment bei Gabriele, wie meine auch. Dem zarten Seelchen, das dort drinnen gerade ein Martyrium durchmacht.
»Überlegen Sie sich genau, wie Sie in der Angelegenheit vorgehen. Ein falscher Schritt und Sie können Ihre Uniform an den Nagel hängen«, droht Wolfgang an und geht zurück zum Wagen.
Sekündchen, denke ich. Mister Superkommissar plant doch wohl nicht, sich aus dem Staub zu machen. Will er seine Frau etwa ohne Gegenwehr dem Irren überlassen?
»Ab mit dir ins Auto«, befiehlt Wolfgang, nachdem er den Kofferraum wieder geöffnet hat. Er streckt seine Arme nach mir aus.
Vergiss es, denke ich und tripple ein paar Schritte zurück. Glatte Befehlsverweigerung, und das aus gutem Grund. Zwar mache ich vor Angst fast unter mich, trotzdem steht eins fest: Gabriele lasse ich nicht im Stich. So feige wie Wolfgang bin ich nicht.
Doch vielleicht täusche ich mich auch in ihm. Zumindest kommen mir bei seinem nächsten Satz Zweifel, ob ich wirklich immer gerecht zu ihm gewesen bin. »Günther, bitte! Ich kann dich jetzt ehrlich nicht gebrauchen. Abzuwarten, bis das SEK einläuft, ist Wahnsinn. Bis dahin könnte es zu spät sein.«
Wolfgang hat recht. Aber – und das entscheide ich innerhalb weniger Sekunden – zu zweit einzugreifen, ist weit besser als allein. Statt also artig einzusteigen, helfe ich dem Herrn Kommissar lieber auf die Sprünge und starte einen Run in weitem Bogen um die Polizeisperre. Das dort vorne ist nicht der einzige Eingang, zumindest nicht, wenn man ein Dackel ist und schon unzählige Besuche mit Hanne bei ihrer Freundin Gabriele miterlebt hat. Es gibt da eine Stelle im Zaun, hinter dem Gartentheater, ideal für ein schlankes Persönchen wie mich. Für Wolfgang, den Doppel-Schmorbraten-Vertilger, könnte es eng werden. Er muss vermutlich nach einer Alternative Ausschau halten. Aber niemand hat behauptet, dass die Sache leicht wird. Mein Plan ist in jedem Fall tausendmal besser, als einfach nur abzuwarten.
Bis Wolfgang erfasst, was ich vorhabe, dauert es eine Weile. »Du Spatzenhirn an Köter machst nichts als Ärger«, beschimpft er mich mit dem wenigen Atem, der ihm noch bleibt, denn nach dem üppigen Mittagessen kostet es ihn Mühe, hinter mir herzuspurten. An fiesen Ideen fehlt es ihm trotzdem nicht. »Du kriegst eine Panzerkette als Halsband, wenn ich dich erwische. Glaub mir das, du Töle!«
Ganz schön boshafte Drohungen für einen Teamkollegen, sage ich mir, während ich unbeirrt weiterjage. Gerade ist nicht der richtige Zeitpunkt, um überempfindlich zu sein. Wenn der kaltherzige Herr Superkommissar erst erkennt, was ich aushecke, wird er bereuen, mir all diese Unverschämtheiten um meine Dackelohren geschleudert zu haben.
Gleich sind wir da. Dort hinten ist das Loch im Zaun. Manchmal erweist es sich als vorteilhaft, derart klein zu sein. Wolfgang müht sich über die Abzäunung und zugegeben stellt er sich dabei nicht so schwerfällig wie erwartet an. Es dauert keine 20 Sekunden, da steht er neben mir.
Nach wie vor der Meinung, er sei der Leiter dieser Ausnahmeeinheit. »Okay, das war nicht dumm, Günther. Wir versuchen es miteinander«, sagt er im Befehlston. »Aber keine Alleingänge mehr, sonst gibt es zukünftig nur noch Möhrchen.« Wolfgang hat eine seltsame Art, seine Kollegen zu motivieren, stelle ich fest, aber auch das schlucke ich Gabriele zuliebe runter.
Gemeinsam setzen wir mit einem Sprung über den Wasserlauf und schleichen in Richtung Farbgärten. Vorbei geht es am Irrgarten, der kleinen Weiheranlage und dem Hühnergehege. An den Hainbuchenhecken suchen wir immer wieder von Neuem Deckung. Hier, wo sich sonst eine Menge Touristen herumtreiben, ist es heute, an diesem verfluchten Sonntag, gespenstisch still. Nicht mal die Grillen zirpen.
Das Bistro kommt in Sichtweite. Wir nähern uns über den Kinderspielplatz. Überall um den Wasserplatz verstreut liegen Schippen und Förmchen, nun heißt es, vorsichtig zu sein, denn wir dürfen nirgendwo drauftreten. Jedes noch so zarte Geräusch löst vielleicht eine Katastrophe aus.
»Ihr rührt euch keinen Millimeter!«, hören wir beim Näherkommen. Das Geschrei stammt offenkundig vom Geiselnehmer. Die Worte »vollkommen irre«, die der Polizist auf dem Parkplatz als Umschreibung genutzt hatte, treffen ins Schwarze. Der Ton ist beängstigend. Dort in dem kleinen Gebäude agiert kein abgebrühter Krimineller, der einen festen Plan verfolgt, sagt uns das. Leider haben wir es wohl mit einem kopflosen Wahnsinnigen zu tun, und das macht die Angelegenheit keineswegs leichter.
»Wenn nicht in den nächsten Minuten etwas geschieht, wird es wohl einen von euch Hübschen den Kopf kosten«, droht der Psycho an. Ich vernehme unterdrücktes Weinen von mehreren Personen. Die Tür zum Außenbereich steht etwa einen Meter weit offen, allem Anschein nach rechnet der Geisteskranke nicht damit, dass man von hinten angreifen könnte, oder er hat diese Option schlichtweg übersehen. Zum ersten Mal erhasche ich einen Blick auf den Mann in Schwarz. Er hat alle Geiseln in eine Ecke gedrängt und geht mit einem Zünder in seiner Hand auf und ab. Auf dem Tresen liegt ein langes Küchenmesser, das greift er sich nun. »Wen sollen wir nehmen?«, fragt er, und es klingt, als würde ihm dieser letzte Satz besondere Freude bereiten.
Das Schluchzen wird lauter. Durch die Scheibe erkenne ich, dass die Menschen am Boden sich noch näher zusammenkauern.
»Kein Freiwilliger?« Der Mann genießt es offenbar, die Geiseln zu quälen. »In dem Fall muss ich mich wohl selbst entscheiden. Ich schätze, ein Kind wäre die beste Wahl. Das macht Eindruck! Oder was meint ihr?« Mit diesen Worten streckt er die Hand aus und weist auf einen Jungen von schätzungsweise acht oder neun Jahren.
»Nein, nehmen Sie lieber mich«, unterbricht eine weiche Stimme den Geiselnehmer.
Ich wende den Kopf zu Wolfgang. Seine Kiefermuskeln sind angespannt, die Dienstwaffe hält er fest in der rechten Hand. Auch er hat sofort erkannt, wer da spricht. »Verdammt, Gabriele, was machst du nur?«, murmelt er und flüstert daraufhin an mich gewandt: »Du rührst dich nicht von der Stelle! Und keinen Mucks!«
Nun gut, wenn der Chef das anordnet, dann werde ich brav ausharren und auf weitere Befehle warten, denke ich. Wolfgang ist der Profi, und dieser Kerl dort drinnen ist mir ganz und gar nicht geheuer. Ich verharre brav in geduckter Stellung hinter einem der großen Steine, die man auf dem Spielplatz als Sitzgelegenheit aufgestellt hat, während Wolfgang sich auf den Weg macht.
»Na so was. Eine Freiwillige. Aufstehen!« Im Innern geht das erschütternde Schauspiel weiter. Jemand richtet sich auf und jetzt bin ich mir ganz sicher, dass es Gabriele ist. Zögernd tritt sie mit erhobenen Händen auf den Mann in Schwarz zu. Bestimmt ist das alles nur ein Bluff, um das Geld zu erpressen, rede ich mir ein. In Wahrheit würde er Gabriele nie und nimmer verletzen.
Doch was danach geschieht, lässt mich umgehend an dieser Annahme zweifeln. Der Mann schiebt den Auslöser in seine Jackentasche, reißt Gabriele am Arm und dreht sie dabei mit dem Rücken zu sich. Das Küchenmesser hält er ihr gefährlich dicht an den Hals. Wenn sie sich nur einen Millimeter bewegt, hat sie einen tiefen Schnitt in der Kehle. So positioniert nimmt der Geiselnehmer den Fernzünder wieder in die linke Hand. Der Typ ist äußerst kaltblütig, weit erbarmungsloser als die Kriminellen, die man aus dem Fernsehen kennt. Mich fröstelt es, dabei ist heute ein warmer Spätsommertag.
»Einer von euch ruft jetzt die Bullen an«, brüllt der Typ und tritt mit dem Fuß gegen etwas am Boden. Ich erkenne es nicht genau, tippe aber auf ein Telefon.
»Anrufen, sofort!«
In diesem Moment taucht Gabrieles Kollegin Adelheid in meinem Blickfeld auf. Beherzt hebt sie das Gerät auf.
»Alles okay! Ich übernehme das«, erklärt sie und tippt eine kurze Nummer ein. Couragiert redet sie weiter: »Wir machen alles, was Sie sagen, Ehrenwort! Wir wollen keinen Ärger.«
»Ich mag Ärger.« Die Stimme des Geiselnehmers klingt bedrohlich ehrlich.
Wolfgang erreicht auf dem Boden robbend den Terrassenbereich des Bistros. Die große Glasfront macht es fast unmöglich, in Deckung zu bleiben und nicht gesehen zu werden. Bisher hat Wolfgang womöglich einfach nur Glück gehabt, dass der Mann in Schwarz viel zu abgelenkt ist, um ihn zu bemerken. Doch das kann sich jede Sekunde ändern.
Außerdem, frage ich mich, wie will er dem Kerl zuvorkommen? Das Messer sitzt derart dicht an Gabrieles Hals, selbst wenn Wolfgang überaus beherzt eingreifen würde: Es kann ihren Tod bedeuten.
Das alles ist wie ein schlechter Traum. Ein ungeheuer mieser, den man nicht einmal seinem schlimmsten Feind wünscht, wohlbemerkt. Wolfgang wird die Sache im Alleingang nie im Leben zu einem guten Abschluss bringen, das liegt auf der Hand. Nur ich kann das Schicksal noch wenden, sage ich mir und fasse einen kühnen Entschluss. Ich muss den Kerl auf andere Gedanken bringen, ihn irritieren und damit von der Gruppe fortlocken. Das ist die einzige Möglichkeit, um meinem Partner die Chance für einen Zugriff zu geben.
Ich schieße los. Während ich eben noch bemüht war, möglichst leise zu sein, belle ich jetzt aus voller Kehle. Der Geiselnehmer braucht ein paar Millisekunden, um zu verstehen, was vor sich geht. Wer rechnet schon in einer solchen Situation mit einem wild gewordenen Dackel? Ich fixiere mein Ziel: den Fernzünder, den der Bursche achtlos in der herabhängenden Hand hält. Als ich an Wolfgang vorbeispurte, blitzen seine Augen mich wütend an. Hoffentlich weiß er, was zu tun ist, denke ich noch, als ich geradewegs auf den Irren zustürme, zu einem beherzten Sprung ansetze und den Überraschungsmoment nutze, um ihm mit meiner Schnauze den Fernzünder aus der Hand zu reißen.
»Ei, du Mistvieh«, schreit der Psycho.
Tatsächlich scheint er sich schlecht auf mehrere Dinge gleichzeitig konzentrieren zu können. Glücklicherweise, denn um mich zu schnappen, lässt er schlagartig von Gabriele ab. Er stürmt mir hinterher. Alles ist gut, rede ich mir ein und laufe weiter. Mein Plan geht auf, denn der Kerl folgt mir in Richtung Kassenbereich. Dort, wo die ganzen Mitbringsel und Postkartenständer stehen. Da bin ich Winzling klar im Vorteil.
Doch der Kerl ist rabiat. Mit Wucht schleudert er die Ständer zu Boden und kommt geradewegs auf mich zu. Die Postkarten flattern durch den Raum. Jetzt ist der richtige Augenblick, um einzugreifen, mein lieber Freund Wolfgang, denke ich und schaue mich nach Hilfe um. Am besten ziemlich bald, überlege ich panisch, denn der fiese Typ hat mich bereits in die Enge getrieben. Mit dem langen Messer rückt er mir immer näher. Einzig seine Augen sehe ich jetzt noch, und die prophezeien nichts Gutes. Warum nur habe ich unbedingt den Helden spielen müssen und warum kommt mir denn niemand von der berühmten saarländischen Hundestaffel zur Hilfe? Ich schließe die Augen, als ich den Atem des Irren spüre, der in diesen Sekunden die Worte »Hunde-Schmorbraten« murmelt.
Es ist nicht Wolfgang, der beherzt eingreift und sein Leben für mich aufs Spiel setzt. Auch nicht die SEK. Es ist Gabriele. Sie hat sich eine der Kaffeekannen mit der Aufschrift »Das Leben ist zu schön für schlechte Laune« gegriffen. Es ist ein wenig schade um das gute Stück, das beim Aufprall in unzählige Scherben zersplittert. Aber es rettet mich fürs Erste. Das allein allerdings reicht nicht aus, um einen Psychopathen wie diesen Kerl auszuschalten. Er rappelt sich erneut auf, hält das Messer immer noch in seinen Händen. Nun kommt mir Adelheid, nicht weniger verwegen, zu Hilfe und greift nach einem der Keramik-Türschilder. »Herzlich willkommen im Chaos« – das passt fantastisch zum Thema und reicht aus, um den hundsgemeinen Typen endgültig k. o. zu schlagen. Er sinkt neben mir zu Boden. Das Messer weiterhin in seinen Händen. Jetzt erst, am Ende all dieser Aufregung, merke ich, dass ich den Fernzünder noch immer in der Schnauze halte.
»Verdammt«, sagt Wolfgang, der reichlich spät dazutritt, und reißt Gabriele an der Schulter von mir weg. »Günther hat die Bombe aktiviert.«
»Nein, ich glaube eher …« Gabriele holt tief Luft, bevor sie weiterredet: »Ich glaube, aktiviert wird sie erst, wenn Günther den Knopf wieder loslässt. Junge, beweg dich bloß nicht, keinen Millimeter. Sonst sehen wir alle alt aus.«
Dieser Satz setzt mich offen gesagt ein bisschen unter Druck. Ich wage es kaum, zu atmen. Meine Pupillen wandern hinunter zu dem schwarzen Kasten. Gabriele liegt richtig, ich habe mit meinen Zähnen den Knopf heruntergedrückt. Bislang unabsichtlich, doch nun gilt es, alles daran zu setzen, ihn weiterhin in dieser Position zu halten. An irgendeiner Stelle in diesem Gebäude liegt eine Bombe versteckt, und es braucht nur eine winzige Bewegung von mir, damit das Ding uns alle in die Luft jagt.
»Raus mit euch!«, brüllt Wolfgang und hebt die Hände zur Seite, während er rückwärtsgeht. Die verschüchterten Leute, die in den vorderen Teil des Bistros gedrängt sind, nachdem der Geiselnehmer außer Gefecht gesetzt wurde, weichen nun nochmals zurück. Manche machen direkt und automatisch das Richtige und flüchten zur Ausgangstür hinaus. Andere reagieren in ihrer Bestürzung erst, als Gabriele und Adelheid sie zum Gehen auffordern. Zurück bleiben die beiden Frauen, Wolfgang und ich sowie der Geiselnehmer, der allmählich aus seiner Ohnmacht erwacht.
»Ihr müsst ihn übernehmen«, sagt Wolfgang und reicht Gabriele die Dienstwaffe. »Schafft den Burschen raus. Und lasst ihn keine Sekunde aus den Augen!«
Gabriele nimmt mit fahrigen Fingern die Waffe entgegen und richtet sie sofort auf den Verbrecher. Sie zwingt sich, Ruhe zu bewahren, das ist ihr deutlich anzusehen. Mit dem Kopf weist sie zu dem Mann in Schwarz, der noch benommen wirkt. Adelheid versteht und greift dem verletzten Geiselnehmer unter die Arme.
»Aufstehen, du Dreckskerl! Sonst kannst du hier mit deiner eigenen Bombe in die Luft gehen«, herrscht Gabriele ihn an, und der Kriminelle richtet sich mit Adelheids Hilfe widerwillig auf. »Vorwärts!« Sie weist mit der Waffe in Richtung Ausgangstür. Die drei setzen sich in Bewegung.
»Passt auf euch auf«, flüstert Gabriele mit erstickter Stimme, als ihr Blick für einen kurzen Moment von den Vorausgehenden ablässt und zu Wolfgang und mir wandert. »Macht bloß keinen Quatsch, ihr zwei.«
»Keine Angst: Wir sind ein Superteam – Günther und ich. Wie Tim und Struppi oder Flipper und Sandy. Da gibt es immer ein Happy End.« Als der Kommissar das sagt, lächelt Gabriele für einen kurzen Moment, gleichwohl merke ich ihr an, dass ihr nicht nach Lachen zumute ist. »Bis gleich. Wir sehen uns in ein paar Minuten, versprochen?«
»Versprochen«, entgegnet Wolfgang.
Und dann sind die drei auf und davon.
Wolfgang wartet. Unendlich lange, wie mir scheint. Er will vermutlich sichergehen, dass die soeben aus dem Gartenbistro Entkommenen die Polizeisperre erreicht haben.
»So, jetzt zu uns, Junge«, flüstert er schließlich und streckt die Hände nach mir aus.
Sei bloß vorsichtig, denke ich. Jeder noch so kleine Muskel meines Körpers ist angespannt. Wir dürfen beide keine falsche Bewegung machen, das ist uns auch ohne Worte klar. Wolfgang nimmt mich in seine mächtigen Hände, hebt mich hoch, langsam und sehr vorsichtig, wie ein neugeborenes Baby. Ich zittere. Ruhig Blut, spreche ich mir selbst Mut zu. Einfach gelassen bleiben, der Mann vor mir ist ein Profi, er weiß genau, was er tut. Wolfgangs Nervenkostüm ist auf solche Umstände geeicht und Situation wie diese erlebt er tagtäglich.
»So was habe ich noch nie gemacht«, sagt Wolfgang in der nächsten Sekunde. »Aber keine Bange. Das kriegen wir hin, Günther. Wir werden hier heil rauskommen, wir beide, das verspreche ich dir. Und zu Hause gibt es ein Riesenstück Schmorbraten.«
Das hört sich ausgezeichnet an. Auf dieses Bild konzentriere ich mich: Wir drei, einträchtig in Gabrieles Wohnzimmer, und auf dem schönen Keramikteller mit den blauen Blumen ein großes Stück Braten. Der Gedanke trägt mich durch die heikle Situation. Wolfgang hält mich fest in seinen Händen, als wären sie aus Marmor gemeißelt. Zielstrebig und konzentriert steuert er auf die Ausgangstür zu und lehnt sich vorsichtig dagegen.
»Alter Schwede, die klemmt«, wettert er. Ohne freie Hand versucht er es mit dem Gewicht seines Körpers. Bloß keine Erschütterung, das denken wir wohl beide, aber es braucht andererseits auch ein wenig Druck, damit die schwergängige Eingangstür sich endlich bewegt.
»Achtung!« Die Stimme kommt von draußen. Jemand öffnet die Tür. Wolfgang macht überrascht einen Schritt zur Seite.
»Bist du von allen guten Geistern …?«, braust er auf, als er Gabriele sieht. Statt den anderen zu folgen, ist sie zurückgekehrt.
»Jetzt kommt schon.«
Wolfgang schüttelt den Kopf. »Bring du dich zuerst in Sicherheit.«
»Ich bleibe bei euch«, entgegnet Gabriele. Man hört, wie ernst ihr das ist.
Statt weiter zu diskutieren, nimmt Wolfgang bedächtig die Türschwelle. Auch wenn wir wohl alle am liebsten rennen würden, bleibt er ruhig und besonnen. In Wolfgangs festen Armen zu liegen, fühlt sich an wie schweben, ich mache das Einzige, was ich in dieser Situation tun kann: Den Kiefer so entschieden zusammenpressen, als hinge mein Leben davon ab – und letztlich ist das auch der Fall.
Nun geht es über den kleinen Kiesweg hinauf in Richtung Parkplatz, der mittlerweile eher einem Versammlungsplatz ähnelt. Wir sehen die Menge an Polizisten und Neugierigen, die sich hinter dem Absperrband versammelt haben. Alle Blicke richten sich auf uns. Manche halten ihre Handys in die Höhe, um die Szene für die Nachwelt festzuhalten.
»Gleich ist es geschafft!«, verspricht mir Wolfgang. Er riecht nach Schweiß. Es dauert gefühlte Stunden, bis wir endlich die Absperrung und damit die sichere Linie erreichen.
»Absetzen«, fordert einer der Männer in dunkler Montur, mit Helm, Schutzanzug und allem Drum und Dran. Mittlerweile ist also das SEK eingetroffen. Das ist gut, sage ich mir. Der Knabe, der anscheinend das Kommando über die Truppe hat, weist auf eine Stelle am Boden, wo eine Decke ausgebreitet ist.
»Genau hier. Und seien sie vorsichtig!«
Wolfgang setzt mich wie befohlen behutsam ab, in seinen Augen sehe ich Erleichterung. Bald ist alles in trockenen Tüchern, beruhige ich mich.
»Alle zurücktreten. Ich brauche Platz und völlige Ruhe«, fordert der Kommandierende daraufhin. »Los! Vorher werde ich den Zünder nicht aus diesem Tier entfernen.«
Diesem Tier? Was denkt der sich, empöre ich mich. Aber ich bleibe gefasst. Wir sind so weit gekommen, den unmöglichen Kerl werde ich schon noch ertragen, auch wenn mittlerweile die Kraft im Kiefer nachlässt und meine Lippen gefährlich zittern.
Es raunt in den Zuschauerreihen, als der Mann mit dem Oberkommando sein Visier herunterschiebt und nach dem Auslöser in meiner Schnauze greift. Er zählt laut von drei herunter: »Drei, zwei …«
Ich kneife die Augen zusammen. Der Gedanke, das könnte nicht nur ein Auslöser, sondern die Bombe selbst sein, drängt sich mir auf und macht das Stillhalten nicht leichter.
Der Mann vor mir ist endlich so weit.
»Eins!«, brüllt der Befehlshabende und ich spüre eine Millisekunde später, dass sich der viereckige Kasten aus meinem Mund schiebt. Der schwarze Knopf wird ab jetzt von der Hand des Kommandierenden gehalten und es scheint, als würde die Welt den Atem anhalten. Alles verharrt, während wie in Zeitlupe ein in einen hellbraunen Schutzanzug gehüllter Mann auf uns zukommt. Er trägt einen Helm mit riesigem Visier, fast könnte man meinen, es handle sich um einen Astronauten. Quälend langsam schiebt er eine Schraubklemme über den Fernzünder und dreht die Stellschraube fest. Hoffentlich weiß der Knabe, was er macht.
»Das müsste halten«, verkündet er schließlich.
»Hm«, stellt der Oberkommandant fest und begutachtet den Fernzünder von Nahem.
Einige seiner Kollegen, ebenso in voller Montur, in Schutzwesten und mit Sturmgewehren ausgerüstet, treten neben ihn und nehmen das Gerät ebenfalls in Augenschein.
»Komisches Teil. Nie gesehen«, sagt einer der SEKler und ein anderer: »Das muss was ganz Aktuelles sein. Vom Online-Schwarzmarkt, garantiert. Die Betreiber lassen sich ja ständig was Neues einfallen.«
»Ähm, ich will jetzt nichts Falsches behaupten, Herr Dannhäuser«, mischt sich ein dritter Beamter in das Gespräch ein. »Aber so einen Drücker habe ich auch. Der liegt in meinem Auto, um das Garagentor zu aktivieren.«
»Hä? Ein Garagenöffner? Nie im Leben!« Der Boss dreht das schwarze Rechteck in seinen Händen.
»Aber da steht es doch«, beharrt der Kollege auf seiner Vermutung und weist auf den silbernen Aufkleber auf der Rückseite des Kastens. »›Bummler – Technik, die Türen öffnet‹«, liest er laut vor.
Dannhäuser verzieht den Mund. Dem Augenschein nach weiß er selbst nicht so recht, was er von all dem halten soll: »Ob man damit eine Bombe …?«
Die Kollegen zucken die Schultern.
»Gehen wir auf Nummer sicher und stürmen das Gebäude. Wir müssen mit allem rechnen«, entscheidet der Chef. Das ganze Team sammelt sich hinter ihm. Eine Horde von etwa zwölf schwerbewaffneten Vermummten rückt vor auf dem Weg, den Wolfgang, Gabriele und ich gerade bewältigt haben. Wir anderen verharren gefesselt auf der sicheren Seite des Absperrbandes. Der Polizist vom Beginn nimmt das Funkgerät wieder zur Hand, so bekommen wir hautnah mit, was drinnen geschieht.
»Vorraum gesichert«, knistert es aus dem schwarzen Kasten. »Drei Mann nehmen sich die Küche vor. Zwei folgen mir in die Damentoilette, der Rest geht zu den Herren.«
Wieder ist es die Stimme von dem Chef in Schwarz, diesem Dannhäuser, der mir den Garagenöffner aus dem Mund genommen hat.
»Die Küche ist gesichert!«, ruft im Hintergrund jemand.
»Herrentoilette ebenfalls negativ!«, meldet der zweite Trupp zurück.
Draußen atmet man bereits auf. Das alles spricht dafür, dass es gar keine Bombe gibt. Ein Täuschungsmanöver mit einem Garagenöffner – hier im Saarland ist das womöglich das Kriminellste, was man erwarten kann.
Aber dann hört man Türen knallen und einen Aufschrei. »Gottverflucht. Leute, hier ist was! Auf dem Klo.«
»Alle sofort zurück. Da steht ein Schuhkarton auf der Toilettenschüssel. Niemand öffnet das Ding!«, erklingt eine andere Stimme. So, wie es sich anhört, wieder die vom Häuptling.
Ein paar Sekunden lang ist nur schweres Atmen zu vernehmen und urplötzlich ein bestürztes: »Mannomann, was ist das denn?« Nach einer kurzen Pause dann die Frage: »Fiedler, ist Hans-Peter vom Entschärfungskommando schon vor Ort?« Noch mal ist es Dannhäuser, der Chef der SEKler.
»Ja, und der Dieter, der ist auch hier.« Nun wird der Polizist neben uns aktiv und winkt einen ebenfalls dunkel gekleideten Kollegen, der sich mit einer Fernsteuerung um den Hals gegen einen dunklen Van lehnt, zu sich. Der Mann nickt und kommt näher, vor sich her schiebt er einen Monitor auf einem Wagen. Hinter ihm taucht plötzlich eine Antenne auf und im weiteren Verlauf ein silberfarbenes Objekt mit einer Reihe von Rohren und Kabeln, angetrieben durch ein Kettenfahrwerk. Aha, sage ich mir, das ist vermutlich der besagte Dieter.
»Na so was, da kommt unser silberner Freund endlich zu seinem ersten Einsatz«, dröhnt der etwas fülligere, gemütliche wirkende Beamte und bleibt neben uns stehen. Das überdimensionierte Schaltbrett vor seiner Brust sieht aus, als könnte man damit die Welt beherrschen. Wohin man auch schaut, Knöpfe, Schalter, Drehregler und blinkende Lichter.
»Unser Dieter hat sechs Kameras«, informiert Hans-Peter den Polizeikollegen, den Dannhäuser eben Fiedler genannt hat. »Das Blech-Kerlchen sieht weit mehr als wir alle zusammen.«
»Hoffen wir mal, du hast recht«, gibt Fiedler nicht mit dem gleichen Enthusiasmus zurück. Er hebt das Absperrband in die Höhe und lässt den Roboter durch. »Hoffentlich passt dein Dieter überhaupt durch die Toilettentür«, meint der Beamte zweifelnd und blickt zu Wolfgang, der ebenfalls die Stirn runzelt.
Tatsächlich ist das ganze Spektakel, jetzt, da wir aus der Gefahrenzone sind, beinahe wie ein guter Krimi im Fernsehen. Nur ein bisschen echter eben. Gabriele hat mich, nachdem ich demonstrativ an ihrem Hosenbein gezogen habe, auf den Arm genommen. Nun sehe ich weit besser, und gespannt warten wir darauf, was als Nächstes geschieht.
Abermals knarrt es aus dem Funkgerät: »Dieter kommt rein!«
»Dieter betritt die Toilettenräume«, informiert uns ein paar Augenblicke später eine dunkle Frauenstimme. Und kurz darauf hören wir deutlich den Oberkommandanten: »Sobald Dieter in Position gebracht ist, treten wir den Rückzug an. Lassen wir den Roboter den Job erledigen.«
Es dauert keine drei Minuten, bis die gesamte dunkle Truppe hinter der Absperrung steht.
Dieter macht die Arbeit ab da allein, und der »Steuermann« ist sichtlich stolz auf seinen unerschrockenen Helfer. Von allen Seiten sieht man ihm über die Schulter, um einen Blick auf den Monitor zu erhaschen. Selbst die Geräusche auf der Toilette werden von Dieter live nach draußen übertragen.
Es schnurrt, als er den Greifarm ausfährt, um den Karton zu öffnen. Hans-Peter spielt mit seiner Zunge an den Lippen. Ganz einfach scheint die Angelegenheit nicht zu sein. Mit dem Metallarm, an dessen Ende sich drei schwarze Finger befinden, hebt Dieter den Deckel der Kiste an. Doch der rutscht dem Roboter immer wieder aus den Greifern.
»Gleich haben wir dich«, murmelt Hans-Peter und schiebt einige Knöpfe auf seiner Fernsteuerung hin und her. Er soll recht behalten. Nach ein paar Fehlversuchen hat Dieter den Dreh raus. Der Deckel kippt nach hinten über.
»Manipulatorkamera eins.« Hans-Peter gibt sich selbst die Kommandos. Das Bild auf dem Monitor wechselt zur Kamera am Greifarm.
»Ui«, haucht Wolfgang neben mir. Wir alle sehen die langen braunen Röhren, die vielen Kabel sowie die LED-Anzeige – das spricht eine deutliche Sprache: Sprengstoff.
»Okay, okay, wir haben alles im Griff, Dieter.« Hans-Peter, der eben noch die Ruhe selbst war, wirkt nervös. Er drückt erneut auf dem Schaltbrett herum. »Alles ist gut. Bevor wir etwas unternehmen, zoomen wir erst mal ran!« Das Bild wird Stück für Stück größer.
»Jesses«, sagt eine ältere Frau hinter mir und legt ihre Hand vor den Mund.
Ich muss ihr zustimmen. Was sich uns in diesem Augenblick offenbart, sieht beängstigend aus. Bei dem Gedanken daran, dass die Apparatur höchstens 40 bis 50 Meter Luftlinie von uns entfernt steht, wird mir flau.
»Na, dann machen wir uns nun ans Entschärfen. Gar kein Problem.« Der Roboter-Steuermann ist voll in seinem Element, wer weiß, wie lange er schon arbeitslos gewesen ist. Neben uns filmen ein paar Schaulustige den Bildschirm ab.
»Ähm«, sagt da jemand. Es ist der Mann, der eben schon anmerkte, den gleichen Garagenöffner wie der Attentäter zu nutzen. »Wie soll ich euch das sagen …? Ich will nichts Falsches behaupten, aber es könnte durchaus sein, dass wir zu Hause …«
»Paul, willst du mir jetzt erzählen, dass ihr daheim so eine Bombe herumstehen habt?« Dannhäuser klingt grantig. Allem Anschein nach würde er die heikle Aktion gerne möglichst schnell hinter sich bringen.
»Nun, um ehrlich zu sein: ja. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das der Bombenwecker aus dem Internet, den ich meinem Sohn letztes Jahr zum Schulanfang gekauft habe.«
»Das ist nicht dein Ernst, du steckst deinem Sohn eine Bombe in die Schultüte? Wie irre ist das denn?«, mischt sich ein anderer Kollege ein.
Der Boss stöhnt und wendet sich an Hans-Peter. »Kann der Dieter noch etwas dichter ran?« Offenkundig glaubt Dannhäuser nicht an die Version mit dem Wecker, aber er will trotzdem sichergehen.
»Klaro. Dieter kann fast alles. Ich glaube, unten in der Ecke steht was«, sagt Hans-Peter.
Wieder baut sich das Bild auf dem Monitor neu auf. Man sieht die Details immer deutlicher.
»Ja, da genau! Da ist eine Schrift zu sehen«, sagt der Boss und weist mit dem Finger auf eine Stelle am Bildschirm. »Noch mal draufzoomen.«
Die Auflösung der Kamera ist wirklich der Wahnsinn. Dies ist eine Lehrstunde von dem, was technisch mittlerweile alles möglich ist. Allerdings lernen wir auch, wie einfach es ist, eine ganze Stadt in Panik zu versetzen.
»Ein Wecker zum Entschärfen«, steht dort geschrieben und etwas kleiner darunter: »für Menschen mit Bombenschlaf«.
»Schöner Mist«, murmelt Hans-Peter. Man sieht ihm seine Enttäuschung an. Die Handys hinter ihm rücken jedoch zur gleichen Zeit noch etwas näher an den Monitor heran. Den Moment will sich keiner entgehen lassen. Die Filmchen werden später eine Menge Klicks erzielen – das ist garantiert.
»Noch ein Häppchen?«, fragt mich Gabriele und hält mir die Gabel direkt vor die Schnauze.
Ich öffne sie nicht. Ich bin pappsatt. Drei Stück Schmorbraten, das ist selbst in meinem Fall das Limit.
Wolfgang rollt genervt mit den Augen. Er hält »Mitten hinein in den Sturm der echten Liebe« in seinen Händen und unverkennbar ist die romantische Ader des Kommissars in den letzten Jahren ein wenig verkümmert.
»Ach komm, sind doch nur noch vier, fünf Seiten«, bettelt Gabriele und ich fiepe, um etwas Nachdruck zu erzeugen.
»Aber nur, weil ihr zwei es seid«, erwidert Wolfgang, der uns beiden sowieso nichts abschlagen kann, und wenn mich nicht alles täuscht, lächelt er dabei. Nur kurz und nur ganz leicht.
»Also gut, wo waren wir?«
Gabriele nimmt das Buch vom Tisch und klappt die Seite beim Lesezeichen auf. »Da!«
Dann beginnt Wolfgang zu lesen: »Didier sah seine Rose an. Hinter ihr fielen die Felsen steil hinab, die Sonne glitzerte auf den Wellen und das Meer war blauer als blau. Es rauschte und die Möwen krächzten. ›Rose‹, flüsterte Didier. Sie war wunderhübsch. Er nahm ihre Hand in die seine. ›Rose, würdest du mich bitte …?‹« Abrupt bricht Wolfgang ab, gerade an der Stelle, wo es so besonders spannend wird. »Och ne Leute, echt, das könnt ihr mir nicht antun. Wie wäre es denn damit?« Er greift sich dreist die Fernsteuerung. »Wir schauen mal, ob gleich ein Tatort kommt.«