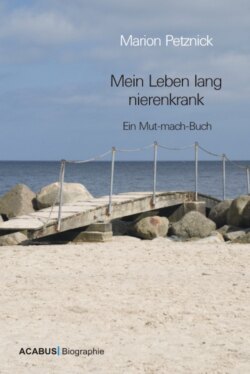Читать книгу Mein Leben lang nierenkrank - Marion Petznick - Страница 11
Ausbildung, Beruf ohne Einschränkungen
ОглавлениеDie Voraussage eines Rostocker Arztes, dass sich nach der Pubertät mein Gesundheitszustand stabilisieren könnte, traf tatsächlich ein. Jetzt wollte ich meine Pläne für eine Ausbildung umsetzen. Ich entschied mich für das Studium zur Lehrerin. Allerdings ergab eine der dafür notwendigen Untersuchungen, dass meine Stimmbänder zu schwach waren. „Das ist für Sie ein ungeeigneter Beruf“, meinte der Logopäde. Ich wollte diese Tätigkeit aber unbedingt ausüben und brachte den Arzt dazu, mich in einem Jahr noch einmal zu untersuchen. In der Zwischenzeit suchte ich mir ein Praktikum in einem Kindergarten und mein Interesse, als Pädagogin zu arbeiten, bestätigte sich. Gleichzeitig bewarb ich mich im Pädagogischen Institut in Schwerin um einen Studienplatz zur Kindergärtnerin. Nach einem Jahr hatten sich auch die Stimmbänder wieder stabilisiert und einer Arbeit mit Kindern stand nichts mehr im Wege.
1972 wurde ich am Pädagogischen Institut in Schwerin immatrikuliert. Wir studierten mit etwa zweihundert jungen Mädchen im Schweriner Schloss, welches sich als ein ganz besonderer Ausbildungsort erwies. Ein wirkliches Märchenschloss geschmückt mit vielen Giebeln und Türmchen. Es liegt auf einer Insel, die nur durch eine Brücke erreicht werden kann. Hier gab es viele Plätze und ausreichend Gelegenheit, sich zum Lernen zurückzuziehen oder einfach zu entspannen.
In diesen prachtvollen Gemäuern erhielten wir unseren Musikunterricht im historischen Thronsaal. Im untersten Geschoss lag der Rittersaal, der war unser Sportraum. Von hier aus konnten wir direkt ins Freie gelangen, um uns im Schlosspark zu bewegen.
Während der Ausbildungszeit dachte ich überhaupt nicht mehr daran, dass ich nierenkrank bin. Nur meine inzwischen nur noch halbjährlichen Untersuchungen in Rostock holten mich in die Realität zurück. Eine Routineuntersuchung im Institut, für jede Studentin Pflicht, zeigte das erste Mal wieder gestiegene Kreatininwerte7 im Blut an.
Der Arzt für Allgemeinmedizin war irritiert, weil Werte in diesem Bereich bei ihm eher selten vorkamen. Er überwies mich sofort zum Spezialisten, der in Rostock eine Nierenpunktion anordnete.
Wir schrieben inzwischen das Jahr 1974, und durch eine Nierenpunktion erfuhr ich endlich, welche Grunderkrankung bei mir vorlag: eine Glomerulonephritis8
Bis dahin gab es unterschiedliche Auffassungen über die genaue Form meiner Erkrankung. Mit Hilfe der Nierenpunktion konnten Gewebeteilchen der Niere untersucht werden und damit die genaue Form meiner Nierenerkrankung festgestellt werden. Im Alltag brachte diese Erkenntnis erst einmal keine Veränderungen für mich mit sich. Es wurde mir lediglich empfohlen, regelmäßig einen Nephrologen aufzusuchen, um den Verlauf weiter zu beobachten. Ich brauchte weder Tabletten einzunehmen noch irgendeine spezielle Diät einzuhalten.
Wichtig war, dafür Sorge zu tragen, dass ich keine Erkältungen bekam. In dieser Zeit begann ich bewusst mein Immunsystem zu stärken. Dazu gehörten regelmäßige Saunabesuche und aktiver Sport, um mich abzuhärten und Kräfte zu sammeln. Ich ging einmal in der Woche mit meinen Kolleginnen zur Gymnastik und spielte in einem Klub Tennis.
Meine Ausbildungszeit war inzwischen vorbei und ich zur qualifizierten Kindergärtnerin ausgebildet. Wegen eines Freundes tauschte ich die kleine Stadt Malchin gegen die Hauptstadt der damaligen DDR, Berlin, ein. Schon 1975 eine pulsierende und atemberaubende Stadt, deren nicht zu übersehender Makel darin bestand, durch eine Mauer getrennt zu sein. Besonders im Prenzlauer Berg, ein Stadtteil, in dem ich nach dem Studium eine kleine Hinterhofwohnung bezog, war die Mauer von vielen Stellen aus sichtbar.
Von Anfang an hatte ich in meiner neuen Arbeitsstelle im Kindergarten die Verantwortung für eine kleine Gruppe Dreijähriger übernommen. Vier Jahre begleitete ich sie bis zur Schule. Wir hatten so genannte „Bildungs- und Erziehungspläne“, nach denen wir den Tagesablauf der Kleinen gestalten sollten. Jede Erzieherin war auf sich gestellt und für mehr als zwanzig Kinder verantwortlich. Eine nicht zu unterschätzende Verantwortung und bei der großen Anzahl oft eine Meisterleistung. Es war eine Zeit, in der ich selbst noch nicht über eigenen Nachwuchs nachdachte. Vielmehr waren Ideen, mich weiterzubilden, sehr stark.
Eine wichtige Grundlage war bereits vorhanden, meine Erfahrungen in der Praxis mit Kindern. So dachte ich immer stärker daran, Kinderpsychologie zu studieren. Studienplätze in der DDR waren sehr knapp, die Fachleute an der Uni machten mir wenig Hoffnung und meinten stattdessen, dass ich in neun Jahren wiederkommen könnte. Das war für mich nicht akzeptabel, und ich schaute mich nach anderen Möglichkeiten um. In der Zeit dazwischen ging ich abends in die Volkshochschule und belegte Kurse in Englisch und Schreibmaschine, zufrieden stellte mich das aber nicht.
Ende der siebziger Jahre gab es in Ostberlin sehr viele Kinder, und alle Eltern hatten in der DDR das Recht auf einen Kindergartenplatz. Das Resultat waren übervolle Kindergärten. Ich selbst war nun häufig allein für mehr als dreißig Kinder verantwortlich. Dabei spürte ich eine deutliche Überforderung, und ich konnte meine Vorstellungen von diesem Beruf nicht mehr umsetzen. Ich litt nun häufiger unter starken Kopfschmerzen. Es dauerte lange, ehe ich feststellte, dass die Ursache ein zu hoher Blutdruck war, welcher häufig die erste wahrnehmbare Begleiterscheinung einer chronischen Nierenerkrankung ist.
Mein nächster Arztbesuch brachte den hohen Blutdruck an den Tag: 200/160. Viel zu hoch, und meine Ärztin, die mich jetzt in der Berliner Charité betreute, gab ein erstes Alarmsignal. Ab jetzt sollte ich dringend kürzer treten, die Einstellung des Blutdruckes war absolut dringend und wurde direkt im Krankenhaus vorgenommen. Mit den verordneten Medikamenten gelang es relativ schnell, ihn in den Normbereich zu bringen.
Von einem Tag auf den anderen musste ich regelmäßig Tabletten schlucken, und Gedanken an meine Nierenerkrankung wurden wieder präsenter. Dieses erste Alarmsignal zeigte deutlich, dass ich mich vor Überforderungen schützen musste.
Gedanken an einen Berufswechsel wurden immer klarer, und ich wollte eine Lösung finden.
In der DDR war es sehr schwer, die „Volksbildung“ zu verlassen. Das war die Gewerkschaftsorganisation, der alle Pädagogen, wie zum Beispiel Erzieher, Lehrer und Kindergärtnerinnen angehörten. „Die Pädagogen sollten dort arbeiten, wo der Staat sie braucht, weil sie kostenfrei studieren durften“, so lautete damals die Parole. Ich brauchte jetzt viele Atteste, Bescheinigungen, die mir bestätigten, dass ich den Beruf der Kindergärtnerin nicht mehr ausüben konnte. Meine Nierenärztin in der Charité, Frau Dr. Mohnike, unterstützte und bestärkte meinen Wunsch. Parallel dazu musste ich mich nach einer anderen Arbeit umsehen, die mich nicht so stark belastete, aber auch meinen Interessen entgegen kam.
Ich hatte Glück und fand in einem großen Betrieb für Damenbekleidung eine freie Stelle als Kulturleiterin. Meine Aufgabe bestand darin, Veranstaltungen, Betriebsfeste, Ausstellungen und Kurse für die Mitarbeiter des Betriebes zu organisieren, aber auch Kontakte zu den Theatern in Berlin herzustellen. Das war eine Arbeit, in der ich mein Organisationstalent unter Beweis stellen konnte und die zugleich sehr abwechslungsreich war. Gleich im zweiten Jahr erhielt ich die Chance für ein Fernstudium der „Kulturwissenschaften“.
Vier Jahre Studium neben der Arbeit waren nicht immer einfach. Aber ich hatte wieder eine neue Herausforderung gefunden, die mich ausfüllte und meinen Interessen entsprach. Während dieser ganzen Zeit fühlte ich mich gesund und wurde lediglich durch die Einnahme einiger weniger Tabletten daran erinnert, dass ich nierenkrank bin.
Nach dem Studium hatte sich auch mein persönliches Leben verändert. Ich heiratete meinen langjährigen Freund. Um unser Glück zu vervollkommnen wurde der Wunsch nach einem Kind immer größer. Das intensive Gespräch mit meiner mich behandelnden Ärztin war erschütternd. Sie riet mir eindringlich von einer Schwangerschaft ab und meinte, dass ich mein Leben und das Leben des Kindes aufs Spiel setzen würde. Ich war jetzt 29 Jahre alt, und meine Welt brach das erste Mal wirklich zusammen. Warum sollte ich, die Kinder so sehr liebt, keine eigenen Kinder haben dürfen?
Trauer und Wut wechselten sich gleichermaßen ab. Jetzt kam mir zum ersten Mal der Gedanke, dass meine Krankheit mich gefangen hält. Mein Verantwortungsgefühl und das Vertrauen zu meiner Ärztin waren zu groß, als dass ich ein Risiko eingehen konnte.
Mein Mann und ich mussten lernen, mit dem Gedanken dieser Entbehrung zu leben. Nur gut, dass er sich sehr gut in meine Situation einfinden konnte. Damals dachten wir noch daran, ein Kind zu adoptieren. Wir besprachen dieses Thema sehr intensiv, vor allem um unsere Trauer besser verarbeiten zu können. Dieser Prozess dauerte sehr lange, und ehrlich gesagt, ist bis heute noch Wehmut vorhanden. Es ist wohl die schmerzhafteste Erfahrung meines Lebens. Gespräche mit den Eltern und Freunden halfen, diese enttäuschende Situation besser zu bewältigen. Weitere Gespräche mit meiner Ärztin über die fortgeschrittene Niereninsuffizienz9 zeigten deutlich, dass in mir eine Zeitbombe tickte. In diesem Zusammenhang erläuterte sie mir, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis ich an die Dialyse müsste.
Mit ihrer Hilfe setzten wir jetzt alles daran, den Prozess so weit wie möglich hinauszuzögern. Zunächst stellten wir meine Ernährung um. Dabei sollte weniger Eiweiß hilfreich sein, das hieß zunächst weniger tierisches Eiweiß. Für einen gesunden Menschen ist etwa die Menge von achtzig Milligramm Eiweiß pro Tag normal, ich durfte zunächst lediglich vierzig und nach zwei Jahren sogar nur noch zwanzig Milligramm zu mir nehmen. Zusätzlich zur Nahrung nahm ich Aminosäuren in Tablettenform ein (15 Stück am Tag), weil der Körper das Eiweiß für den Stoffwechsel benötigte, und damit ich nicht abnahm. Diese „Ersatztabletten“ hatten den Vorteil, dass sie über den Darm ausgeschieden wurden und so die Nieren entlasteten. Meine Ärztin verhalf mir zu einer Diätberatung, um durch diesen intensiveren Einfluss auf mein Essverhalten die Therapie weiter günstig zu beeinflussen.
Um die Dialyse hinauszuzögern muss nicht nur die Grunderkrankung, sondern müssen auch die verschiedenen Schädigungsfaktoren beeinflusst werden. Dazu gehören nicht nur die optimale Einstellung der arteriellen Hypertonie10, sondern auch diätetische Maßnahmen.
Bereits 1918 wies Dr. Franz Volhard in seinem Handbuch der inneren Medizin darauf hin: „Durch Eiweißreduktion bei ausreichender Energiezufuhr sowie salzarme Diät, kann die Progression einer chronischen Niereninsuffizienz reduziert werden.“11
Meine Hoffnung, dass der Verlauf der schleichenden Niereninsuffizienz stabil bliebe, ging allerdings nie verloren. Die Eiweißreduktion war inzwischen maximal ausgereizt.
Ich erinnere mich, dass ich in dieser Zeit oft nicht wusste, was ich noch essen durfte. Die Staffelung der Menge an Eiweiß ging so rasch nach unten, dass ich inzwischen aufpassen musste, mich ausreichend zu ernähren. In dieser Phase war jegliches Eiweiß verboten. Fast in allen Lebensmitteln ist aber Eiweiß enthalten, vor allem in Lebensmitteln, die mir auch schmeckten. Was sollte ich tun? Ich konnte mich ja nicht nur von Obst ernähren. Sämtliche Milchprodukte, Brot, Fleisch, Schokolade waren verboten. Abnehmen durfte ich jetzt auch nicht, denn sonst wäre Eiweiß (Muskelgewebe) über die Nieren ausgeschieden worden. Ein spezielles eiweißloses Brot wurde mir empfohlen, welches ich aber selbst backen musste, da es in keinem Laden erhältlich war.
Das Vorstadium zur Dialyse bedeutet für alle Betroffenen eine echte Gratwanderung, besonders in der Ernährung. Meine Ärztin war sehr weitsichtig in ihrem Vorgehen, um das Fortschreiten meiner Krankheit zu verlangsamen. Sie war ehrlich an meinem Leben interessiert. Eine so intensive Anteilnahme des Arztes an seinen Patienten ist heute aus Zeitgründen oft gar nicht mehr möglich. Obwohl es gerade diese zwischenmenschlichen Beziehungen sind, die für den Prozess der Genesung des Patienten von großer Bedeutung sind.
Meine Ärztin bestellte mich eines Tages in das Zentrum der akuten Hämodialyse12, dort war sie neben der Sprechstunde beschäftigt.
Ihr Ziel war es, mich frühzeitig mit der Dialysemaschine zu konfrontieren, um so eine gewisse Vertrautheit aufzubauen. Ich sollte im günstigsten Fall die Angst vor der Maschine verlieren. Das gelang nicht. Das Gegenteil war der Fall, Gedanken an die Dialyse beunruhigten mich eher und ich verdrängte sie immer weiter.
In diesem Stadium der Erkrankung wollte ich einfach nicht wahrhaben, dass ich von einer Maschine abhängig sein würde. Manchmal kam es vor, dass die Werte sich plötzlich verschlechterten, dann schickte meine Ärztin mir ein Telegramm (Telefone gab es in der DDR nur begrenzt), um mich zur Kontrolle zu bitten. Ich war ihr unendlich dankbar für ihre Umsicht, und sie besaß mein absolutes Vertrauen. Schon damals war mir klar, dass jeder Betroffene mit einer chronischen Erkrankung im Vorteil ist, wenn die Chemie zwischen ihm und seinem behandelnden Arzt stimmt. Nur so ist es möglich, dass der Genesungsprozess vorangebracht wird.
Mit 19 Jahren lernte ich meine Ärztin kennen. Sie begleitete mich bis zum Beginn meiner Dialyse, die mit 33 Jahren bei mir nötig wurde. In so einer langen Zeit lernt man sich auch persönlich kennen. So vertraute ich meiner Ärztin an, dass ich große Angst davor hatte, durch die Dialyse meine Freiheit zu verlieren, und dass diese monströse Maschine auf mich keinen vertrauenswürdigen Eindruck machte. Meinem Mann und meinen Freunden erzählte ich nichts von meinen Befürchtungen. Das trug ich ganz allein mit mir aus. Ich wollte niemanden mit meinen Sorgen belasten. Überhaupt wollte ich mich durch nichts von anderen Frauen in meinem Alter unterscheiden, schon gar nicht dadurch, dass ich krank war. Aus diesem Grund wurde meine Erkrankung im Bekanntenkreis nie thematisiert. Nur mir sehr vertraute Menschen, wie mein Mann und meine beste Freundin, nahmen wahr, dass es mir jetzt häufiger schlecht ging. Meine Eltern lebten weit entfernt, und sie wollte ich schon gar nicht in Sorge bringen. Die Zeit war reif, es musste ein Shunt13 gelegt werden.
Bei mir wurde der Shunt schon drei Jahre vor Beginn der Dialyse ambulant operativ gelegt. Meine Ärztin wusste aus Erfahrung, dass die Werte sich in einem bestimmten Stadium sehr schnell verschlechtern können. Dann muss ein Anschluss für die Dialyse vorhanden sein, sonst wird eine Notoperation am Hals nötig, bei der ein Übergangskatheter gelegt werden muss.
Immer noch hatte ich die Hoffnung, dass die Werte stabil bleiben und ich keine Dialyse brauchen würde. Das Vorstadium zur Dialyse bedeutete: verzichten, hoffen und bangen – alles war möglich. Jetzt brauchte ich wieder Unterstützung, Hilfe, um nicht in ein großes Loch zu fallen. Zwar gehöre ich nicht zu den Menschen, die resignieren und aufgeben, zu viel hatte ich bis dahin erlebt. Aber zu wissen, dass in der Nähe Menschen sind, die mir helfen, wenn es nötig wird, war für mich außerordentlich wichtig. Nie habe ich mit meiner Situation gehadert und gefragt: „Warum gerade ich?“ Ich habe mich mit meiner Situation arrangiert und stets auf meinen Körper gehört, der natürlich in so einer Zeit viele Signale sendete. So war ich zum Beispiel oft müde und unkonzentriert, fühlte mich abgeschlagen und hatte keinen Appetit mehr.
Wenn die Krankheit über dreißig Jahre dein ständiger Begleiter ist, gehört sie zum Leben dazu und wird akzeptiert. Es war oft so, dass ich die schleichende Verschlechterung gar nicht spürte. Ich hatte mich unbewusst angepasst und getan, was mein Körper forderte: War ich müde, legte ich Pausen ein. In dieser Zeit hatte ich mich daran gewöhnt, genug Ruhepausen einzuplanen, und so kam ich erst gar nicht in einen totalen Erschöpfungszustand.
Inzwischen hatte ich auch mein Fernstudium beendet. Mit dem Abschluss konnte ich an die Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ wechseln. Dort leitete ich den Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Meine Kollegen wussten zwar von meiner Erkrankung, brauchten aber in keiner Weise auf mich Rücksicht nehmen. Im Gegenteil, die Arbeit gefiel mir sehr, entsprach meinen Fähigkeiten und lenkte mich von meiner Erkrankung ab. Außerdem machte sie mir großen Spaß. Ich arbeitete mit den jungen Musikstudenten zusammen und kümmerte mich unter anderem um deren Auftrittsmöglichkeiten. Werbung und die Außendarstellung gehörten ebenfalls zu meinen Aufgaben.
1988, nachdem ich den Shunt gelegt bekam, machte mich meine Ärztin darauf aufmerksam, dass es mit der Dialyse einen Leistungsknick geben könnte und ich sollte mich besser an den Gedanken gewöhnen, die leitende Position in der Hochschule abzugeben. Außerdem würde ich an drei Tagen in der Woche durch die Dialyse fehlen, und die Verantwortung würde mich belasten. Mit anderen Worten: es wäre günstig, meine Vollzeitstelle aufzugeben und „Invalidenrente“ (so wurde die Erwerbsunfähigkeitsrente in der DDR genannt) zu beantragen. Da ich meiner Ärztin vertraute und sie besser als ich wusste, was auf mich zukam, stellte ich den Rentenantrag, der schon nach wenigen Monaten genehmigt wurde.
Von nun an machte ich zwar noch dieselbe Arbeit, aber in weniger Stunden. Drei Mal in der Woche arbeitete ich jetzt jeweils fünf Stunden. So blieb genug Zeit, in aller Ruhe meinen Tagesablauf zu planen, und diese Umstellung bekam mir auch körperlich deutlich besser. Äußerlich sah man mir immer noch keine Krankheit an, und ich sprach auch nicht darüber. Nur meine beste Freundin Petra und mein Mann wussten inzwischen, wie es tatsächlich um mich bestellt war. Zu lange hatte ich meine Erkrankung als selbstverständlich angesehen und wollte keine Rücksichtnahme. Verdrängen ist aber keine Lösung. Hätte ich das damals gewusst, wären mir einige unangenehme Folgen erspart geblieben.
Ich litt in dieser Zeit unter Magengeschwüren und bekam sie nicht in den Griff. Wieder war es meine Ärztin, die ahnte, dass die nahende Dialyse mich zermürbte. Sie riet mir zu einem Gespräch mit einer Psychologin, um Verhaltensstrategien zu entwickeln. Diese erkannte sehr schnell, dass ich nach außen hin immer stark sein wollte, keine Schwäche zulassen konnte, und das war genau mein Problem. In langen Gesprächen erarbeitete ich für mich wesentliche Erkenntnisse:
Ich kann meine Schwächen zeigen.
Ich kann offen sagen, dass es mir nicht gut geht.
Ich muss nicht immer stark sein.
Nur wer ähnliche Erfahrungen durchlebt hat, weiß, dass es besser ist, offen über seine Gefühle zu sprechen und sich mit seinen Ängsten und Sorgen jemandem anzuvertrauen. Ein kranker Mensch muss nicht immer stark sein und sich schon gar nicht mit Gesunden messen. Aber das war für mich ein Lernprozess, der sich erst ganz allmählich festigte, heute für mich aber ganz normal geworden ist.
In dieser Phase meiner Erkrankung war ich meinem Mann überaus dankbar für seine Geduld, sein Verständnis und seine Rücksicht. Eine harmonische Partnerschaft und eine verständnisvolle Familie sind wichtige Voraussetzungen, trotz einer chronischen Erkrankung gut leben zu können und die vielen Hürden ohne Rückschläge zu nehmen.
„Wer Krankheit und Angst nicht kennt, spricht über das Leben wie einer, der über die Welt spricht und nie gereist ist.“, sagt Margot Käßmann in ihrem Buch „In der Mitte des Lebens“. Mir wird bewusst, dass ich noch einige Hürden in meinem Leben zu meistern habe.