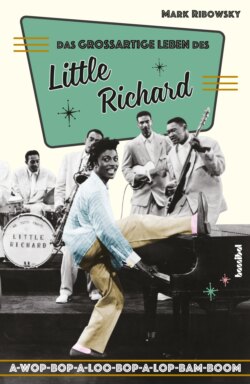Читать книгу Das großartige Leben des Little Richard - Mark Ribowsky - Страница 8
Оглавление„Ich versuchte es mit Gesangsunterricht, doch das klappte nicht, weil die Lehrer nicht damit klarkommen, wie ich singe. Richtige Sänger – Leute, die was von Musik verstehen, die nicht Rock ’n’ Roll ist – haben mir gesagt, das sei was Besonderes. Ich danke Gott dafür. Sobald ich ein Lied höre, würde ich es am liebsten singen! Bei Musik muss ich einfach von den Haarspitzen bis zu den Zehen loswackeln!“
– Little Richard
Anfang des neuen Jahrzehnts hatte der frischgebackene Little Richard noch einen weiten Weg zum Starruhm vor sich. Auf ihn warteten einige komplizierte Zwischenstationen, an denen er kurz davor stand, die Brocken hinzuschmeißen, zurück zur Fifth Avenue 1540 zu gehen und auf ein geistliches Amt hin zu studieren. Das kärgliche Honorar, das er für Gigs mit durch die Stadt ziehenden Bands erhielt, genügte nur, wenn irgendwelche Gönner für seine Rechnungen aufkamen, wofür einige Gegenleistungen verlangten. Sowie er auf die 20 zuging, büßte er etwas von seinem Reiz ein, also musste er niedere Tätigkeiten ausüben, um sich über Wasser zu halten. Dennoch schaffte er es, weiter in der Musikwelt voranzukommen, wenn auch nur schrittweise statt sprunghaft. Nach seinem Engagement bei B. Brown hängte er sich an die Schauspieltruppe eines gewissen „Sugarfoot Sam from Alabam“. Wie historische Dokumente zeigen, trat Little Richard in diesem Rahmen in Frauenklamotten auf.
„Eines Abends fehlte eins der Girls“, erläuterte er dazu, „und sie steckten mich in ein rotes Ausgehkleid. So bescheuert hatte ich noch nie ausgesehen. Princess Lavonne war dann mein Bühnenname.“
Weil er nicht in hochhackigen Schuhen gehen konnte, blieb er auf einem Fleck stehen, während sich die überwiegend schwulen Zuschauer darüber belustigten, was Richard „die Freakshow des Jahres“ nannte. Er beschloss zwar bald, sich von Sugarfoot Sam zu trennen, doch der Einzug in den homosexuellen Untergrund verhalf ihm zu einem Ruf und es ergaben sich manche Gelegenheiten, mit ähnlichen Acts zusammenzuarbeiten, denen mehr daran lag, die Empfindungen Schwuler anzusprechen, als Gospelmusik oder Rhythm ’n’ Blues zu verbreiten. Solche Projekte waren etwa der King Brothers Circus, die Tidy Jolly Steppers oder die L. J. Heath Show. Für die meisten musste Richard abermals in Frauenkleider schlüpfen, sich schminken, rote Wimpern ankleben und übertrieben verhalten. Dies schien nicht der Weisheit letzter Schluss zu sein, aber zweifellos ein Weg, der aus Macon hinausführte, über Nebenstraßen in die Zentren der großen Städte Georgias und Alabamas. Und da er nun mitten im rasenden Getümmel kleiner wie großer schwarzer Talente steckte, knüpfte er Kontakte, die ihn zu seinem ersten richtigen Durchbruch führten.
Er beteiligte sich an einer weiteren Reisetruppe, den Broadway Follies. Sie gab Varietévorstellungen mit homosexuellen Sängern, Tänzern und Kabarettisten, geleitet von einem Kerl, der sich Snake nannte, und mit dem Transvestiten Madame Kilroy als Hauptattraktion. Als Richard einstieg, gehörte auch der R&B-Sänger Chuck Willis aus Atlanta dazu, der sechs Jahre älter war als er und immer noch Lehrgeld zahlte – womit er pikanterweise auf Umwegen durchkam, nachdem Richard das Musikgeschehen verändert hatte: Willis aufgepeppte Coverversion von Ma Raineys Blues-Ballade „C.C. Rider“ wurde ein durchschlagender Crossover-Hit. Die beiden künftigen Stars befanden sich im Aufwind, auch wenn sie noch darauf warteten, zum Zug zu kommen. Richard ging eine folgenreiche Verpflichtung ein, als das Baileyʼs 81 Theater in Atlanta die Broadway Follies buchte. In diesem Topclub gaben sich regelmäßig Blues-Schwergewichte mit Plattenverträgen und landesweiten Konzerten die Ehre, etwa B. B. King oder Jimmy Witherspoon. Ihre Darbietungen öffneten Richard die Augen vor der Wirklichkeit, da er sich anhand der Reaktionen seines Publikums für einen Star hielt, bis sie auftraten und buchstäblich die Wände wackelten.
Nichtsdestoweniger tat sich im Umgang mit ihnen eine weitere Chance auf, denn er lernte den Jump-Blues-Heuler Billy Wright kennen, der dem jungen Penniman verblüffend ähnlich sah. Obgleich der Mann behauptete, wie Richard 1932 geboren worden zu sein, war er unschwer erkennbar älter, undurchsichtige Vergangenheit hin oder her. Fest stand nur, dass er ein Spektakel bot und in Blues-Clubs als Frauenimitator Eindruck gemacht hatte. Als selbst ernannter „Prince of the Blues“ verteilte er seine Schminke dick im Gesicht und trug verwegene Anzüge, toupierte Haare sowie einen schmalen Schnurrbart zur Schau. Gesang bedeutete bei ihm eher Geschrei. Als er Ende der 1940er-Jahre der Hausact des Royal Peacock Club in Atlanta geworden war, nahm er seine ersten Songs für das Label Savoy ebendort auf. Sein Einstand „Blues for My Baby“ erreichte den dritten Platz in den R&B-Charts. Für Richard war Wright eine Offenbarung, so wie er das Flair des Showgeschäfts mit Gospel- und Bluesgesang oder -gekreisch verband.
„Er bereicherte wirklich mein ganzes Leben“, schwärmte er. „Er war der fantastischste Entertainer, den ich je gesehen hatte.“
Wright betreute auch einen Kreis anderer Acts, bei denen er die Fäden zog, und Richard war nicht nur als Sänger gut, sondern auch ein gewiefter gesellschaftlicher Aufsteiger. Wohl wissend, wie er Billy schmeicheln konnte, verwendete er die gleiche Schminke Pancake 32 und zollte ihm Tribut, indem er seine Stücke coverte. Das entging Wright nicht.
1951 hatte sich eine kleine Anhängerschaft um Wright geschart, der sich auch Richard anschloss, wovon er tatsächlich profitierte. Billy empfahl ihn Zenas Sears, einem Moderator des Blues-Radiosenders WGST in Atlanta, wo er selbst und andere Sänger aus der Gegend aufnahmen, die mit großen Labels arbeiteten. Der DJ zog überraschenderweise schnell einen Plattenvertrag bei RCA Victor für Richard an Land. Die Verkaufsstrategie des Labels, das ein echter Branchenriese war, beruhte auf der Fertigung von Victrola-Grammofonen, mit denen Hörer wiederum viele von RCA gepresste Titel hörten, insbesondere die für Einzelsongs erfundene 45rpm-Platten, die das veraltete 78rpm-Format abgelöst hatten (Amerikas größtes Label Columbia entwickelte bald darauf das zunächst für sinfonische Werke vorgesehene 33⅓-Vinyl).
Nach der Aufnahme bewarb Sears die Tonträger, die WGST unter der Aufsicht der Plattenfirma der jeweiligen Künstler veröffentlichte, in seiner Sendung, wofür er sich bestimmt unter der Hand vergüten ließ, wie es damals im Business üblich war – die einzige Möglichkeit, „Race Music“ im Radio unterzubringen. Selbst ein Großkonzern wie RCA tat sich im Gegensatz zu Decca, Okeh, Atlantic oder Savoy schwer mit der Durchdringung des R&B-Marktes, bis er 1953 ein Sublabel dafür gründete. Die Führungsriege des Unternehmens im New Yorker Rockefeller Center gab wenig auf Blues oder Jazz, weshalb sie Hochbegabte wie Louis Armstrong und Nat „King“ Cole anderen Firmen überließ. Dessen ungeachtet unterschied sich Richard Pennimans Vertrag nicht erheblich von anderen, die man schwarzen Künstlern anbot: Er band sich damit für acht Titel in begrenzter Auflage und Tantiemen von einem halben Cent für jedes verkaufte Exemplar. Dies war und blieb über Jahrzehnte hinweg typisch, sogar für einige sehr erfolgreiche Musiker – auch weiße –, die auf die Gelegenheit ansprangen, in ein Studio zu gelangen, was an sich schon lohnte. Wenige verdienten überhaupt etwas, und mancher fiel auf windige, raffgierige Manager herein, die es auf leichtgläubige, verzweifelt um Geltung ringende junge Männer abgesehen hatten. 1951 war Little Richard einer davon.
* * *
Zwei Monate vor seinem 19. Geburtstag durfte Richard Wayne Penniman legal ohne Buds oder Leva Maes Einverständnis Verträge unterzeichnen. Er tat dies und betrat das WGST-Studio am 16. Oktober für seine allererste Session beziehungsweise Performance ohne Publikum. RCA zahlte dafür, und heraus kamen unter der Ägide eines RCA-eigenen Produzenten seine ersten vier Songs, für die er auch das Klavier einspielte, begleitet von Billy Wrights Band. Das ausgesuchte Material passte zu dessen Repertoire. Die erste Aufnahme „Get Rich Quick“ war eines von zwei Liedern aus der Feder des britischen Blues-Komponisten Leonard Feather und ein Jive, wofür Richard zu Albert Dobbinsʼ flammenden Saxofonsolos sang und kreischte. Heute geht die Nummer als reiner Rock ’n’ Roll durch. „Taxi Blues“, der zweite Track von Feather, schlug in dieselbe Kerbe, klang aber bluesiger. Konträr dazu gerierte sich Richard mit seinen beiden eigenen Stücken, den Blues-Balladen „Every Hour“ und „Why Did You Leave Me“, als schablonenhafter Schnulzensänger. Wegen des zu hohen Registers überschlug sich seine Stimme am Rande des sexuell Zweideutigen: Männlein oder Weiblein?
Das Ganze war durchaus hörenswert, aber kaum ergreifend. Seltsamerweise klang Richard bei diesen Aufnahmen älter als ein halbes Jahrhundert später – so verklemmt, dass man den Eindruck gewann, sie seien in einem langsameren Tempo mitgeschnitten worden. Rückblickend lässt sich argwöhnen, fehlende Publikumsresonanzen und die gemeinhin beschwerliche Studioarbeit hätten der Session empfindlich viel Energie geraubt. RCA erhoffte sich am meisten von „Taxi Blues“ und veröffentlichte es mit der Katalognummer 47-3292 im November als Single. „Every Hour“ landete auf der Rückseite. Als Zenas Sears (wer sonst?) die A-Seite zum ersten Mal über den Äther jagte, blieben die Hörer des Senders davon unbeeindruckt, woraufhin Richard zur Tagesordnung zurückkehrte und die Clubs abklapperte.
Nachdem der Moderator die Scheibe umgedreht hatte, schlug „Every Hour“ einige Wellen, sodass sich Wright bewogen fühlte, flugs seine eigene Version aufzunehmen. Richards Original lief außerhalb Georgias selten im Radio, und ihm blieb die Spucke weg, als er es im Programm eines Senders aus Nashville hörte. „Das ist mein Song!“, soll er gejauchzt haben. Nicht lange, und die Jukeboxen in Macon und Atlanta waren mit dem Lied bestückt – darunter eine, die Little Richard alles bedeutete.
Bud gab nun mit seinem einst verschmähten Sohn an und fütterte die Box sogar selbst mit Münzen, um die Nummer laufen zu lassen. „Mein Daddy war zum ersten Mal in seinem Leben stolz auf mich“, erzählte Richard. Dieser Stolz ging mit der Annahme einher, der Sohn würde seinem Vater zwar zuwiderhandeln, indem er Teufelsmusik sang und sich einem anormalen Lebensstil hingab, doch der Song entschädigte sozusagen dafür, weil er auf relativ herkömmlichem Rhythm ’n’ Blues aufbaute. Dies reichte Bud, um Richard bitten zu können, unter sein Dach in der Fifth Avenue zurückzukehren – das Zuhause, aus dem Junior verstoßen worden war. Ferner setzte er sich als inoffizieller Berater für ihn ein. Der Junge fand, die Aufnahmen hätten sich schon wegen dieser neuerlichen Annäherung allein gelohnt. Er zog wieder ein und holte viel Versäumtes mit seinem Vater nach.
Bald führte der lokale Erfolg von „Every Hour“ dazu, dass der Name Little Richard Managern aus der Unterhaltungsbranche auffiel. Horace Silver, der den Blues-Bassisten Percy Welch und dessen Ensemble vertrat, besuchte die Pennimans und bot dem Sohn einen Vertrag an. Nachdem Richard ihn durch Bud bestärkt unterschrieben hatte, ging er wieder auf Achse, wobei er in Sälen des sogenannten Chitlinʼ Circuit und Underground-Clubs für Homosexuelle auftrat. Er verdiente gutes Geld, da ihm Welch 100 Dollar wöchentlich zahlte, doch die Erfahrungen, die er in der turbulenten Unterwelt des Rhythm ’n’ Blues sammelte, waren unbezahlbar. Sein nächstes Vorbild wurde der Sänger und Pianist Eskew Reeder, der sich offen zum Schwulsein bekannte, wie Billy Wright schminkte und dazu wuschelige Perücken sowie coole Panoramasonnenbrillen trug, die als Accessoire zu einem Muss für jeden Rocker wurden. Richard bestaunte Reeders Fähigkeit, noch zusammenhängende Melodien zu spielen, indem er auf die Klaviertasten der höchsten Oktave einhämmerte, was zur manisch verzückten Stimmung bei seinen Auftritten beitrug. Als Richard ihn darauf angesprochen hatte, schaute Reeder bei ihm vorbei und zeigte auf einem tragbaren Keyboard, wie es funktionierte.
Am langen Zeitstrahl der Geschichte gemessen waren solche Personen lediglich wie vorbeifahrende Schiffe in einer Nacht, die für Richard gerade erst ihren Anfang nahm. Sie fanden trotzdem Platz in seinem Herzen – und umgekehrt sollte er ihnen später den Einzug in die beginnende Ära des Rock ’n’ Roll erleichtern. Welch etwa machte mit seiner Band unter dem Banner Percy Welch and His House Rockers Aufnahmen und hatte mit dem schlüpfrigen „Back Door Man“ 1957 (nicht zu verwechseln mit dem bekannten identischen Titel von Willie Dixon) ein wenig Erfolg. Reeder seinerseits ging mit unter den Pseudonymen Esquirita und Magnificent Maloochi ins Studio, um an Little Richard gemahnende Stücke wie „Hey Miss Lucy“ oder „Rockinʼ the Joint“ einzuspielen.
Der wildere, lautstärkere Blues, der die Clubs des Chitlinʼ Circuit zum Kochen brachte, war Richards Steckenpferd, aber zu arg für RCA, also wurde er in die konventionelle, sichere Blues- und R&B-Ecke gestellt. Von einer für Januar 1952 anberaumten zweiten Aufnahmesitzung erwartete das Label weitere gleichgelagerte Songs, doch statt sich auf den Studioaufenthalt zu freuen, fühlte sich Richard missbraucht und unter Wert verkauft. Wenn er auch Distanz zu seinem Vater abbaute, indem er die Karriereleiter hochkletterte, gewann er dadurch kaum mehr Vertrauen in sein Talent. Bud glaubte offenbar, „ich sei berühmt, doch das stimmte nicht.“ Er war orientierungslos und sich seiner selbst nicht sicher. Mochte sein Vater ihm auch wohlgesinnt sein, so befürchtete er, Gott sei es vielleicht nicht.
* * *
Richard nahm diese gemischten Gefühle und eine innere Unzufriedenheit am 12. Januar 1952 mit ins WGST-Studio. Die Stücke, die er an jenem Tag aufnahm, wirken entwaffnend, und ihre Titel hätten ihm auf der Couch eines Seelenklempners eingefallen sein können – „I Brought It All On Myself“, „Please Have Mercy On Me“, „Ainʼt Nothinʼ Happening“. Nur das Letzte hatte er selbst geschrieben. Von den anderen stammte eines von Leonard Feather, der Rest von den Jazz- und Blues-Songwritern Howard Biggs und Joe Thomas, die schon für Jelly Roll Morton komponiert hatten und den Doo-Wop-Satzgesang der 1950er von Gruppen wie den Ravens oder Beavers vorwegnahmen; Biggs arrangierte auch einen der größten Crossover-Hits der Dekade, „Get a Job“ von den Silhouettes.
Richards Tracks, bei denen ihn erneut Billy Wrights Band begleitete, waren solide, aber größtenteils genauso gestrickt wie die vorangegangenen. Er raunte abermals bluesig tief, glanzlos ohne spürbaren Eifer, und die Band setzte entsprechend wenige Akzente. Es handelte sich wohlgemerkt um relativ zweckdienlichen Blues, faszinierende Merkwürdigkeiten und auf sein Gesamtwerk bezogen Entwicklungsschritte, obgleich nur wenige sie hörten, als RCA Anfang Februar Richards zweite Platte veröffentlichte, die „Get Rich Quick“ auf der A- und „Mother“ auf der Rückseite enthielt.
Gerade als die erste Nummer mit ihrem Wunschdenken widerspiegelnden Titel wie zu seinem Spott im steten Turnus bei WGST zu laufen anfing, erlitt Richard einen Rückschlag, der sein Leben auf den Kopf stellte, wobei sein Glaube zum ersten, aber nicht letzten Mal auf die Probe gestellt wurde.
Es geschah am Abend des 12. Februar 1952. Der schneidige, 41-jährige Bud Penniman mischte sich unter die Gäste des Tip In Inn, als etwas Eigenartiges die Musik und das Geplänkel am Tresen unterbrach: In der Küche knallte es mehrmals laut und heftig. Er ging nachschauen und traf den in der Gegend bekannten Hallodri Frank Tanner an – Richard nannte ihn Jahre später in befremdlicher Weise seinen „besten Freund“ –, der Feuerwerksböller in einen Ofen warf, wo sie nacheinander explodierten. Zunächst tat Bud nichts weiter, als ihn zum Aufhören zu ermahnen, doch da sich Tanner nichts sagen ließ, wurde er aus dem Club geworfen. Draußen auf dem Bürgersteig schloss er sich einer Gruppe von Halbstarken an, die ein- und ausgehende Leute anpöbelten. Nun ging Buds berüchtigtes Temperament mit ihm durch und er griff nach einer Pistole, die er im Hosenbund steckend überallhin mitnahm. Er zog die Waffe und lief auf die Straße. Kaum aber war er durch die Tür gekommen, da zückte Tanner seine eigene Feuerwaffe und drückte ab. Bud brach mit einer Kugel in der Brust auf dem Betonboden zusammen. Die Polizei traf im Gemenge ein und nahm Tanner fest. Ein Krankenwagen wurde gerufen, aber die Ärzte erkärten Bud Penniman noch vor Ort für tot.
Sein Sohn war zu der Zeit mit Percy Welch unterwegs und erfuhr erst am nächsten Morgen, als er nach Hause zurückkehrte, vom Tod seines Vaters. Beim Eintreten sah er Buds blutbefleckten Regenmantel auf der Veranda liegen. Drinnen stieß er auf Leva Mae, die ein weiteres Kind erwartete und bitterlich weinte.
„Richard“, hob sie an. „Dein Daddy ist tot. Wir haben keinen Daddy mehr.“
Er bekam auf den ersten Schock hin weiche Knie, ehe er sich fasste und wissen wollte, was passiert war. Als sie antwortete, Bud sei vor dem Tip In Inn erschossen worden, fragte er wutentbrannt nach dem Täter. Sie weigerte sich, den Namen zu nennen, weil sie Angst hatte, ihr Junge würde losstürzen, um den Mörder zu suchen, und selbst ums Leben kommen. Seine Schwester Peggie befürchtete nichts dergleichen. Sie war am Abend zuvor früher im Club gewesen – zum Tanzen mit Freunden zu Liedern von Richard aus der Jukebox, die möglicherweise noch gelaufen waren, während ihr Vater sterbend vor dem Eingang gelegen hatte. Sie war kurz vor der Tat aufgebrochen. Als jemand mit der Hiobsbotschaft zum Haus kam, lief sie außer sich vor Zorn zum Tip In Inn zurück. Tanner hatte mittlerweile ausgesagt, es sei Notwehr gewesen, und war wieder auf freiem Fuß. Die Hinterbliebenen akzeptierten diese Behauptung niemals. Obwohl Bud nie darüber gesprochen hatte, war seine Familie nicht naiv. Sie wussten, dass er mit ein paar Widerlingen zu tun hatte, die nicht lange fackelten, falls man ihnen Geld schuldete. Einige davon, so vermutete man, trugen Uniformen.
„Wir gehen davon aus, dass jemand Daddy ermorden ließ“, gab Richard nach Jahren an und fuhr recht schwammig fort: „Für einen Anwalt zum Klagen fehlte uns Geld. Wir glauben, die Polizei mochte meinen Vater nicht, weil … mehr kann ich nicht dazu sagen.“
Die Totenmesse für Bud wurde am 20. Februar in der Kapelle des Bestattungsinstituts Hutchings gehalten. Anschließend fand die Beisetzung auf dem Linwood Cemetery statt, in Anwesenheit seiner Witwe, ihren elf Kindern sowie Dutzenden Freunden, Angehörigen und eventuell auch Feinden. Hinterher kehrten die Hinterbliebenen, nun auf sich allein gestellt, zum Haus zurück. Leva Mae legte eine Stärke und stoischen Gleichmut an den Tag, die Richard an seinem Lebensabend ausgiebig in Interviews lobte – dieselben Tugenden, die er ziemlich vorausschauend in einem Song verewigt hatte, der zum Zeitpunkt der Beerdigung schon veröffentlicht war: die traurige Ballade „Thinkinʼ ʼBout My Mother“, in deren erster Zeile es heißt: „Wenn ich an meine Mutter denke, kann ich nur weinen.“
Buds Erschießung wurde nie gründlich untersucht, geschweige denn aufgeklärt. Sie geriet schlicht in Vergessenheit, als der Fall irgendeines Mannes mit dubiosen Seilschaften, der sich zu weit aus dem Fenster gelehnt hatte. Das Nachspiel beschränkte sich darauf, dass Frank Tanner im Juni 1955 des Mordes angeklagt werden sollte, doch der Bezirksanwalt wies die Klage im Oktober ab.
Das Leben der Pennimans ging weiter, ohne dass sie damit rechnete, jemand von ihnen würde einmal reich oder berühmt. Richard rückte zum Versorger auf, als sein Bruder Charles den Marines beitrat und zum Dienst im Koreakrieg beordert wurde. Das Tip In Inn, das nie viel Umsatz gemacht hatte, schloss seine Pforten, da Leva Mae es nicht mehr unterhalten konnte. Zum Leben blieben ihr Buds Ersparnisse – rund 500 Dollar, die sie verwendete, um das Haus abzubezahlen sowie Lebensmittel und Kleidung für die Kinder zu kaufen. Später heiratete sie einen anderen Mann namens Enotris Johnson, zog weitere Kinder groß und hielt die Familie zusammen. Richard zeigte sich Frank Tanner gegenüber ausgesprochen versöhnlich. Ungefähr zehn Jahre später, nachdem er tatsächlich ein strahlender Stern, reich und berühmt geworden war, stattete er seinen Verwandten daheim einen Besuch ab. An diesem Tag stand Tanner plötzlich vor der Tür, um „uns um Vergebung zu bitten.“
Und das, so Richard, „haben wir getan.“
* * *
Ob verziehen oder nicht, Richard musste mit dem Umstand leben, dass Gott ihm auf grausame Weise den Vater genommen hatte, dessen Zuspruch er brauchte und der zu der Einsicht gelangt war, an ihn zu glauben. Am Morgen nach seinem Tod hätte ihm Bud sogar ein Auto gekauft, damit er stilvoll zu seinen Auftritten anreisen konnte. Das brutale Schicksal, das sein Leben beendet hatte, drang tief in die Seele und das Unterbewusstsein seines Sohnes, wodurch ihm Zweifel an Gottes Gnade kamen. War er mit seinem frevelhaften Lebenswandel irgendwie schuld an Buds Tod? Dennoch machte er unter emotionalem Druck weiter; er musste es schaffen, unbedingt. 1953 waren die Aussichten dafür allenfalls vage. Der Flop von „Get Rich Quick“ gereichte ihm bloß zum Spott, zumal RCA ihre verbliebenen Little-Richard-Titel in Form zweier weiterer Veröffentlichungen im Mai und November ausschlachtete: Die Titel der A-Seiten waren genauso vielsagend, „Ainʼt Nothinʼ Happening“ und „Please Have Mercy On Me“ (erst 1958 erschien der letzte der acht Titel über das Billiglabel RCA Camden). Keine der Platten wurde mit Begeisterung beworben oder verkauft, und Little Richard schien selbst für Zenas Sears passé zu sein.
Vor Neujahr endete die Zusammenarbeit des aufstrebenden Künstlers mit RCA; sein Vertrag wurde nicht verlängert. Richard beschönigte sein Scheitern nicht, suhlte sich aber nicht in Selbstmitleid. Auch wenn ihn alle anderen hängen ließen, gab er sich nicht selbst auf. Er war sogar so optimistisch, den Herrn auf seiner Seite zu wähnen, der ihn als Botschafter, Musikfreund und Prediger ansah. Obwohl er wiederholt in Erwägung zog, ein geistliches Amt anzunehmen, schob er den Entschluss auf, während er in den Clubs weitersang und Schnipsel für Songs sammelte, die er zu vollenden gedachte.
Seine Zuversicht grenzte an Realitätsverlust. Anfang 1953 arbeitete Richard am Greyhound-Busbahnhof in Macon als Tellerwäscher – nicht notgedrungen, wie er betonte, sondern weil er in seinen Pausen gern im Warteraum saß, um die Reisenden im Vorbeigehen zu beobachten und sich anzuhören, was sie zu erzählen hatten. Eine seiner immerzu changierenden Geschichten zur Entstehung von „Tutti Frutti“ besagte, das unvergessliche Intro, das zum Gegenstand weitreichender akademischer Debatten mehrerer Generationen wurde, sei ihm dort zugeflogen.
„Zu der Zeit spülte ich an der Haltestelle Geschirr“, rekapitulierte er. „Ich konnte nicht gegen meinen Chef aufmucken. Er stellte mir all die Töpfe zum Abwaschen hin, weshalb ich mir eines Tages sagte: „Ich muss etwas unternehmen, sonst hört das nie auf – Awap bop a lup bop a wop bam boom, raus damit!“ Das meinte ich in der Situation. So schrieb ich „Tutti Frutti“ in der Küche, wo auch ‚Good Golly, Miss Molly‘ und ‚Long Tall Sally‘ entstanden.“
Ob er diese Story nicht vielleicht erfunden hatte, lässt sich nicht eruieren, doch eines ist sicher: Er hörte die Musik, zu der er singen wollte. Darüber hinaus hatte er Schneid und ein Selbstwertgefühl, womit er sich Menschen aufdrängte, die ihn seinem Ziel näherbringen konnten. Nachdem er jedem auf den Zahn gefühlt hatte, der mit der Musikszene in Verbindung stand, sprach er wiederholt diesen oder jenen an und wurde in der Regel abgewiesen, bis er sich irgendwann Clint Brantley anbiederte, einem großtuerischen Schwarzen. Der hatte etwas aus sich gemacht und besaß einen Club an der Fifth Street, das Two Spot. Des Weiteren promotete er Konzerte im Macon City Auditorium und managte viele der Acts, die in seinem Lokal auftraten. Obzwar er nicht viel von farbigen Sängern zu halten schien – er nannte sie „kleine Nigger“ –, förderte er ihre Karrieren im Musikgeschäft, indem er ihnen eine Bühne gab und sie managte, falls er sich etwas von ihnen versprach – gegen 50 Prozent Provision. Er konnte auch spendabel sein und sowohl Vorschüsse für Darbietungen als auch Spesen zahlen, wofür er gleichwohl unter Androhung körperlicher Gewalt saftige Zinsen erhob.
Brantleys übte eine so starke Anziehung aus, dass er bestimmen durfte, wie die allmählich fortschreitende Integration in Macon vonstattenging. In seinem Club und dem Auditorium gab es grob festgelegte Bereiche für „Weiß“ und „Farbig“ – doch er kehrte die Gepflogenheiten des Südens um, sodass es die Weißen waren, die weiter hinten saßen. Im Auditorium durften sie auch nur im hinteren Teil auf dem Balkon sitzen, den man symbolisch durch ein Seil abtrennte. Keine Frage, kaum jemand liebte diesen Mann, und erst recht nicht wollte man ihn auf dem falschen Fuß erwischen. Dennoch war die Person, die ihn am wenigsten ertragen konnte, der Auslöser für die Entwicklung der Soulmusik: Little Richard, der Brantley bereitwillig zu seinem Manager machte, obwohl er über kurz oder lang Konflikte mit ihm kommen sah.
Als Brantley den Sänger 1953 unter seine Fittiche nahm, war er ihm natürlich schon geläufig, zumal Richards Duett mit Sister Rosetta Tharpe zu den unvergessenen magischen Konzertmomenten im Auditorium gehörte. Trotzdem hatte er damit abgewartet, ihn als Schützling zu gewinnen, bis Richard volljährig war, aber zeigte, dass er noch wie ein Teenager singen konnte. Hinzu kam selbstverständlich, dass Bud Penniman de facto sein Manager gewesen war. Die Umstände änderten sich mit dem Tod des Vaters, aber Brantley machte sich keine großen Hoffnungen, auch weil Richards Reinfall mit RCA eine Hürde darstellte, die es zu überwinden galt. Die erste Amtshandlung des neuen Managers bestand darin, den Sänger auf Tour zu schicken, um die Musikszene aufzurühren, damit sein Name die Runde machte.
„Such dir eine Band“, riet er ihm, „und du bekommst genug Arbeit.“
* * *
Wie sich herausstellte, sollte die Band ihn finden. Als Brantley einen Gig für ihn im Nachtclub New Era in Nashville buchte, suchte ein Quintett unter Trompeter Raymond Taylor, dessen Ehefrau Mildred Schlagzeug spielte, einen Frontmann. Sie hörten den Jungen aus Macon und boten ihm den Posten prompt an.
Ihr Name lautete The Tempo Toppers, und tags darauf gaben sie ihren nächsten Auftritt im Dew Drop Inn in New Orleans. Da sie zuvor nicht mehr proben oder Richard wenigstens in einen Anzug stecken konnten, der zu ihren Outfits passte, übernahm er den Gesang für Gospel- und Blues-Nummern, die dargeboten wurden, während eines der Bandmitglieder Kraftakte vollführte, etwa das Hochheben eines Stuhls, auf dem jemand saß. Trotzdem war Richard eben Richard: ungezügelt mit plötzlichen Wechseln ins Falsett, ohne je falsche Töne zu erwischen, während seine Mätzchen am Klavier und seine heißspornige Persönlichkeit das Publikum in Wallung brachten.
Zu dem Zeitpunkt drangen die jungen Wurzeln des Rock ’n’ Roll bereits in Blues-Erde, was sich in halsbrecherischen Freiformarrangements aus wiederkehrenden Hooks zu von Piano und Bläsern hervorgehobenen Stampf-Rhythmen äußerte, die mit rumpelnden Basstönen und polternden Drums einhergingen. Die Tempo Toppers, zu denen außerdem Billy Brooks, Bary Lee Gilmore und Jimmy Swann gehörten, passten recht gut in dieses Schema, das Taylor auf die Eigenkompositionen der Gruppe anwandte. Wer das Glück hatte, Little Richards rohe, offenbarende Kraft in dieser Phase zu sehen und zu fühlen, konnte auch behaupten, die Zukunft amerikanischer Musik zu erleben; im Süden galt sein Name auf jener Tour eine ganze Menge. Der Saxofonist Hamp Swainn, der mit Richard die High School besucht und danach die Bigband The Hamptones gegründet hatte – 1954 wurde er zudem beim Radiosender WBML Macons erster schwarzer Diskjockey –, spielte oft in denselben Clubs des Chitlinʼ Circuit. „Sobald es hieß, Little Richard würde kommen, durfte man mit Zulauf rechnen“, gab er an. „Überall in Georgia, Alabama und Florida.“ Bald übernahm Richard den Gesang in Hamps Band, und die beiden sollten neben Clint Brantley den beinahe parallelen Aufstieg von James Brown beflügeln, der knapp ein Jahrzehnt früher emporkam als Otis Redding.
Der gewaltige Zuspruch, den Richard in diesen Lokalen erhielt, sicherte ihm stattliche Einkünfte, die er Brantley größtenteils vorenthielt, um am Ende nicht nur mit ein paar Kröten dazustehen. Beim Auftritt der Toppers im Club Matinee in Houston ergab sich dann auch die Chance, zu einer anderen Plattenfirma zu wechseln. Don Robey, der das florierende R&B-Label Duke-Peacock besaß, besuchte das Konzert – und fand die stürmisch virtuose Performance des Sängers umwerfend, der den Zuschauern zum Schluss mit auf den Weg gab: „Ich bin Little Richard, der König des Blues … und seine Königin ebenfalls!“ Robey hatte für sein Unternehmen ein Programm aus jungen, prototypischen Rock-’n’-Roll-Acts zusammengestellt, darunter Clarence „Gatemouth“ Brown, Memphis Slim, Floyd Dixon, der glücklose Johnny Ace und Big Mama Thornton, die im Lauf jenes Jahres noch mit dem knorrigen „Hound Dog“ aufwartete, produziert von dem Blues-Bandleader Johnny Otis aus Los Angeles.
Robey, ein Tausendsassa, war schon Glücksspieler, Leiter eines Taxiservice, Spirituosenhändler und Besitzer des piekfeinen Bronze Peacock Club gewesen, den er schließlich zu einem Aufnahmestudio umgebaut hatte. Er stand nicht nur dem Betrieb vor, sondern managte auch die meisten Künstlerinnen und Künstler in seinem Kader, schrieb und verlegte ihre Songs – genauer gesagt: Er behauptete, sie geschrieben zu haben, oder er dachte sich falsche Urhebernamen für die Kompositionsangaben aus, wodurch die Tantiemen in seine Tasche wanderten. Er machte wie Clint Brantley ein Geschäft aus der Unterstützung schwarzer Musiktalente, kam Richard allerdings als Mensch in peinlicher Weise allzu vertraut vor. Robey hätte fast Brantleys Zwilling sein können, ein Afroamerikaner mit hellerer Haut, der sich gegenüber „niederen“ Schwarzen mit dunklerem Teint äußerst abschätzig verhielt und ihnen unverblümt nach dem Motto „Entweder so oder gar nicht“ in die Aufnahmen pfuschte. Ohne sich die Mühe zu machen, die Band oder ihren Frontmann hinzuzuziehen, schlossen Brantley und Robey einen Vertrag, wobei der Manager in die üblichen Künstlertantiemen von einem schlappen halben Cent einwilligte. Zur Zeit der Unterzeichnung hatten sich die Taylors von den Toppers getrennt, um eine neue Formation zu gründen, die Deuces of Rhythm; Richard sang zeitweise auch dort. Weil die Toppers bei ihrer ersten Peacock-Session drei von Taylors Songs einspielen sollten (für einen erhielt Robey die Credits) und dessen Frau ebenfalls mitwirkte, einigte man sich auf einen Kompromiss: Die erste Platte würde unter dem Bandnamen Deuces of Rhythm and Tempo Toppers, Lead: „Little Richard“ erscheinen.
Die Aufnahmen fanden am 25. Februar 1953 in Robeys Studio statt. Die ausgewählten Lieder hatten tadellose Hooks, die aktuellen Trends entsprachen. „Ainʼt That Good News“ langte tief ins Weihwasserbecken, da der Titel einem Spiritual entlehnt war (was später auch für den gleichnamigen Klassiker von Sam Cooke galt), und dazu gab es erst trägen, dann dank eines Tempowechsels flotten Blues. Mit „Fool at the Wheel“ tat man der Besessenheit des frühen Rock ’n’ Roll von schnellen Autos Genüge, während das Stück mit dröhnendem Bass und fieberhaften „Ba doo baah“-Kehrversen Fahrt aufnahm. „Rice, Red Beans and Turnip Greens“ machte einen Schlenker zurück zu traditionellem Satzgesang, aufgewertet durch einen geschmeidigen Orgelpart, und „Always“, die einzige Komposition von Robey, war auch die schwächste, ein noch lauerer Aufguss jenes Chorprinzips.
Die Tracks haben jedoch alle Charme – man höre Richards hohe Töne, die hervorstechen –, wie es schon bei jenen für RCA der Fall war, bloß dass ihnen das aufwieglerische Moment der Bühnenperformance des Frontmanns abging. Diese fehlende Magie enttäuschte niemanden so sehr wie ihn selbst, doch er riss sich zusammen, als die Musik veröffentlicht wurde – erst „Ainʼt That Good News“ mit „Foot at the Wheel“ als B-Seite, dann mit Robeys Erlaubnis unter dem Banner Tempo Toppers, Featuring: „Little Richard“, die Single „Always“ / „Rice, Red Beans and Turnip Greens“. Da die Platten nicht beworben oder im Radio gespielt wurden, verkaufte man nur wenige Exemplare. Dies erhöhte naturgemäß die Spannungen zwischen Künstler und Label. Richard bemerkte einmal über Robey, der in der Stadt „schwarzer Cäsar“ genannt wurde und sich mit schwerbewaffneten Schlägertypen umgab: „Er war fast wie ein Diktator.“
Und weiter: „Ein Schwarzer, der wie ein Weißer aussah, und er war sehr streng. Er trug einen fetten Diamantring an einer Hand, kaute ununterbrochen auf einer dicken Zigarre und fluchte über mich … Er hat dich total bevormundet, wie um jeden Atemzug zu kontrollieren, den du machst. Ich verachtete ihn dafür, dass er so gemein war.“
Richard hielt damit nicht hinterm Berg, sondern gab anderen Acts Bescheid, Robey sei „grob“ und „fies“, „hat mich nicht bezahlt“: ein „Gauner“, der „all die Leute nur ausgenutzt hat – und ausgezehrt.“ Demgemäß war Robey „sehr böse auf mich.“ Die beiden stritten sich oft, bis dem Plattenboss der Gaul durchging. „Er stürzte sich auf mich, sodass ich umfiel, und trat mir in den Bauch. Ich erlitt einen Zwerchfellbruch, der mir jahrelang zu schaffen machte, und musste operiert werden. Er war aber bekannt dafür, Leute zu vermöbeln. An allen hat er sich vergriffen, nur Big Mama Thornton nicht. Sie machte ihm Angst.“
Dieser Eklat bedeutete praktisch das Ende ihrer Geschäftsbeziehung und kam in einem passenden Moment: Robey hatte eingesehen, dass er sich nicht gegen Richard durchsetzen konnte, und es geschafft, den allgegenwärtigen Johnny Otis zu weiteren Aufnahmen der Tempo Toppers zu bewegen, hinter denen er seine eigene Band leiten sollte. Der Sohn griechischer Einwanderer und Leader einer populären Blues-Jazz-Combo wurde als hellhöriger Talentsucher geschätzt. Er hatte Little Esther Phillips und Etta James entdeckt, aber auch R&B-Hits wie „Double Crossing Blues“ oder „Cupidʼs Boogie“ mit seiner Band fertiggebracht. Die Entdeckung von Big Mama Thornton ging dem bahnbrechenden „Hound Dog“ voraus, das er mitschrieb, produzierte und als Schlagzeuger einspielte.
Otis, der sprichwörtlich als Kaiser eines veritablen R&B-Imperiums mit eigenen Fernsehserien und Radiosendungen in Nordkalifornien angesehen werden konnte, fand Richard sympathisch und ließ ihn am 3. Oktober in Robeys Studios vier neue Lieder aufnehmen. Es waren Eigenkompositionen des Sängers, eingespielt von Otisʼ Band mithilfe von Backgroundsängerinnen. Die Titel lauteten „Maybe Iʼm Right, „I Love My Baby“, „Little Richardʼs Boogie“ und „Directly From My Heart To You“. Der Produzent verlieh ihnen merklichen Glanz, indem er die belanglosen Texte mit klangvollen Orchesterarrangements aufpolierte. Die sinnliche Ballade „Maybe“, die auch Esther oder Etta hätten singen können, ließ Richards Stimme breiter und eindringlicher wirken, wobei er manche Zeile mit leisem Seufzen und wonnigem „ohhh“ betonte. „Directly“ war ein Blues-Feger mit funky Piano und E-Gitarren-Break. „I Love My Baby“ und „Little Richardʼs Boogie“ animierten zum Tanzen und griffen Little Richards späterem Schaffen voraus. Aufgewertet wurden beide von Otisʼ Fertigkeiten als Vibrafonist und den Shouts der Bandmitglieder.
Bevor man diese Musik aber veröffentlichen konnte, hatte sich Richard Knall auf Fall aus dem Staub gemacht, nachdem Robey ihn körperlich angegriffen und damit seinen Stolz verletzt hatte. Ohne den Tempo Toppers oder dem Label-Chef ein Wort zu sagen, war er nach Macon zurückgefahren, um erst mal seine Wunden zu lecken, was den Plan einer Tournee zur Bewerbung der Tonträger hinfällig machte. Der erboste Robey wiederum verzichtete aus Trotz und ungeachtet der Kosten und Umstände, die das Studioprojekt verursacht hatte, darauf, weitere Aufnahmen von Little Richard herauszubringen, jedenfalls bis zu dessen massivem Erfolg: Dann erschienen nämlich doch noch die übrigen vier Titel unter dem Namen Little Richard with the Johnny Otis Orchestra. (Sie wurden erst 2007 auf einem Album veröffentlicht, lange nach Robeys Tod und dem Verkauf seines Labels samt Backkatalog, das dann zwischen ABC und MCA hin und her gereicht wurde. Gerüchten zufolge existieren noch mehr von Otis produzierte Aufnahmen mit Richard. Zudem spielte dieser „Directly“ 1966 für Modern Records im Stil von James Brown neu ein).
The Tempo Toppers, die sich schon vor den Sessions alleingelassen gefühlt hatten, zogen sich nach Nashville zurück. Ihr Kratzen am Starruhm beschränkte sich darauf, einmal kurz mit dem beinahe berühmten Little Richard in einem Boot gesessen zu haben, der seinerseits die Trennung von ihnen nicht bereute. Vielmehr war er stolz darauf, Don Robey den Rücken gekehrt zu haben, wozu er später erklärte: „Ich ließ nicht zu, dass er mich kontrollierte. Wenn ich keinen Frieden finde, bin ich nicht glücklich. Verträge nützen mir nichts, solange ich nicht entspannt sein kann. Einen Vertrag schließen bedeutet, jemandem dein Wort zu geben; das Papier ist für mich irrelevant.“ Inzwischen weinte Robey ihm kaum eine Träne hinterher. Er erweiterte seinen Einflusskreis in der Gospel-Blues-Nische. Junior Parker und Bobby „Blue“ Bland versetzten ihn in die Lage, seine Unternehmungen 1973 – zwei Jahre vor seinem Tod – als Paket an ABC zu verkaufen. Im Nachhinein dürfte er sich jedoch darüber geärgert haben, einen Goldesel und damit auch eine wichtigere Rolle in der Musikgeschichte ausgeschlagen zu haben. Die wäre ihm nämlich zuteilgeworden, hätte er Little Richard halten und sein Potenzial ausschöpfen können. Die Frage, ob überhaupt jemand dazu fähig war, blieb freilich offen.
So wie die Dinge standen, steckte der Künstler anscheinend immer noch voller Widersprüchlichkeiten: Er verband Weltliches und Geistliches, war protzig und waghalsig, aber auch traditionsgebunden spirituell, indem er jahrhundertealte Grundlagen auf neuen abstrakten Individualismus und primitive Genusssucht anwandte, und setzte sich sogar über Geschlechtergrenzen hinweg. Wer würde ihm in einem Land, das an archaischen kulturellen Normen festhielt – zumal in einer Branche, die von ausbeuterischen weißen Geschäftsleuten und schwarzen dominiert wurde, die es ihnen gleichtaten – eine Chance geben in dem Wissen, dass er sich nicht einfach in eine sichere Ecke des musikalischen Rings stellen und den Mund verbieten ließ, wenn man ihn linkte?
Die Mächte des Schicksals gaben schon bald die Antwort auf diese Frage.