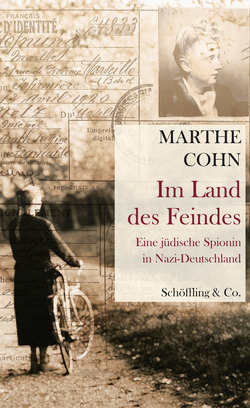Читать книгу Im Land des Feindes - Marthe Cohn - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEine fremde Welt
Poitiers war für uns eine fremde Welt. Oberhalb des Zusammenflusses zweier Flüsse auf einem Hügel gelegen, umgeben von den Dörfern im Tal, war Poitiers, verglichen mit dem geschäftigen, kosmopolitischen Metz, eher ländlich und verschlafen. Anders als noch vor ein paar Jahren, als Scharen von Juden aus dem Osten hierherkamen, lebten jetzt nur noch drei oder vier jüdische Familien in dieser überwiegend katholischen Gegend. Ich hatte den Eindruck, dass die Leute nicht mal wussten, wie ein Jude aussah, und überrascht feststellten, dass wir weder Hörner noch Schwänze hatten. Sie waren warmherzig und freundlich und gaben uns das Gefühl, willkommen zu sein. Schließlich waren wir Landsleute und fürchteten wie sie den gemeinsamen Feind.
Mit unseren wenigen Habseligkeiten kamen wir zunächst bei Onkel Benoît und seiner schwangeren Frau Fannie in ihrer kleinen Wohnung am Place de la Liberté im Zentrum der Stadt unter. Benoît war Börsenhändler und einer der wenigen Menschen, mit denen sich mein Vater verstand. Er hatte in seinem Leben schon viel mitgemacht: Seine erste Frau war bei einem Autounfall ums Leben gekommen, ein Kind war gestorben, als es noch ganz klein war, und sein überlebender Sohn war autistisch und sprach kein Wort. Trotz dieser Schicksalsschläge war Benoît gelassen und unbeschwert, also das genaue Gegenteil seines aufbrausenden Bruders. Mein Vater hatte Benoît im Waisenhaus unter seine Fittiche genommen und die beiden Brüder standen sich seitdem sehr nah. Benoîts Gegenwart hatte eine beruhigende Wirkung auf meinen Vater.
Es war für Benoît und Fannie sicher nicht leicht, plötzlich neun Leute – einschließlich meiner Großmutter – bei sich aufzunehmen. Wir blieben allerdings nur ein paar Tage und zogen dann in die leere Wohnung darunter. Später stießen noch Jacquies Onkel Oskar Kluger und ein paar andere Verwandte aus Metz zu uns, darunter mein geliebter Onkel Léon – ein jüngerer Bruder meiner Mutter –, seine Frau Claire und ihre gemeinsame Tochter Myriam.
Léon war Geschäftsmann. Er besaß einen Laden in Metz und hatte ebenso wie wir alles zurücklassen müssen. Er verehrte meine Mutter und schätzte meinen Vater. Er sah gut aus, war intelligent und freundlich und als eins von acht Kindern an Trubel gewöhnt. Wie alle Brüder meiner Mutter mochte er mich besonders gern, weil ich ihn an sie als junges Mädchen erinnerte. Wir waren sehr froh, dass er uns in dieser fremden Stadt Gesellschaft leistete.
Mehrere Tage lang schliefen wir, wo wir gerade ein Plätzchen fanden: auf Sofas oder dem Fußboden, bis uns die Stadtverwaltung Unterkünfte zuwies. Cécile und ich teilten uns ein Zimmer in der Wohnung einer netten, gutbürgerlichen Familie, den Laffons, die überaus freundlich zu uns waren. Madame Laffon hatte einen Sohn im Ersten Weltkrieg verloren und wir konnten ihr keinen größeren Gefallen tun, als ihr zuzuhören, wenn sie uns jeden Tag seine zerknitterten Briefe von der Front vorlas und weinte, als wäre es das erste Mal. Sie schien nicht über den Verlust hinwegzukommen.
Tagsüber versammelten wir uns in Benoîts Wohnung oder erkundeten die Innenstadt und abends kehrten wir in unsere jeweiligen Unterkünfte zurück. Wir hatten weder ein eigenes Geschäft noch irgendwelche Einkünfte, ja nicht einmal ein eigenes Dach über dem Kopf. Vater konnte nicht arbeiten, da er nur gebrochen Französisch sprach und kaum jemand in Poitiers Deutsch verstand. Cécile, Stéphanie und ich streiften tagelang durch die engen, verwinkelten Gassen, bewunderten die Kathedrale, die wunderschönen romanischen Kirchen, die Universität und die galloromanischen Ruinen. Wir schlenderten durch das Straßengewirr und staunten über die Fachwerkhäuser aus dem 15. Jahrhundert und die Residenz der Herzöge von Aquitanien. Bald schon kannten wir die Stadt wie unsere Westentasche.
Nach einem Monat, als sich die Situation im restlichen Europa nicht gebessert hatte, begriffen wir, dass dies nicht nur ein kurzer Urlaub war. Cécile fand ein möbliertes Haus mit einem großen, ummauerten Garten in Chauvinerie, am Ende eines steilen Hügels nördlich des Bahnhofs, und so war unsere Familie endlich wieder vereint.
»Lasst uns ein eigenes Geschäft aufmachen«, schlug Maman kurz nach unserem Einzug enthusiastisch vor. »Dann hätten wir ein Einkommen und außerdem was zu tun.«
Mit Onkel Léons Hilfe und dem Geld, das uns Fred bei seinem letzten Heimaturlaub gegeben hatte, mieteten wir einen Laden in der Rue de la Regratterie und eröffneten einen Kleidergroßhandel. Wir tauften unser Unternehmen »Etablissement Elby«, L.B., nach den Initialen meines Onkels. Onkel Léon fuhr mit seinem Wagen in entlegene Dörfer und bot unsere Waren in kleinen Läden an. Schon bald florierte das Geschäft und Cécile, Léon und ich arbeiteten ununterbrochen, sechs Tage die Woche, um unsere Kunden zufriedenzustellen.
Maman blieb zu Hause und kümmerte sich um den Haushalt, während Papa die Auktionshäuser abklapperte und alte Uhren und Lampen ersteigerte, um sie später weiterzuverkaufen. Hélène, Rosy und Jacquie gingen zur Schule. Die friedliebende, stille und bescheidene Stéphanie, die immer noch unbedingt Ärztin werden wollte, begann ihr Medizinstudium an der örtlichen Universität. Jeden Abend kam sie strahlend nach Hause und erzählte uns begeistert, was sie gelernt hatte. Sie war intelligent und aufgeweckt und äußerst warmherzig. »Mein größter Wunsch ist es, anderen Menschen zu helfen«, sagte sie oft und ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht so selbstlos war wie sie.
In unserer knapp bemessenen Freizeit arbeiteten wir als freiwillige Helferinnen im örtlichen Flüchtlingszentrum, einer Einrichtung, die französische Flüchtlinge unterstützte, die aus dem Osten Frankreichs nach Poitiers strömten. Auf der Flucht vor den Deutschen hatten Hunderttausende ihre Heimat verlassen. Stéphanie und ich hatten uns kurz nach unserer Ankunft in Poitiers freiwillig gemeldet. Wir verbrachten viele Stunden in diesem Zentrum am Bahnhof und kümmerten uns um die Hunderte Menschen, die täglich eintrafen. Als wichtiger Knotenpunkt auf der Bahnstrecke zwischen Paris und Bordeaux war Poitiers nicht nur als Evakuierungsort für Flüchtlinge aus Metz bestimmt worden, sondern auch als Durchgangsstation für alte Männer sowie Frauen und Kinder, die hier ein oder zwei Tage Rast einlegen konnten, bevor sie in die ihnen zugewiesenen Städte im Westen oder Süden weiterreisten. Da wir selbst Flüchtlinge waren, hatten wir Mitleid mit diesen Menschen und versuchten, ihnen ihre Situation zu erleichtern, indem wir für die Elsässer und Lothringer, die kaum Französisch sprachen, dolmetschten.
Wir wurden sofort herzlich aufgenommen von den jungen Männern und Frauen des örtlichen Jugendherbergswerks, die dort ebenfalls als Freiwillige arbeiteten. Unter ihnen war Nonain, ein kleinwüchsiger Kommunist, der lautstark über Hitler und die Brutalität seiner Armeen herzog.
»Dieser Dreckskerl ist einfach größenwahnsinnig«, wetterte er. »Er wird keine Ruhe geben, bis er ganz Europa in Schutt und Asche gelegt hat.« Er verteidigte vehement die kommunistischen Anschläge gegen die Faschisten in Italien, Spanien und Deutschland und war äußerst besorgt wegen der Auswirkungen des Hitler-Stalin-Pakts.
Über Nonain lernten wir Heinrich kennen, einen großen blonden Deutschen, der wegen seiner kommunistischen Überzeugung seine Heimat und seine Familie verlassen hatte und seine Arbeitsstelle aufgeben musste. Er war sogar in Spanien gewesen und hatte sich den Republikanern im Kampf gegen Franco angeschlossen. Seit 1936 hatten meine älteren Geschwister und ich die republikanische Armee sowohl moralisch als auch finanziell unterstützt. Wir mochten Heinrich, wir wussten, wie es war, aus seiner Heimat vertrieben zu werden. Deshalb hatte er unser ganzes Mitgefühl. Er sah gut aus, hatte leuchtend blaue Augen und eine Schwäche für Cécile, die ihn ihrerseits links liegen ließ. Meine Eltern hingegen waren ihm zugetan. Durch ihn hatten sie die seltene Gelegenheit, Deutsch zu sprechen, und so luden sie ihn häufig zu uns zum Essen ein. Dann diskutierten wir meist angeregt über Politik. Es imponierte mir, wie ergreifend er von seinen Überzeugungen sprach, und ich bedauerte es, dass nicht alle Deutschen so waren wie er.
»Warum bist du eigentlich so unfreundlich zu Heinrich?«, fragte ich eines Abends Cécile in der Küche, nachdem er den Abend bei uns verbracht hatte.
»Weil ich ihm nicht über den Weg traue«, erklärte sie kategorisch.
»Aber Cécile!«, rief ich. »Du kannst doch nicht allen Deutschen misstrauen. Heinrich empfindet gegenüber Hitler das Gleiche wie wir. Oft ist er der Erste, der ihn kritisiert.«
»Das ist mir egal«, erwiderte sie. »Ich traue ihm trotzdem nicht.« Und dabei blieb sie.
Fast ein ganzes Jahr lang passierte nichts, was die tägliche Routine unseres neuen Lebens in der französischen Provinz gestört hätte. Der Laden ernährte uns, die Flüchtlinge kamen und gingen, und unsere Freundschaften mit anderen jungen Leuten wie den Mitgliedern des örtlichen Jugendherbergswerks vertieften sich. Wenn wir in der Natur wanderten oder im Clain schwammen, vergaßen wir fast, dass unser Leben bedroht war. Wir veranstalteten Picknicks im Park, zelteten mit unseren Freunden und kamen anschließend müde und glücklich nach Hause, wo wir von weiteren müßigen Tagen träumten.
Währenddessen ging der Sitzkrieg weiter: Die französischen Truppen hatten sich hinter der Maginot-Linie verschanzt, die deutschen hinter dem Westwall. Von kleineren Scharmützeln abgesehen, verharrten sie in ihren Stellungen. Großbritannien hatte mehrere Hunderttausend Soldaten nach Frankreich geschickt, um unsere Verteidigung zu stärken, während die tapferen Finnen in Skandinavien ihr Bestes gaben, um die plündernden Russen zurückzudrängen. Zum ersten Mal seit dem Ersten Weltkrieg wurden die Lebensmittel rationiert, es gab eine Verdunkelungspflicht bei Fliegeralarm und wir lernten, wie wir uns bei Giftgasangriffen zu verhalten hatten.
Im Frühjahr 1940, als Hitler in Dänemark und Norwegen einmarschierte und Holland und Belgien kurz darauf in einem Blitzkrieg eroberte, nahm die Bedrohung für uns konkretere Gestalt an. Wir dachten an Jacquies kleine Schwester Mindele, die irgendwo in den Niederlanden lebte, und bangten um ihre Sicherheit.
Zum Glück war Jacquie zu jung, um die Folgen der deutschen Überfälle zu begreifen, und so beruhigten wir ihn jedes Mal, wenn er nach seiner Familie fragte, mit irgendwelchen Ausflüchten. Trotzdem war er verbittert darüber, dass seine Mutter ihn und seine Geschwister »im Stich gelassen« hatte. Oft klammerte er sich an meine Mutter und fragte: »Tante, das hättest du nie gemacht, oder?« Sie erklärte ihm dann, dass seine Mutter keine andere Wahl gehabt hatte, aber das schien er nicht zu verstehen.
Jeden Abend drängten wir uns ängstlich um das Radio in banger Erwartung der Nachrichten von Radio France. Wir erfuhren von Chamberlains Rücktritt in London und seinem Nachfolger Winston Churchill, vom Vormarsch der deutschen Truppen nach Nordfrankreich und den Massenevakuierungen französischer und britischer Einheiten aus Dünkirchen. Calais und Boulogne fielen an die Deutschen, die anschließend den ganzen Nordosten, einschließlich Metz, besetzten. Wir dachten oft an unser Haus in der Rue du Maréchal-Pétain, an unsere Freunde, die zurückgeblieben waren, und an Großpapas kostbare Bibliothek. Unser Premierminister Paul Reynaud trat zurück und Pétain, ein Held aus dem Ersten Weltkrieg, nach dem auch unsere Straße benannt war, kam an die Macht.
»Wir leben in aufregenden Zeiten«, sagte ich eines Abends atemlos zu meiner Mutter, nachdem wir das Radio ausgeschaltet hatten und in völliger Stille dasaßen.
»Etwas weniger aufregende Zeiten wären mir lieber«, erwiderte sie knapp und wandte sich wieder den Socken zu, die sie gerade stopfte. Mein Vater lehnte sich in seinem Sessel zurück und schloss die Augen.
In meinem damaligen Optimismus war ich davon überzeugt, dass unserer Familie nichts passieren konnte, solange wir als Nation den Deutschen Paroli boten. Wir waren weit genug südlich, um vor dem Feind sicher zu sein. Wir lebten ein Leben, das wir uns vor etwa einem Jahr nicht hätten vorstellen können. Wir arbeiteten hart und vergnügten uns am Wochenende. Mein Pazifismus war ungebrochen. Aber im Mai 1940 änderte sich die Situation schlagartig.
Jeden Morgen gingen Cécile und ich den Hügel hinunter zum Bahnhof und dann auf der anderen Seite wieder hinauf zu unserem Laden, wo wir den ganzen Vormittag unsere Kunden bedienten. Unsere Mittagspause verbrachten wir zu Hause bei unseren Eltern, aber nachmittags kehrten wir wieder zum Laden zurück. Die Tage waren lang und die Arbeit anstrengend, aber wir verdienten genug, um unseren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Außerdem war ich mir sicher, dass unsere Situation nicht von Dauer war, sondern dass wir bald nach Metz zurückkehren und unser normales Leben wiederaufnehmen würden.
Eines Nachmittags verließen Cécile und ich wie üblich das Haus, als meine Schwester die Ladenschlüssel aus ihrer Tasche fischte und sagte: »Marthe, geh schon mal vor und schließ den Laden auf. Ich will nur schnell bei Madame Guillaume vorbeischauen und die Miete bezahlen. Das dauert keine zehn Minuten.«
Ich nahm die Schlüssel, winkte ihr zum Abschied und machte mich auf den Weg. Es war ein sonniger, klarer Tag. Ich beobachtete, wie die Wolken über den tiefblauen Himmel zogen, und lauschte den Vögeln, die ihre Frühlingsserenaden sangen. Als ich die Stufen zur Fußgängerbrücke hochstieg, die über die Gleise führte, warf ich einen Blick nach unten. Das Bahnhofsgelände war voller Menschen. Ein Versorgungszug war eingetroffen und überall wimmelte es von Soldaten. Tausende Flüchtlinge standen auf den Bahnsteigen und warteten auf Züge, die sie weiter nach Süden bringen sollten. Heute waren es besonders viele, da auch unzählige Holländer und Belgier vor den deutschen Invasoren geflohen waren.
Ich schaute auf meine Armbanduhr und sah, dass es schon Viertel vor zwei war. Wenn ich nicht zu spät kommen wollte, musste ich mich beeilen. In der Rue Boncennes, einer Straße unweit unseres Geschäfts, hörte ich plötzlich das Dröhnen von Flugzeugen. Daran war nichts Ungewöhnliches. Aber aus irgendeinem Grund blieb ich stehen und sah zum Himmel hinauf. Wegen der grellen Nachmittagssonne musste ich die Augen zusammenkneifen. Es waren zwei Flugzeuge, die ungewöhnlich tief flogen und direkt auf die Bahngleise zuhielten. Als sie näher kamen, konnte ich sogar die Piloten erkennen. Unter jedem Cockpit hob sich die italienische Flagge deutlich ab.
Ein feindlicher Luftangriff.
Mein Magen krampfte sich zusammen, aber ich sagte mir, dass meine Angst völlig unbegründet sei. Bestimmt hatten sie es auf eine andere Stadt abgesehen. Hier in Poitiers gab es keine lohnenswerten Ziele. Ich suchte nicht einmal irgendwo Schutz. Aber als die erste Bombe abgeworfen wurde und kurz darauf von einem der Häuser an den Gleisen eine Rauchwolke aufstieg, gefror mir das Blut in den Adern. Der Zug. Der Versorgungszug. Der Bahnhof. Die Flüchtlinge. O Gott, Cécile!
Dann war alles voller Lärm und Rauch und Explosionen. Bomben fielen vom Himmel. Der Bahnhof verschwand unter einer Wolke aus beißendem schwarzen Rauch; der Versorgungszug verwandelte sich in einen Feuerball. Menschen schrien und rannten wild durcheinander, um sich irgendwo in Sicherheit zu bringen. Ich sah, wie sich ein Paar mittleren Alters in den Eingang eines nahe gelegenen Hauses flüchtete, und rannte hinterher. Zu zwölft drängten wir uns in den kleinen Hausflur. Zu ängstlich, um das Geschehen mit anzusehen, drückten wir uns an die Wände, die Hände über den Ohren. Ich presste die Ellbogen an die Knie und kauerte mich zusammen. Jede neue Explosion erschütterte den Boden unter uns und jedes Mal erschreckte ich mich zu Tode.
»Sie haben es auf die Eisenbahn abgesehen!«, rief uns ein junger Mann von der Haustür aus zu, während wir schweigend, im Sitzen oder Stehen, abwarteten. Nach einer scheinbaren Ewigkeit wurden die Abstände zwischen den einzelnen Detonationen größer und das Dröhnen der Flugzeuge schwächer. Ein letzter, ohrenbetäubender Knall, dann herrschte Stille. Offenbar hatten die italienischen Soldaten ihren Auftrag erfüllt und flogen mit leeren Bombenkammern wieder in Richtung Osten davon.
Wir traten zögernd und blinzelnd ins Freie, voller Angst vor dem, was uns erwarten würde. Überall war Rauch und Staub und wir hatten Mühe, etwas zu sehen. Als ich zitternd dastand, galt mein erster und einziger Gedanke meiner Mutter. Ich dachte weder an die verletzten Flüchtlinge und Soldaten noch an Cécile, sondern wollte nur so schnell wie möglich nach Hause, um Maman zu sagen, dass mir nichts passiert war. Ich ging ein paar Schritte und fing dann an zu laufen. Ich steuerte auf die kleine Fußgängerbrücke zu, über die ich erst Minuten zuvor gekommen war. Rauch und Flammen hüllten den Zug darunter ein. Die Luft war so dick, dass ich kaum die andere Seite erkennen konnte.
Die Menschen um mich herum standen unter Schock. Ich war die Einzige, die nicht wie gelähmt war. Mit der Hand vor dem Mund und tränenden Augen entschloss ich mich, rasch die Brücke zu überqueren. Aber kaum hatte ich einen Schritt getan, sah ich, wie ein Eisenbahnarbeiter auf der anderen Seite wild mit den Armen fuchtelte und mir zurief, dass ich stehen bleiben solle.
»Arrêtez! Arrêtez! Bleiben Sie, wo Sie sind!« Aber ich musste unbedingt nach Hause. Ich konnte an nichts anderes denken. Hustend rannte ich durch die Flammen und den dicken schwarzen Rauch und verlor beinah das Gleichgewicht, als unter mir ein weiterer Teil des Zugs explodierte. Ich hielt mich kurz am Geländer fest und rannte dann weiter. Am anderen Ende angekommen, packte mich der Eisenbahner und riss mich zur Seite.
»Sind Sie denn vollkommen verrückt geworden?«, schrie er und starrte mich wütend an. »Haben Sie denn nicht die Gefahr erkannt? Das war ein Munitionszug. Der ist hoch explosiv. Das ganze Ding hätte direkt unter Ihren Füßen in die Luft gehen können!«
Ich befreite mich aus seinem Griff und erklärte, dass ich dringend nach Hause müsse.
Ich drängte mich an ihm vorbei und setzte meinen Weg fort. Ich brauchte zwanzig Minuten, um mich durch die Scharen von Menschen zu kämpfen, die mir entgegenkamen und sehen wollten, was passiert war und wie sie helfen konnten. Als ich endlich unser Haus erreichte, kam mir Maman mit ausgestreckten Armen durch den kleinen Vorgarten entgegengelaufen. Sie war in Tränen aufgelöst. Sie hatte schon zu viele Bombardierungen miterlebt.
»Marthe! Marthe!«, schluchzte sie. Mein Gesicht war rußgeschwärzt, meine Haare zerzaust, aber sie war froh, dass ich zu Hause und in Sicherheit war.
»Mir geht’s gut, Maman, mach dir keine Sorgen«, sagte ich und strich ihr beruhigend über den Rücken. Über ihre Schulter hinweg sah ich meinen Vater und den kleinen Jacquie, beide waren sichtlich erleichtert, dass ich wohlbehalten zurück war.
»Tante, Tante«, rief Jacquie. »Ich hab dir doch gesagt, dass ihnen nichts passiert.«
Meine Mutter schob mich ein Stück von sich und sah mich erschrocken an. »Aber wo ist Cécile?«
Ich wurde blass, denn mir wurde bewusst, dass ich überhaupt nicht mehr an meine Schwester gedacht hatte. Schnell erwiderte ich: »Ihr geht’s gut. Sie wollte direkt zum Laden gehen, um nachzusehen, ob alles in Ordnung ist.«
»Gott sei gedankt!« Meine Mutter stieß einen Seufzer aus und knetete ihre Schürze, die vom Backen ganz mehlig war. Da Hélène und Rosy in der Schule auf der anderen Seite der Stadt waren, musste sie sich um sie zum Glück keine Gedanken machen.
Sie lief auf meinen Vater zu und rief: »Fischel, was ein Segen! Unsere Kinder sind in Sicherheit.«
Sobald es ging, verdrückte ich mich und eilte mit einem dicken Kloß im Hals den Hügel hinunter. Im Tal wimmelte es inzwischen von Helfern, die auf die Gleise kletterten, um sich um die Verletzten zu kümmern. Es sah aus wie auf einem Schlachtfeld. Hunderte von Menschen waren ums Leben gekommen. Frauen und Kinder lagen auf dem Bahndamm, blutüberströmt, mit ihren Lieben im Arm. Der Zug war vollkommen zerstört, aber das Feuer war jetzt unter Kontrolle. Auf der Suche nach Cécile sah ich in jedes einzelne Gesicht und betete, dass sie überlebt hatte. Madame Guillaumes Häuschen war unbeschädigt. Ihre Nachbarn hatten weniger Glück gehabt.
Nachdem ich meine Schwester im Tal nicht finden konnte, rannte ich den Hügel wieder hinauf zum Laden. Vielleicht war sie ja dort, überlegte ich, vielleicht hatte sie gehofft, mich wohlbehalten hinter der Theke anzutreffen. Aber dort war auch keine Spur von ihr. Ich stand etwas unschlüssig herum und fragte mich, wie ich meiner Mutter beibringen sollte, dass ich Cécile nicht gefunden hatte.
Ich hörte sie, bevor ich sie sah – ein leises Keuchen ein paar Schritte hinter mir. Ich fuhr herum und stand einer bleichen, verweinten Cécile gegenüber. »Marthe«, flüsterte sie, als ich in ihre ausgebreiteten Arme stürzte. Sie war unverletzt, hatte die Bombardierung im Schutz der Bäume in Madame Guillaumes Garten überlebt. Aber sie hatte große Angst um mich gehabt, und war, nachdem die Flugzeuge verschwunden waren, über die Gleise gerannt und hatte überall nach mir gesucht. Da sie mich nicht unter den Verletzten fand, klapperte sie sämtliche Krankenhäuser der Stadt ab, die Verwundete aufgenommen hatten. Nachdem ihre Suche erfolglos geblieben war, beschloss sie, es ein letztes Mal beim Laden zu versuchen, bevor sie den Heimweg antrat, um unseren Eltern die schlimme Nachricht zu überbringen.
Weinend vor Erleichterung gingen wir Arm in Arm nach Hause, fassungslos über unser Glück, noch einmal davongekommen zu sein. Obwohl unser Leben durch die Auswirkungen des Kriegs auf den Kopf gestellt worden war, hatten wir ihn bisher nie am eigenen Leib erlebt. Nie mehr würde ich mir die Radioberichte über Luftangriffe in Europa anhören, ohne daran zu denken, was ich heute durchlitten hatte. Mit gerade mal 20 Jahren begriff ich, dass sich unser Leben unwiderruflich verändert hatte. Es gab keine Gewissheiten mehr.
Wir waren bestürzt, als Onkel Léon ankündigte, dass er mit seiner Frau und seiner Tochter nach Toulouse ziehen wolle. Großmutter entschloss sich, ihren Sohn und seine Familie zu begleiten. »Hier wird es zu gefährlich«, warnte Léon meine Mutter. »Ihr solltet auch weggehen, bevor es zu spät ist.«
Maman schüttelte den Kopf. »Wir sind zu viele, um wieder ganz von vorn anzufangen. Einmal reicht. Ich werde meinen Kindern das nicht wieder zumuten. Es wird schon alles gutgehen.« Und so verabschiedeten wir uns unter Tränen und mit Küssen von unserer Großmutter und wünschten allen viel Glück.
»Bis bald«, sagte Léon betont munter und küsste meine Mutter auf beide Wangen.
»Vielleicht«, erwiderte sie leise.
Sie fuhren noch am selben Abend in Onkel Léons Auto los und schlossen sich Tausenden von Flüchtlingen an, die vor der immer weiter vorrückenden deutschen Armee in Richtung Süden flohen. Aber meine Großmutter und ihre Schwiegertochter Claire verstanden sich nicht und nach kaum zwei Wochen musste Cécile unsere Großmutter wieder abholen. Cécile blieb eine Woche bei Onkel Léon und seiner Familie in Toulouse, lernte deren neue Freunde kennen und genoss den Tapetenwechsel. Als sie mit unserer Großmutter zurückkam, wirkte sie irgendwie beschwingt.
Einen Monat später, im Juni 1940, besetzten die Deutschen Frankreich. Die Maginot-Linie fiel und wir erhielten die Nachricht, dass Fred gefangen genommen worden war. Von Arnold hörten wir nichts; wir wussten nur, dass er in Tunesien stationiert war. Am 14. Juni erfuhren wir, dass die Wehrmacht Paris eingenommen hatte und die Champs-Élysées entlang marschierte. Ganz Frankreich stand unter Schock. Ich kochte vor Wut. Wenn ich mir vorstellte, dass jetzt die deutsche Hakenkreuzfahne vom Eiffelturm wehte, hätte ich platzen können. Meine Brüder hatten recht gehabt: Mit Hitler konnte man nicht verhandeln. Und jetzt versuchte Marschall Pétain einen Waffenstillstand mit ihm auszuhandeln. Ich war angewidert und fühlte mich betrogen.
»Ich weiß nicht, was mit der Welt los ist«, klagte meine Mutter und schüttelte bekümmert den Kopf. Zum ersten Mal sah man ihr jedes ihrer 48 Jahre an.
Die Stimmung meines Vaters hatte sich auch nach unserem Umzug in den Süden nicht gebessert und er und ich kreuzten immer noch regelmäßig die Klingen. Nur selten ließ er sich seine Besorgnis um unsere Familie anmerken, aber seine Laune wurde von Tag zu Tag schlechter.
»Warum musst du deinen Vater nur immer so provozieren?«, rügte mich meine Mutter. »Es macht die Sache nicht leichter, wenn ihr euch gegenseitig an die Kehle geht.«
Aber im Gegensatz zu meinen Schwestern, die ein gutes Verhältnis zu ihm hatten, reagierte ich nur allergisch auf ihn. Alles, angefangen bei der Art, wie er manchmal mit unserer Mutter sprach, bis zu seiner Schroffheit gegenüber Jacquie, brachte mich auf. Vor allem Jacquies Erziehung war ein Thema, bei dem wir regelmäßig aneinandergerieten. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, dass dieser arme kleine Junge ständig zurechtgewiesen wurde.
»Lass endlich Jacquie zufrieden! Meinst du nicht, dass er schon genug mitgemacht hat?«, wetterte ich immer wieder.
»Ich rede mit ihm und mit jedem anderen in diesem Haushalt, wie es mir passt«, erwiderte Papa scharf. »Ich wäre dir dankbar, wenn du mir in Zukunft keine Vorschriften mehr machen würdest. Jetzt geh auf dein Zimmer.«
Wochen und Monate vergingen, ohne dass wir ein freundliches Wort miteinander wechselten. Ich vermied es, mit ihm zu sprechen, und er redete nur über Maman mit mir, wie beispielsweise beim Essen: »Sag Marthe, dass sie die Kartoffeln rüberreichen soll.« Wir waren beide stur wie Esel.
Als sich unser Haus mit Uhren und Lampen füllte, die von meinem Vater bei Versteigerungen zum Mindestpreis erworben, repariert und restauriert, aber selten verkauft wurden, nervte mich das unablässige Ticken zunehmend. Außerdem wurde ich jede Nacht stündlich von ihrem Schlagen geweckt. Ich schämte mich für sein gebrochenes Französisch, seine derbe Sprache und seine mangelnde Bildung, und seine Launenhaftigkeit brachte mich zur Verzweiflung. Erst viele Jahre später begriff ich, wie schwer es für ihn in einer fremden Stadt, noch dazu in ständiger Sorge um uns, gewesen sein muss. Während uns die außergewöhnlichen Umstände zusammengeschweißt hatten, blieb er ein Außenseiter.
Als die Deutschen im Juli 1940 in Poitiers einmarschierten, waren wir ein besiegtes Volk. In dem fragwürdigen Abkommen, das der servile Pétain mit den Deutschen geschlossen hatte, war unser Land in eine besetzte und eine unbesetzte Zone, die sogenannte Zone libre, aufgeteilt und der Regierungssitz nach Vichy verlegt worden. Aufgrund einer Laune der Geografie lag Poitiers in der besetzten Zone. Die Grenze zwischen Freiheit und Besatzung verlief weniger als vierzig Kilometer südlich von uns, dennoch dachte keiner von uns daran, sie zu überqueren. Wozu auch? Wohin sollten wir gehen? Wir waren bereits einmal umgezogen und es hatte uns viel Mühe gekostet, wieder Fuß zu fassen. In dem Jahr seit unserer Ankunft in Poitiers hatten wir ein neues Geschäft eröffnet, ein neues Zuhause gefunden und Freundschaften geschlossen. Niemand wusste, ob die Grenze – oder Ligne de démarcation – nach unserem Umzug nicht weiter nach Süden verlegt würde, und dann wäre alles umsonst gewesen. Pétain versprach seinem Volk, dass sich das Leben unter deutscher Besatzung nicht wesentlich verändern würde, und die meisten Menschen vertrauten und glaubten ihm.
Etwa um diese Zeit verschwand unser guter Freund Heinrich plötzlich aus unserem Leben, als hätte es ihn nie gegeben. Nonain erzählte uns, dass Heinrich sofort seine Sachen gepackt habe und geflüchtet sei, als er gehört hatte, dass sich die Deutschen Poitiers näherten.
»Er hat gesagt, dass die Nazis ihn erschießen würden, wenn sie ihn in die Hände bekämen«, erklärte Nonain. »Armer Kerl, ich hoffe, es geht ihm gut.« Ich war traurig, dass ich keine Gelegenheit gehabt hatte, mich von dem gut aussehenden Deutschen zu verabschieden. Ich fragte mich, ob wir ihn je wiedersehen würden.
In derselben Woche sah ich zum ersten Mal einen Nationalsozialisten. Cécile und ich waren gerade auf dem Weg nach Hause zum Mittagessen, als er auf einer khakifarbenen BMW mit aufheulendem Motor um die Ecke geschossen kam. Wir blieben stehen und starrten ihn an.
Ich kniff Cécile in den Arm und flüsterte ihr zu: »Hoffentlich bricht er sich das Genick.« Zu meinem Erstaunen kam in diesem Moment das Motorrad auf dem heißen Asphalt ins Schleudern und er landete mit einem dumpfen Schlag auf dem Boden. Cécile war sichtlich beeindruckt, aber dummerweise hatte er sich kaum etwas getan.
Zunächst änderte sich wirklich nicht viel in Poitiers, außer dass wir überall auf deutsche Soldaten stießen und aufpassen mussten, was wir sagten. Im direkten Umgang mit uns überschlugen sie sich vor Höflichkeit, als hätten sie den strikten Befehl erhalten, uns auf keinen Fall zu beleidigen. Sie wollten, dass die Franzosen sie mochten und ihnen vertrauten, und benahmen sich in Frankreich besser als anderswo. Natürlich vertrauten wir ihnen kein bisschen und warteten nur darauf, dass sie ihr wahres Gesicht zeigten. Tatsächlich änderte sich die Stimmung peu à peu. Pétain schlug sich auf die Seite der Deutschen, die London bombardierten und die Kanalinseln besetzten. Er warf seinen Gegnern, darunter der ehemalige Premierminister Léon Blum, vor, für die Niederlage Frankreichs verantwortlich zu sein. General de Gaulle, der von London aus die »Freien Franzosen« in aller Welt zum Widerstand aufgerufen hatte und zum Symbol für die Befreiung geworden war, wurde in Abwesenheit zum Tode verurteilt.
Fast unmerklich schlichen sich die Veränderungen in unseren Alltag ein. Als Erstes wurde im September 1940 eine Meldepflicht für Juden eingeführt. Die Vorstände aller jüdischen Haushalte mussten im Rathaus erscheinen und die Namen und Geburtstage sämtlicher Familienmitglieder angeben. Wer dieser Aufforderung nicht nachkam, wurde zu einer Gefängnisstrafe oder gar zum Tode verurteilt. Mein gesetzestreuer Vater ging brav am 3. Oktober 1940, dem für den Buchstaben H vorgegebenen Datum, aufs Amt. Ohne zu zögern, ließ er – wie die meisten jüdischen Väter in Frankreich – jedes Mitglied unseres Haushalts registrieren, ohne zu ahnen, welche fatalen Folgen dies haben würde. Unsere neuen Ausweise wurden mit einem roten JUIF- oder JUIVE-Stempel versehen. An alle Franzosen wurden Lebensmittelkarten, sogenannte Cartes de rationnement, ausgegeben.
Das Klima zwischen den deutschen und den französischen Juden wurde immer angespannter. Meine Mutter wurde zunehmend bedrückter und ließ sich durch nichts aufheitern. Sie hatte jede Hoffnung aufgegeben. Leider lag sie richtig mit ihren düsteren Vorahnungen. Im selben Monat ordnete die Vichy-Regierung an, dass sich alle jüdischen Geschäfts- und Firmeninhaber registrieren lassen mussten. Jüdische Geschäfte und Büros trugen jetzt Schilder mit der Aufschrift MAISON JUIVE. Elby bildete keine Ausnahme. Als wir eines Morgens zu unserem Laden kamen, war die Tür mit Schildern bepflastert, die jeden wissen ließen, dass wir Juden waren. Unseren treuen Kunden war das allerdings egal.
Im selben Monat tauchte völlig unerwartet unser Bruder Arnold auf. Nachdem man alle jüdischen Soldaten aus der französischen Armee entlassen hatte, war er mit dem Schiff nach Frankreich zurückgekehrt. Wir waren überglücklich, dass er wieder bei uns war, und dankbar für seine Unterstützung, denn schon bald übernahm er bei Elby Onkel Léons Aufgaben.
Es dauert nicht lange, bis Juden von allen öffentlichen Ämtern und von Lehrtätigkeiten ausgeschlossen wurden. Jüdisches Eigentum wurde beschlagnahmt und ausländische Juden wurden verhaftet und interniert. Die Deutschen schränkten uns immer mehr ein und bauten darauf, dass wir uns klaglos in unser Schicksal fügten. Jeden Tag wurden neue Verordnungen erlassen; so wurden unter den »Arisierungsgesetzen« jüdische Geschäfte geschlossen. Verstöße gegen die neuen Bestimmungen konnten mit dem Tod bestraft werden. Zwar waren nichtjüdische Franzosen ebenfalls von Einschränkungen betroffen, aber nicht im selben Maß wie wir.
Eines Tages kamen zwei deutsche Soldaten in unseren Laden. Cécile und ich bedienten gerade einen Kunden. Die Männer sahen sich interessiert um, befingerten die Waren und schienen ihren Wert abzuschätzen. Nicht ahnend, dass wir beide Deutsch sprachen, sagte der eine zum anderen: »Stehlen wir doch einfach das Zeug von diesen dreckigen Juden. Bringt uns bestimmt ein hübsches Sümmchen ein.«
Aufgebracht ließ ich den Kunden stehen und rannte auf die Straße. Ich schaute mich um und entdeckte, wonach ich suchte – einen Offizier der Wehrmacht.
»Entschuldigen Sie, Monsieur«, sagte ich zu dem Wehrmachtsoffizier, »zwei Ihrer Männer sind in unserem Laden. Dazu haben sie nach den neuen Vichy-Gesetzen kein Recht. Wir könnten Ärger bekommen. Bitte sorgen Sie dafür, dass sie gehen.« Er tat, worum ich ihn gebeten hatte, und erteilte in Gegenwart von Cécile und mir den beiden einen scharfen Verweis.
Kurz danach bekamen wir Besuch von einem Franzosen, der uns darüber informierte, dass er von den Deutschen als Gérant commissaire eingesetzt worden war, ein Nichtjude, der unser Geschäft übernehmen sollte. Daraufhin räumten wir den Laden komplett aus, packten die kostbarsten Waren in Koffer und trugen sie nach oben in die Wohnung von Madame Le Touchais, mit der wir uns angefreundet hatten. Wenige Tage später brachten wir sie zu Madame Blondet, der früheren Putzfrau von einem unserer Cousins, der wir vertrauen konnten.
»Wir lassen nichts für die Nazis zurück«, stieß Cécile hervor. »Nicht das Geringste.« Lächelnd tätschelte ich ihre Schulter.
Als ich eines Nachmittags mit einem besonders schweren Koffer auf dem Weg zu Madame Blondet war, kamen mir an der Kirche Notre-Dame la Grande zwei deutsche Soldaten entgegen. Ich senkte den Blick und starrte auf ihre blanken Stiefel. Bevor ich einen Ton herausbrachte, ergriff einer der beiden den Koffer.
»Lassen Sie mich Ihnen behilflich sein, Fräulein«, sagte er lächelnd. »Der ist doch viel zu schwer für ein so hübsches junges Mädchen.«
Mühelos trug er den Koffer, während ich neben ihm herlief. In sicherer Entfernung von Madame Blondets Wohnung nahm ich ihn ihm wieder ab und bedankte mich mit meinem schönsten Lächeln.
Ich malte mir aus, wie der Commissaire in ein paar Tagen kommen würde, um unser Geschäft zu übernehmen, und einen gähnend leeren Laden vorfände. Zu gern hätte ich Mäuschen gespielt.
Cécile und ich waren jetzt arbeitslos; wie sollten wir unsere Familie ernähren? Ich wollte mir in Poitiers Arbeit suchen, während Cécile vorhatte, in Paris mit einem Teil unserer Waren einen neuen Laden zu eröffnen. Paris kam mir entsetzlich weit weg vor. Außerdem war es mit Sicherheit gefährlicher als unser verschlafenes Städtchen. Aber wir hatten Verwandte in der Hauptstadt, darunter Onkel Max, der jüngste Bruder meiner Mutter, der dort als Arzt praktizierte, und Cécile war fest entschlossen, in Paris ihr Glück zu versuchen und uns von dort Geld zu schicken.
»Mach dir um mich keine Gedanken«, sagte sie und umarmte mich. »Pass gut auf die anderen auf, du bist jetzt die Älteste.« Und ehe wir uns versahen, hatte sie gepackt und war fortgegangen. Ich vermisste sie schrecklich.
Aber wie heißt es so schön: Immer wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Im Dezember 1940 kam Fred nach Hause. Wir waren überglücklich, ihn zu sehen, aber entsetzt über seine körperliche Verfassung. Wir gaben ihm etwas zu essen und lauschten mit offenem Mund seinen Schilderungen. Nachdem die Deutschen die Maginot-Linie durchbrochen hatten, war er gefangen genommen und in ein Lager in Straßburg gebracht worden. Danach hatten wir nichts mehr von ihm gehört. Als er zufällig ein Gespräch zwischen zwei deutschen Wachen belauschte, erfuhr er, dass alle Gefangenen am nächsten Tag nach Deutschland überführt werden sollten. Sofort setzte er seinen sorgfältig ausgetüftelten Fluchtplan in die Tat um, zog die zivilen Sachen an, die er an einem sicheren Ort versteckt hatte, und schaffte es, mitten im tiefsten Winter die Vogesen zu Fuß zu überqueren, indem er nur nachts unterwegs war. In Nancy kontaktierte er seine alten Kunden und verkaufte auf einen Schlag das gesamte Inventar seiner Schneiderei. Den Erlös nähte er in seine Kleidung ein. Dieses Geld half uns über die ganzen Kriegsjahre hinweg. Fred ist es zu verdanken, dass wir überlebten.
Beim Abendessen am Tag von Freds Rückkehr hatten wir einen Gast, Rosette Korn, ein hübsches, junges Mädchen und eine neue Freundin der Familie. Ich kannte sie flüchtig aus Metz. Als die meisten jüdischen Familien aus der Stadt geflohen waren, waren sie und ihr Vater Kalman, ein Barbier, zurückgeblieben, während man ihre kranke Mutter zusammen mit anderen Patienten aus dem jüdischen Pflegeheim nach Poitiers evakuiert hatte.
»Liebe Marthe, könntest du mir einen Gefallen tun? Würdest du vielleicht mal meine Mutter besuchen?«, hatte Rosette mich im ersten ihrer zahlreichen Briefe gebeten. »Sie ist krank und weit weg von zu Hause. Deine Gesellschaft würde ihr bestimmt guttun.«
Als Rosette und ihr Vater im Juni 1940 zu uns stießen, hatte uns unsere Brieffreundschaft zusammengeschweißt. Rosette fand schon bald eine Stelle als Dolmetscherin im Rathaus.
Von dem Moment an, als Fred und sie sich an jenem Abend begegneten, wussten wir alle, dass sie füreinander bestimmt waren. Aber wir wussten auch, dass Fred auf keinen Fall im besetzten Frankreich bleiben konnte. Als geflohener Kriegsgefangener und Jude war er doppelt gefährdet. Entschlossen, sich de Gaulles Freien Franzosen anzuschließen, machten er und unser Cousin Oskar Kluger sich auf den Weg, um die Grenze zur Zone libre zu überqueren. Er versprach uns, in Kontakt zu bleiben.
Die Sicherheitsvorkehrungen an der Demarkationslinie waren in den vorangegangenen Wochen extrem verschärft worden und die deutschen Patrouillen waren besonders misstrauisch gegenüber jungen Männern, die möglicherweise der Résistance angehörten. Frauen hatten es leichter, ins unbesetzte Frankreich zu gelangen. Noch am selben Nachmittag, drei Stunden, nachdem Fred und Oskar uns verlassen hatten, klopfte es an die Tür. Mein Vater öffnete und stand einem fremden Mann mittleren Alters gegenüber.
»Ich bin Monsieur Noël Degout«, stellte sich dieser vor. »Ich habe einen Bauernhof in Dienné und wollte Ihnen mitteilen, dass Ihr Sohn heute Nachmittag, als er die Grenze überqueren wollte, verhaftet wurde.«
Meine Mutter schlug die Hand vor den Mund. Dann fragte sie, was passiert sei.
»Er und sein Cousin haben gerade mein Land überquert, als die Deutschen sie entdeckten. Sie haben sie zur Befragung in meine Scheune gebracht. Ich treffe diese deutschen Soldaten regelmäßig, sie kennen mich. Ich habe sie gefragt, ob ich mit den beiden jungen Männern reden dürfte. Sie haben mir ihre Namen und Adressen genannt und mich gebeten, Sie zu informieren. Deshalb bin ich hier. Man hat sie ins Pierre-Levée-Gefängnis nach Poitiers gebracht. Das ist alles, was ich weiß.«
Meine Mutter war außer sich vor Sorge. Sie war davon überzeugt, dass Fred zurück ins Kriegsgefangenenlager geschickt oder vielleicht sogar erschossen werden würde, falls jemand Verdacht schöpfte. Sobald wir konnten, besuchten wir ihn und waren erleichtert, beide bei guter Gesundheit und in bester Stimmung anzutreffen.
»Mach dir doch nicht so viele Gedanken, Maman«, schalt Fred unsere Mutter, die mit den Tränen kämpfte. »Glaub mir, alles wird gut.«
Zum Glück waren die Besatzer im verschlafenen Poitiers nicht ganz so gründlich wie ihre Kollegen in der Heimat, sodass nichts über Freds Kriegsgefangenschaft bekannt wurde. Sie kamen auch nicht dahinter, dass Oskar ein deutscher Jude war. Wegen ihres Fluchtversuchs wurden er und Oskar zu einem Monat Haft im städtischen Gefängnis verurteilt. Da das Gefängnis unter französischer Leitung stand, durften wir ihn täglich besuchen.
Während Freds Inhaftierung wurde Hélène ernsthaft krank. Sie war gestürzt, hatte sich am Knie verletzt und musste operiert werden. Ihr Knie entzündete sich und schwoll zu doppelter Größe an. Dann bekam sie eine Bauchfellentzündung, vermutlich die Folge einer Blinddarmentzündung, und die Ärzte meinten, wir könnten nur noch beten. Am Tag seiner Entlassung ging Fred direkt ins Krankenhaus, setzte sich zu ihr ans Bett und rührte sich vierundzwanzig Stunden lang nicht von der Stelle. Er hielt ihre Hand und versuchte, ihr neuen Lebensmut zu geben.
»Ich will sterben«, sagte sie schwach. »Die Schmerzen sind unerträglich.«
»Du darfst nicht sterben«, beschwor er sie. »Du bist doch erst siebzehn. Du hast noch dein ganzes Leben vor dir. Du musst leben!« Hélène überlebte, weil Fred beharrlich blieb.
Sobald sie außer Lebensgefahr war, versuchte Fred erneut, mit Oskar zusammen die Grenze zu überqueren. Monsieur Degout hatte versprochen, ihnen zu helfen. Glücklicherweise gelang es ihnen diesmal, sicher nach Saint-Étienne, in der Nähe von Lyon, zu gelangen, wo die verliebte Rosette zu ihnen stieß. Bald darauf heirateten sie und Fred.
Ich bewarb mich im Rathaus auf Rosettes Stelle als Dolmetscherin und wurde angenommen. Da ich einen deutschen Nachnamen hatte, blond und blauäugig war, hielten mich die meisten Deutschen für eine von ihnen. Mein französischer Chef wusste, dass ich Jüdin war, aber das störte ihn nicht. Die Abteilung, in der ich arbeitete, war erst vor Kurzem auf Anordnung der Deutschen eingerichtet worden. Es war das Bureau de réquisition, das den Besatzern die systematische Ausplünderung der Franzosen erleichtern sollte. Die Arbeit war nicht besonders angenehm, aber in Ermangelung von Alternativen nahm ich sie dankbar an.
Wenn ein habgieriger Deutscher ein Auto, ein Haus oder irgendwelche Möbel in seinen Besitz bringen wollte, war es meine Aufgabe, sein »Gesuch« dem zuständigen Sachbearbeiter ins Französische zu übersetzen, der daraufhin im Namen des Dritten Reiches den erforderlichen Requirierungsschein ausstellte. Es war eine Herausforderung, täglich mit dem Feind zu tun zu haben, aber ich stellte mich ihr und war engagierter, als ich es je in der Schule oder in unserem Laden gewesen war.
Mein französischer Chef war Monsieur Grelet, ein freundlicher Mann, der mich sehr mochte. Seine drei Dolmetscherinnen waren alles Jüdinnen aus Metz, da in Poitiers sonst niemand Deutsch sprach. Wenn Monsieur Grelet mit rassistischen Deutschen zu tun hatte, bevorzugte er mich, weil ich am wenigsten jüdisch aussah. Der deutsche Leiter der Kommandantur war Hauptmann Allemann, im bürgerlichen Leben protestantischer Pfarrer. Er nannte mich mon Sourire wegen meiner Grübchen und meines spitzbübischen Lächelns. Allemann konnte sehr streng sein, aber mich schien er zu mögen, obwohl ich ihm des Öfteren Kontra gab.
»Gehen Sie nach Berlin. Da können Sie in einem der Ministerien Karriere machen, Marthe«, sagte er. »Die können jemanden wie Sie gut gebrauchen.«
Ich schüttelte den Kopf und erklärte ihm, das sei unmöglich.
»Warum?«, fragte er, erstaunt darüber, dass ich diese einmalige Gelegenheit ablehnte.
»Weil ich Französin bin«, erwiderte ich.
Er lachte schallend. »Seien Sie nicht albern. Sie sind eine richtige Arierin.«
Mit meinem verschmitzten Grübchenlächeln erwiderte ich: »Nein, Herr Hauptmann, ich bin eine französische Patriotin und ich beabsichtige, hier bei meinen Landsleuten zu bleiben.«
Eines Tages mussten Monsieur Grelet und ich den Hauptmann ins Museum von Poitiers begleiten, das sich im Gewölbekeller des Rathauses befand. Er wollte sich ein Kunstobjekt für sein Büro aussuchen. Er wies den Kurator an, ihm die zur Verfügung stehenden Objekte zu zeigen, suchte sich daraufhin mehrere Gemälde aus und bat mich, für ihn zu dolmetschen.
Ich sah ihn missbilligend an und schüttelte den Kopf. »Schämen Sie sich denn nicht?«, fragte ich ihn, während Monsieur Grelet – der kein Deutsch sprach, aber genug verstand, um zu wissen, worum es ging – hörbar nach Luft schnappte. »Sie kommen in ein Museum, einen Ort, wo Geschichte und Kunst in Ehren gehalten werden, und bedienen sich einfach. Wer gibt Ihnen das Recht, sich an französischem Eigentum zu vergreifen?«
Einen Moment lang fürchtete ich, Allemann würde mich auf der Stelle erschießen lassen, aber sein Gesicht verzog sich zu einem Lächeln und er nickte langsam.
»Ich mag Sie, mon sourire«, sagte er. »Sie sagen, was Sie denken. Ich wünschte nur, Ihre Landsleute würden das auch tun. Es würde vieles einfacher machen, wenn alle Franzosen so direkt und geradeheraus wären wie Sie.«
Ich erwiderte sein Lächeln, erleichtert, dass ich noch am Leben war. Ich bedankte mich und schlug in gespielter Hochachtung die Hacken zusammen.
Er wandte sich ab und sagte in eiskaltem Ton über seine Schulter hinweg: »Trotzdem gehören diese Bilder jetzt mir. Sagen Sie Monsieur Grelet, dass er sie mir ins Büro schicken lassen soll. Sofort.«