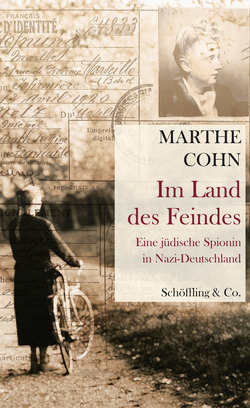Читать книгу Im Land des Feindes - Marthe Cohn - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDie Schlinge zieht sich zu
Am 13. April 1941 feierte ich meinen 21. Geburtstag. Da meine Eltern der Meinung waren, dass wir trotz der außergewöhnlichen Umstände ein möglichst normales Leben führen sollten, erlaubten sie mir, zur Feier meiner Volljährigkeit zwanzig Freunde in unsere neu bezogene Wohnung in der Rue Riffault einzuladen. Wir hatten die beiden unteren Etagen eines eleganten dreistöckigen Hauses gemietet, das von einem weiträumigen Garten umgeben war. Durch die mächtige Eingangstür hätte problemlos eine Pferdekutsche gepasst. Ich hatte eine schlichte Feier geplant, mit Kuchen und Limonade, und später sollte getanzt werden. Damit wir gleich viel Jungen und Mädchen waren, hatte Stéphanie ein paar Kommilitonen eingeladen, darunter auch ihren Freund André Dufour, den alle Dédé nannten. Sie war ganz vernarrt in ihn.
Sie hatten sich an der Universität kennengelernt. Dédé, der aus einem streng katholischen Elternhaus stammte, hatte sich auf den ersten Blick in Stéphanie verliebt, die mit ihren zwanzig Jahren nicht nur eine Schönheit war, sondern auch die Reife und Selbstsicherheit einer erwachsenen Frau ausstrahlte. Sie war schlank und zierlich, hatte glänzendes dunkles Haar und leuchtende braune Augen. Sie war zurückhaltend, willensstark und schien sich vor nichts zu fürchten. Ich war sicher, dass aus ihr einmal eine hervorragende Ärztin werden würde, nicht zuletzt wegen ihres mitfühlenden, freundlichen Wesens. Dédés Familie missbilligte seine Beziehung zu einer Jüdin und versuchte mit allen Mitteln, das Verhältnis zu unterbinden. Dies war auch der Grund, weshalb sie sich nicht offiziell verlobt hatten. Doch für Steph stand fest, dass sie mit Dédé ihr restliches Leben verbringen würde.
»Bitte sie bloß nie, dir was vorzusingen«, scherzte ich Dédé gegenüber, als sich einer meiner Gäste ans Klavier setzte und zu spielen anfing.
Zu Stéphanies engsten Freunden gehörte auch ihr Kommilitone Jacques Delaunay. Er und sein jüngerer Bruder Marc, der Jura studierte, waren im Fernen Osten aufgewachsen. Ihr Vater war ein hoher Zollbeamter in Saigon, ihre Mutter leitete ein Waisenhaus. Beide waren Atheisten. Angesichts der Drohgebärden der Japaner 1939 schickten die Eltern ihre Söhne zurück nach Poitiers.
Als Jacques auf meinem Geburtstagsfest auftauchte, brauchte er offenbar nur einen Blick auf mich zu werfen, um zu wissen, dass wir füreinander bestimmt waren. Und daran sollte sich nichts ändern. Er tanzte den ganzen Nachmittag mit mir, denn er ließ es nicht zu, dass mich ein anderer Junge abklatschte. Jacques war sehr attraktiv; er hatte ausdrucksvolle dunkle Augen und war mindestens 1,80 Meter groß. Selbst mit meinen Stöckelschuhen reichte ich ihm nur bis zur Brust.
Obwohl mir sein Interesse sehr schmeichelte, gab ich mich unbeeindruckt. Ich ließ meinen Blick durchs Zimmer wandern, lächelte in die Runde und unterhielt mich im Vorbeigehen mit den anderen Gästen. Aber Jacques war hartnäckig und wich mir mit seinem spitzbübischen Lächeln nicht von der Seite. Wir tanzten Tango, Foxtrott und Paso Doble.
Auch bei unseren ersten Verabredungen schien er nicht im Geringsten daran zu zweifeln, dass wir ein Paar werden würden. Er fühlte sich mehr zu mir hingezogen als ich mich zu ihm, aber je öfter wir uns trafen, desto mehr Gefallen fand ich an ihm.
Im Sommer waren meine Schwestern und ich regelmäßig bei den Brüdern Giraud, die wir durch das örtliche Jugendherbergswerk kannten. Sie wohnten direkt am Clain, in dem man herrlich baden konnte. An einem wunderbaren Sommernachmittag, an dem jeder Gedanke an den Krieg in der flirrenden Hitze verblasste, ließ ich mich im Fluss treiben, als ein paar Jungen aus unserer Clique zu mir herüberschwammen und mich untertauchten. Ich bekam sofort Wasser in Mund und Nase, aber das machte mir nichts aus. Lachend und prustend kam ich wieder an die Oberfläche. Ich war eine gute Schwimmerin und konnte einen solchen Spaß wegstecken.
Aber Jacques, der uns vom Ufer aus zusah, bekam offenbar einen Riesenschrecken. Ehe ich etwas sagen konnte, sprang er ins Wasser und stieß die anderen Jungs beiseite.
»Lasst gefälligst Marthe in Ruhe!«, schrie er wütend und zog mich an sich. »Sehr ihr nicht, dass sie genug hat?«
Während ich mir das nasse Haar aus dem Gesicht strich, sah ich ihn halb empört, halb fasziniert an. Niemand war je so beherzt für mich eingetreten, nicht einmal Fred. Aus irgendeinem Grund machte mich diese ritterliche Geste überglücklich.
Danach sahen wir uns täglich. Wir unternahmen Spaziergänge oder Radtouren in der Umgebung von Poitiers; wir gingen mit unseren Freunden schwimmen oder paddeln. Und als wir einmal allein im Wald picknickten, machte mir Jacques einen Antrag.
»Sei nicht albern!«, rief ich und rückte unwillkürlich von ihm ab. »Dafür ist es noch viel zu früh. Wir kennen uns doch kaum. Und außerdem gibt’s da ein schwerwiegendes Problem. Du bist kein Jude. Meine Mutter würde mir nie erlauben, einen Nichtjuden zu heiraten.«
»Wenn’s weiter nichts ist. Dann konvertiere ich eben.« Seine dunklen Augen blitzten. »Ich bin kein bisschen religiös. Ich bin nicht mal getauft. Meine Eltern auch nicht. Mein Großvater wurde exkommuniziert. Der Pfarrer sorgte dafür, dass sich sämtliche Mitglieder der Kirchengemeinde von ihm distanzierten. Das hat ihn ruiniert. Daraufhin hat meine Familie mit der katholischen Kirche gebrochen. Ich kann diese Pfaffen mit ihren komischen Soutanen und klobigen Schuhen nicht ernst nehmen. Bitte gib mir eine Chance und hab etwas Geduld. Wenn du mich erst mal besser kennenlernst, wirst du einsehen, dass ich der perfekte Ehemann für dich bin.«
Obwohl ich bei meinem Nein blieb, protestierte ich von da an nicht mehr so vehement, wenn er über seine Pläne für unsere gemeinsame Zukunft sprach.
So sehr ich auch versuchte, jeden Gedanken an den Krieg auszublenden, um mein privates Glück zu genießen, konnte ich nicht die Augen davor verschließen, dass der Druck auf die einheimische Bevölkerung stetig zunahm. Nachdem die Deutschen im Juni 1941 den Hitler-Stalin-Pakt gebrochen und die Sowjetunion überfallen hatten, verschärfte sich das Klima im Land schlagartig. Ich versuchte meine Mutter zu beruhigen: »Versteh doch, die Lage verschlimmert sich nur, weil sie den Krieg gegen die Sowjets verlieren. Es wird bald vorbei sein, glaub mir.« Doch es gelang mir nicht, sie zu überzeugen.
Im gleichen Sommer ließ Marschall Pétain 12.000 Juden wegen »planmäßiger Hintertreibung der französisch-deutschen Kooperation« verhaften. Dann erließen die Deutschen eine Reihe neuer antijüdischer Verordnungen. Langsam zog sich die Schlinge zu. Fast täglich folgten weitere Vorschriften, die strikt befolgt werden mussten. Nicht genug, dass sie Häuserwände und Bäume mit Anschlägen zupflasterten, jetzt wurde uns auch noch die Benutzung von Radios, Schreibmaschinen und Telefonen verboten, weshalb wir die Geräte im Büro unseres Vaters versteckten. Wir durften erst nach 16.30 Uhr ein Geschäft betreten, was zur Folge hatte, dass wir beim Einkaufen praktisch vor leeren Regalen standen. Glücklicherweise gab es nette Ladenbesitzer, die etwas für uns zur Seite legten, obwohl sie sich damit in große Gefahr brachten. Es war uns untersagt, öffentliche Orte wie Restaurants, Cafés, Bibliotheken, Markt- oder Sportplätze aufzusuchen. Wir durften weder Straßenbahn fahren noch ein Kino betreten. Selbst in Gärten und Parks durften wir uns nicht aufhalten. Diese ganzen Einschränkungen empörten mich zutiefst.
Als Hauptmann Allemann mir wieder einmal eine Arbeitsstelle in Berlin schmackhaft zu machen versuchte, war ich die Farce endgültig leid.
»Ich kann nicht nach Berlin gehen«, erklärte ich mit einem unschuldigen Lächeln. »Ich bin nämlich Jüdin.«
»Das kann nicht sein!«, protestierte er. Sein Mund klappte auf und zu, als wäre er ein Karpfen, der verzweifelt nach Luft schnappt. »Ich rieche einen Juden zehn Meter gegen den Wind.«
»Dann riechen Sie noch mal genau hin«, erwiderte ich seelenruhig. Der Abscheu in seinem Blick entging mir nicht. »Aber jetzt verstehen Sie sicher, weshalb ich nicht nach Berlin gehen kann.«
Der Hauptmann, der eine Tochter in meinem Alter hatte, war immer wie ein Vater zu mir gewesen. Jetzt stellte ich unser gutes Verhältnis auf eine harte Probe.
»Nun ja, vielleicht gab es ja unter Ihren Vorfahren jemanden, der möglicherweise Jude war«, überlegte er laut. Er sah mich fast beschwörend an, als hoffe er auf meine Zustimmung.
»Nein, Herr Hauptmann«, erwiderte ich trotzig. »Ich bin Jüdin. Meine Eltern sind ebenfalls Juden. Ich stamme aus einer sehr alten jüdischen Familie. Mein Großvater war Rabbiner. Ich bin stolz auf meine Herkunft.«
Das Gesicht des Hauptmanns lief dunkelrot an. »Ich kann das einfach nicht glauben!«, rief er. Seine Oberlippe zuckte. »Ich will nichts mehr davon hören. Ich bin sehr enttäuscht von Ihnen.« Dann stapfte er aus dem Zimmer und knallte die Tür hinter sich zu.
Aufgewühlt, aber erhobenen Hauptes, verließ auch ich sein Büro. Es bereitete mir eine große Genugtuung, ihn so aus der Fassung gebracht zu haben.
Ein paar Tage später marschierten die groß gewachsenen deutschen Feldgendarmen in unser Büro. Sie trugen glänzende Metallplaketten an dicken Ketten um den Hals und hatten Gewehre mit aufgepflanzten Bajonetten auf uns gerichtet. »Alle Juden raus! Sie haben eine Stunde!«
Monsieur Grelet sprang von seinem Stuhl auf. »Aber wir können auf diese Mitarbeiter unmöglich verzichten«, sagte er zu dem anwesenden Offizier. Er warf mir einen verzweifelten Blick zu. »Lassen Sie mir wenigstens Mademoiselle Hoffnung. Ich brauche sie.«
Der Offizier schüttelte den Kopf. »Ich habe meine Befehle«, sagte er steif.
Nachdem Monsieur Grelet und meine Kollegen vergeblich versucht hatten, ihn umzustimmen, blieben mir noch dreißig Minuten, um meinen Schreibtisch zu räumen.
Es war ein schwerer Schlag für mich, auf diese Art meine Arbeit zu verlieren. Ich dachte immer, dass mir meine Stelle sicher wäre. Schließlich gab es außer einer Handvoll Juden niemanden in Poitiers, der Deutsch sprach.
Nachdem ich meine Sachen zusammengepackt hatte, nahm ich Hut und Mantel und verließ das Büro. Dann ging ich zur Kommandantur und verlangte, Hauptmann Allemann zu sprechen. Ich wollte diese letzte Chance nutzen, um ihn zur Rede zu stellen. Zu meiner Überraschung wurde ich sofort in sein Büro geführt. Er stand halb von mir abgewandt am Fenster, aber ich konnte sehen, wie sein Unterkiefer mahlte. Zweifellos erwartete er, dass ich ihn anflehen würde, mir meine Arbeit zu lassen. Aber das war ganz und gar nicht meine Absicht.
Ich straffte die Schultern und sagte: »Sie müssen mächtig stolz auf sich sein.«
»Wie bitte?« Er drehte sich um. Seine Augen flackerten unruhig.
»Als deutscher Offizier müssen Sie doch sehr stolz darauf sein, dass dank eines deutschen Befehls drei Menschen ihre Arbeit verloren haben.«
»Ich … ich verstehe nicht, worauf Sie hinauswollen.«
»Oh, ich glaube schon«, erwiderte ich und blickte ihm fest in die Augen. »Wie stehen Sie dazu, dass Ihr Oberkommando eine Anordnung erlässt, die Menschen ihr Recht auf Arbeit verweigert und sie daran hindert, ihren Lebensunterhalt zu verdienen? Sie sind doch Pfarrer. Wie können Sie einen derart unmenschlichen Umgang mit jüdischen Bürgern vor Ihrem Gewissen verantworten? Vor ein paar Tagen haben Sie noch große Stücke auf mich gehalten. Das scheint sich grundlegend geändert zu haben. Denn wie können Sie es sonst zulassen, dass man mich wie eine Aussätzige behandelt, allein wegen meiner jüdischen Herkunft, für die ich nicht das Geringste kann?«
Ich hatte von einem seiner Untergebenen erfahren, dass man ihn bald von seinem Posten abziehen und an die Ostfront versetzen würde. Bevor ich mich zum Gehen wandte, sagte ich: »Ich hoffe, dass Sie in Russland ganz erbärmlich unter Hunger und Kälte leiden, Herr Hauptmann. Dann werden Sie sich vielleicht daran erinnern, was Sie uns Juden angetan haben.«
Als ich hinausgehen wollte, trat er auf mich zu und hielt mich am Arm fest. »Hören Sie, mein Fräulein«, sagte er mit trauriger Miene, »als Mensch kann ich Ihnen nur sagen, dass mir das alles wirklich sehr leidtut, aber als deutscher Offizier bin ich meinem Vaterland zu Loyalität verpflichtet.« Dann streckte er mir vorsichtig die Hand entgegen. »Leben Sie wohl«, sagte er leise.
Ich dachte an seinen angewiderten Blick, als ich ihm eröffnet hatte, dass ich Jüdin bin. Und ich war immer noch empört darüber, dass man mich mit Waffengewalt aus meinem Büro vertrieben und um meine Arbeit gebracht hatte. Deshalb wies ich seine ausgestreckte Hand zurück. Ich drehte mich auf dem Absatz um, ging hinaus und schlug die Tür hinter mir zu. Es war August 1941.
Ich glaube, insgeheim war Jacques froh, dass ich meine Arbeit verloren hatte. Er hatte keinen Hehl daraus gemacht, wie sehr ihm mein täglicher Kontakt mit den Deutschen missfiel.
Aber ich war es bald leid, den ganzen Tag zu Hause bei meinen Eltern herumzusitzen. »Ich hab nicht das Geringste zu tun«, beklagte ich mich bei Jacques. »Keine Arbeit, kein Geld, keine Möglichkeit, meine Familie zu unterstützen. Da könnte ich genauso gut eine Ausbildung machen.«
»Das ist doch eine prima Idee!«, sagte er. »An was hattest du denn gedacht?«
»Ich weiß nicht recht. Krankenpflege vielleicht.«
Jacques’ Miene hellte sich auf. »Aber natürlich! Das wäre doch perfekt! Wenn du Krankenschwester bist und ich Arzt, können wir zusammenarbeiten. Das ist die genialste Idee, die du je hattest, Marthe!« Er beugte sich vor und küsste mich zärtlich auf die Nase.
Von da an lag mir Jacques mit der Schwesternausbildung ständig in den Ohren. Er gab sich genauso wenig mit einem Nein zufrieden wie damals bei unserem Picknick im Wald, als er mir einen Antrag gemacht hatte. Ich hatte Bedenken, weil ich nicht wusste, wovon ich die Schulgebühren bezahlen sollte, jetzt, da ich ja kein eigenes Einkommen mehr hatte. Schließlich schrieb ich Fred einen Brief und fragte ihn um Rat. Seine Antwort lautete: »Mach ruhig die Ausbildung. Ich kümmere mich ums Finanzielle.«
Als ich meine Mutter in meine Plänen einweihte, traute sie ihren Ohren nicht. Ich hatte nie mit Krankheit oder Tod umgehen können. Als ich drei Jahre alt war, starb Mamans jüngerer Bruder Jacques an den Komplikationen einer Blinddarmoperation. Ich erinnerte mich genau an den jungen Mann, der mich immer auf seinen Knien hatte reiten lassen. Auf seiner Beerdigung bekam ich einen hysterischen Anfall, weil ich glaubte, dass sich sein Leichnam in dem großen, mit einem schwarzen Tuch verhüllten Karton für die Besuchskarten befand. Seitdem graute mir vor dem Tod. Was Krankheiten anging, war es auch nicht viel besser. Als Hélène am Knie operiert wurde, rannte ich jedes Mal aus dem Zimmer, wenn die Nonne zum Verbandwechseln hereinkam.
Trotz der Bedenken meiner Mutter meldete ich mich am 6. Oktober 1941 in der Schwesternschule des Roten Kreuzes an. Das Institut, das Mademoiselle Margnat leitete, war der Universitätsklinik angegliedert, die von den Ordensschwestern Les Sœurs de la Sagesse geführt wurde. An meinem ersten Unterrichtstag sollten wir über einen Namen für unseren Jahrgang abstimmen. Bis auf mich und meine Mitschülerin Jeanine Rieckert waren alle für Marschall Pétain. Als wir gegen diese Entscheidung protestierten, waren die anderen Mädchen fassungslos. »Was habt ihr denn gegen den Namen?«, fragte eine. »Pétain ist der Retter Frankreichs.«
»Von wegen!«, rief ich. »Wir sollten uns lieber für General de Gaulle entscheiden. Er ist derjenige, der Frankreich rettet, ihr werdet schon sehen.«
Mademoiselle Margnat rief mich bald darauf in ihr Büro. Sie war eine warmherzige, couragierte Frau, die wusste, dass ich Jüdin war. »Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, Mademoiselle Hoffnung«, sagte sie. »Wir haben hier keine Vorurteile. Die Nationalität oder Religionszugehörigkeit unserer Patienten spielt für uns keine Rolle und das Gleiche gilt auch für unser Krankenhauspersonal.«
Ich war sehr dankbar für ihre Güte, die sie mehr als einmal unter Beweis stellen sollte. Als sich gegen Ende 1941 das Klima weiter verschärfte, tauchte die Gestapo immer häufiger unangekündigt im Krankenhaus auf, um »unerwünschte Personen«, wie es beschönigend hieß, ausfindig zu machen. Jedes Mal marschierte ein ranghoher Offizier in den Flur, zückte ein Blatt Papier und fragte eine Nonne nach den Juden oder Kommunisten, die auf seiner Liste standen.
»Die Namen sagen mir nichts«, sagte die Nonne dann frostig. »Mich interessiert nur das Wohl meiner Patienten.«
Doch die Gestapo-Männer drängten sich einfach an ihr vorbei und stürmten auf die Krankenstationen, um die Namen auf den Krankenblättern zu kontrollieren und alle, die auf ihrer Liste standen, aus ihren Betten zu zerren. Immer wenn die Deutschen kamen, versteckten mich die Nonnen in einem kleinen Büroraum neben der Kapelle. Sie hätten schon wegen weit geringerer Vergehen verhaftet und erschossen werden können.
Eines Tages rief mich Mademoiselle Margnat erneut in ihr Büro. Ich glaubte, dass die Nazis wieder im Anmarsch wären, aber das war nicht der Grund.
»Wir haben einen neuen Patienten, Marthe«, sagte sie. »Ich möchte, dass Sie sich um ihn kümmern. Sie sind die Einzige, die sich für diese Aufgabe eignet.«
»Selbstverständlich, Madame«, erwiderte ich ohne Zögern. »Was fehlt ihm denn?«
Sie seufzte, musterte mich einen Moment lang nachdenklich und antwortete: »Er ist ein deutscher Soldat.«
»Und? Was fehlt ihm?«, fragte ich noch einmal.
Mein Schützling war ein 1,90 Meter großer Wehrmachtssoldat namens Günther. Er hatte sich bei einem Militärtransport eine schlimme Kopfverletzung zugezogen. Als der Zug, der mit deutschen Panzern beladen war, durch eine niedrige Brücke hindurchgefahren war, hatte er versehentlich den Kopf aus der Dachluke seines Panzers gesteckt. Bei seiner Einlieferung war er halb bewusstlos. Ich sollte mich um ihn kümmern, bis er in die neurologische Abteilung eines deutschen Krankenhauses verlegt werden konnte. Da ich die Einzige war, die Deutsch sprach, hatte man mir diese Aufgabe übertragen.
Günther befand sich in einem bedauernswerten Zustand. Er hatte eine schwere Gehirnerschütterung erlitten und war zeitweise geistig verwirrt. Es kam vor, dass er mitten im Schlaf hochschreckte, aus dem Bett sprang und auf den Flur hinaustappte. Im Krankenhemd, das sein nacktes Hinterteil entblößte, marschierte er bis hinaus auf die Straße. Ich lief ihm dann jedes Mal hinterher, nahm ihn behutsam bei der Hand und führte ihn in sein Zimmer zurück. »Kommen Sie, Günther«, sagte ich dann sanft zu ihm. »Wir können Sie doch nicht so auf der Straße herumlaufen lassen.« Und jedes Mal sah er mich mit einem leicht dümmlichen Gesichtsausdruck an und ließ sich widerstandslos von mir zurückbringen. Es muss ein kurioser Anblick gewesen sein, wie ich in meiner weißen Schwesterntracht einen halb nackten Hünen mit verbundenem Kopf an der Hand führte.
Ich versuchte nicht darüber nachzudenken, wer er war und was er womöglich getan hatte. Es war nun einmal meine Aufgabe, mich um ihn zu kümmern. Ich hätte ihm nie irgendetwas zuleide getan. Stattdessen sorgte ich für ihn so gut ich konnte, bis er nach einigen Tagen in ein deutsches Krankenhaus verlegt wurde. Ich sah ihn nie wieder.
Im selben Jahr wurden die in Poitiers verbliebenen ausländischen Juden von den Deutschen zusammengetrieben und in ein nahe gelegenes Lager gebracht. Dabei kamen ihnen die gewissenhaft geführten Namenslisten, die wir ihnen ahnungslos geliefert hatten, sehr entgegen. Unser wunderbarer Rabbi Elie Bloch, der mit seiner Frau Georgette und seiner sechsjährigen Tochter Myriam von Metz nach Poitiers gezogen war, setzte sich unermüdlich für die Internierten ein. Er lag den deutschen Behörden so lange in den Ohren, bis sie schließlich erlaubten, dass die Kinder der Gefangenen bei einheimischen jüdischen Familien unterkamen und weiter die Schule besuchten, statt ihr junges Leben hinter Stacheldraht zu verbringen.
Da wir bei uns in der Rue Riffault ein freies Zimmer hatten, wurde uns ein vierzehnjähriger polnischer Junge namens Maurice Patawer zugewiesen. »Pavel« – wie er genannt wurde – war anfangs scheu und misstrauisch, aber wir taten unser Bestes, damit er sich bei uns wie zu Hause fühlte. Er und Jacquie standen sich besonders nah. Die Anwesenheit des schweigsamen Jungen mit den traurigen Augen erinnerte uns täglich an das unmenschliche Regime der Deutschen.
Überall in der Stadt versuchten die Menschen, den verhassten Besatzern das Leben so schwer wie möglich zu machen. Poitiers war eine Universitätsstadt. Viele Studenten lehnten den schändlichen Waffenstillstand ab und beteiligten sich an kleineren Widerstandsaktionen. Im Castille, dem örtlichen Kino, beispielsweise störten sie die Vorführung der deutschen Wochenschauen durch lautes Füßestampfen und Pfeifkonzerte. Oder sie vertieften sich demonstrativ in eine Zeitung. Das nahm jedoch ein jähes Ende, als ein Student verhaftet wurde. Deutsche Plakate wurden von den Wänden gerissen und auf Mauern, Türen und Bürgersteigen tauchte das mit Kreide oder Kohle gemalte Victory-Zeichen auf.
Auch unsere Familie leistete ihren Beitrag. Wie zuvor in Metz halfen wir jüdischen Familien, aus dem besetzten Teil Frankreichs zu fliehen. Wildfremde Menschen standen plötzlich auf der Türschwelle und baten um Hilfe. Wenn wir sie fragten, woher sie unsere Adresse hätten, gaben sie ausweichende Antworten. Allerdings konnten wir sie weder bei uns aufnehmen noch mit Lebensmitteln versorgen, da wir unter ständiger Beobachtung der Deutschen standen; es war einfach zu gefährlich. Sobald wir uns vergewissert hatten, dass unsere Besucher keine Spione oder deutschen Agenten waren, gaben wir ihnen die Adresse eines der an der Demarkationslinie gelegenen Bauernhöfe, von wo aus man sie sicher über die Grenze brachte. Auf diesem Weg war auch Fred und Oskar die Flucht gelungen.
Wir wussten nichts über diese durchreisenden Fremden. Nur selten erfuhren wir, wie sie sich bis nach Poitiers durchgeschlagen hatten. Manche schienen eine lange, beschwerliche Reise hinter sich zu haben. Die seelischen und körperlichen Strapazen waren ihnen deutlich anzusehen, besonders den Frauen. Aber der Krieg hatte uns gelehrt, dass es sicherer war, keine Fragen zu stellen. Viele unserer Besucher kamen aus dem Osten und waren äußerst wachsam und argwöhnisch. Sie wollten nichts weiter als eine Adresse, um so schnell wie möglich die Ligne de démarcation überqueren zu können und den Deutschen endgültig zu entkommen.
Die Bauern waren fabelhafte Menschen. Sie hatten über Monsieur Degout verbreiten lassen, dass sie bereit seien, den Flüchtlingen beim Grenzübertritt zu helfen. Trotz der großen Gefahr, der sie sich aussetzten, verlangten sie keinen Sou für ihre Dienste. Obwohl wir uns mit einigen von ihnen angefreundet hatten, kam uns damals nicht der Gedanke, diese Fluchtmöglichkeit auch für uns zu nutzen. Als meine Eltern zu Fred und Rosettes Hochzeit in den Süden fahren wollten, besorgte ich sogar bei der deutschen Kommandantur eine Reisegenehmigung für sie. Und da sie loyale französische Bürger waren, kehrten sie pflichtbewusst wieder nach Hause zurück.
Keiner von uns sah die verhängnisvolle Entwicklung voraus. Obwohl wir jeden Abend Radio hörten, waren wir völlig ahnungslos. Wir hatten Gerüchte über Arbeitslager gehört und über Dörfer in Polen und der Tschechoslowakei, deren gesamte Bevölkerung abgeschlachtet worden war, aber wir hielten das für Propaganda, weil wir uns einfach nicht vorstellen konnten, dass die Deutschen zu solchen Gräueltaten fähig waren. In Frankreich herrschte immer noch ein relativ entspanntes Klima, da die Deutschen so clever waren, uns in falscher Sicherheit zu wiegen. Sie ließen uns glauben, dass das Fehlverhalten einer Minderheit sie zwänge, zu immer drastischeren Maßnahmen zu greifen. Sie machten uns weis, dass wir alle im selben Boot säßen. Und eine Zeit lang funktionierte diese Strategie auch.
Die Nachrichten über den japanischen Angriff auf Pearl Harbor im Dezember 1941 gaben uns Auftrieb. So tragisch der Verlust von über dreitausend Menschenleben auch war, so bedeutete er das Ende des amerikanischen Isolationismus und den Kriegseintritt der Vereinigten Staaten. Für Jacques hatte dieses Ereignis allerdings eine völlig andere Bedeutung. Da die Japaner über Südostasien herfielen, Hongkong beanspruchten und Singapur und die malaiische Halbinsel bedrohten, machte er sich große Sorgen um seine in Saigon lebenden Eltern. In den folgenden Monaten schien der Vormarsch der Japaner unaufhaltsam zu sein. Sie nahmen die malaiische Halbinsel, Singapur und schließlich auch Saigon ein. Jacques, der keinerlei Möglichkeit hatte, Kontakt zu seinen Eltern aufzunehmen, lauschte voller Entsetzen den Berichten über die brutalen Eroberungszüge der Japaner.
Meine anfängliche Freude über den Angriff auf Pearl Harbor wurde deshalb bald getrübt durch die wachsende Angst um seine und schließlich auch um meine eigene Familie, denn die politischen Veränderungen in Frankreich nahmen bedrohliche Ausmaße an. Selbst meine Mutter, die Schlimmes befürchtete, ahnte nicht, welche Katastrophe sich anbahnte. Aber da sie sich noch gut an den letzten Krieg erinnerte, glaubte sie den wenigen Gerüchten, die uns zu Ohren kamen. Deshalb war sie es auch gewesen, die Fred dazu gedrängt hatte, zu fliehen. Sie war in ständiger Sorge um uns. Und ich versuchte immer wieder, sie zu beruhigen.
»Mach dir keine Gedanken, Maman. Wir sind hier sicher.« Aber die besorgniserregenden Ereignisse häuften sich. Schließlich wurde ihr jüngster Bruder Max in Paris verhaftet.
Max war Arzt und mit Fannie verheiratet, einer Cousine meines Vaters, die aus der Schweiz stammte. Sie hatten eine kleine Tochter namens Ruth. Max war viel jünger als meine Mutter. Als Kinder hatten Stéphanie und ich einmal die Sommerferien bei ihm in Lyon verbracht. Wir sahen in ihm eher einen älterer Bruder als einen Onkel und standen ihm wegen des geringen Altersunterschieds sehr nah. Max war sanftmütig, friedfertig und ein wenig schüchtern. Er hatte Fannie durch gemeinsame Freunde kennengelernt und sie bald darauf geheiratet. Fannie hingegen war ein schwieriger Mensch: kratzbürstig, psychisch labil und alles andere als umgänglich. Sie und die kleine Ruth hatten einige Monate vor seiner Verhaftung bei Onkel Léon in Toulouse Unterschlupf gesucht. Max war vorerst in Paris geblieben, wo er seine Praxis, die zur gemeinsamen Wohnung gehörte, weiterführte. Doch die Concierge, mit der Fannie nicht gut ausgekommen war, rächte sich an ihr, indem sie Max bei der Polizei anzeigte. Sie behauptete, er sei Kommunist und halte in seiner Wohnung geheime Treffen ab.
Max wurde in dem berüchtigten Lager Drancy außerhalb von Paris interniert, wo er bald darauf schwer erkrankte. Er war noch keine vierzig Jahre alt. Ein gutartiger Tumor in der Hirnanhangdrüse hatte einen akuten Glaukom-Anfall ausgelöst und darüber hinaus zu einer Akromegalie, einer Überproduktion von Wachstumshormonen, geführt. Er litt unter heftigen Kopfschmerzen und schweren Sehstörungen. Als er hohes Fieber bekam und sich kaum noch auf den Beinen halten konnte, verlegte man ihn ins Hôtel-Dieu, das älteste Krankenhaus von Paris, nicht weit von der Kathedrale Notre-Dame.
Ich erinnere mich nicht mehr, wann Maman von Onkel Max’ Inhaftierung und seinem Krankenhausaufenthalt erfuhr. Auch weiß ich nicht mehr, ob wir im Familienkreis beratschlagten, was wir unternehmen könnten. Jedenfalls beschloss Maman Ende Januar 1942, mit dem Zug nach Paris zu fahren, um ihren Bruder zu besuchen. Ich weiß noch, dass ich mir schreckliche Sorgen um sie machte. Sie war ganz auf sich gestellt und sprach kaum ein Wort Französisch. Außerdem begab sie sich in große Gefahr. Die Gestapo würde Onkel Max’ persönlichen Kontakte sicher genau überwachen.
Es vergingen einige Tage, ohne dass wir etwas von ihr hörten. Jacques, der fürchtete, ich könnte etwas Unüberlegtes tun, nahm mir das Versprechen ab, auf keinen Fall allein nach Paris zu fahren, um sie zu suchen.
»Es ist niemandem geholfen, wenn du auch noch verhaftet wirst«, sagte er. »Hab doch einfach Geduld, Marthe.«
Unser Warten hatte ein Ende, als wir eines Abends, kurz vor Beginn der neu eingeführten Sperrstunde, um den Esstisch saßen und plötzlich Maman zur Tür hereinspazierte, den Arm um Onkel Max gelegt. Wir sprangen auf, begrüßten sie überschwänglich und bestürmten sie mit Fragen.
»Wir sind furchtbar erschöpft. Es war eine lange Fahrt«, sagte Maman. »Lasst uns erst mal etwas essen, dann erzähle ich euch alles.«
Kaum saßen wir wieder am Tisch, berichtete sie von ihren Erlebnissen in Paris. »Ich bin direkt zum Hospital gegangen. Cécile hat mich bis zum Eingang gebracht. Sie lässt euch übrigens alle herzlich grüßen. Ich habe Max’ Zimmer gleich gefunden. Er lag im Bett und sah ganz elend aus. Als er auf die Toilette musste, habe ich ihm in seinen Bademantel geholfen und ihn auf den Flur hinausgeführt. Während ich auf ihn wartete, fiel mir auf, dass nirgendwo Wachen standen. Immerhin war Max ein politischer Gefangener. Aber anscheinend hielten sie ihn für zu schwach, um wegzulaufen. Als er aus der Toilette kam, habe ich ihn an der Hand genommen und gesagt: ›Komm mit, Max. Wir gehen.‹ Ich bin mit ihm durch einen langen Flur gegangen, eine Treppe hinunter und dann standen wir schon auf der Straße. Es war ihm peinlich, dass er nur einen Bademantel anhatte, aber ich habe ihm gesagt, er solle sich keine Gedanken machen.«
Ehe wir ihr ins Wort fallen konnten, wedelte sie ungeduldig mit der Hand und fuhr fort: »Draußen auf der Straße habe ich gleich zwei von diesen neumodischen Fahrradtaxis mit Seitenwagen angehalten. Ich habe Max in das eine gesetzt und bin dann ins andere gestiegen. Wir sind direkt zu seiner Wohnung gefahren, wo er sich umzog und ich einen Koffer für ihn packte. Dann haben wir den nächsten Zug in Richtung Süden genommen.«
Wir waren sprachlos. Wer hätte gedacht, dass unsere Mutter so tollkühn sein konnte? Wenn sie erwischt worden wäre, hätte man sie sofort verhaftet. An jenem Abend erkannte ich, dass in dieser sanftmütigen, zierlichen Person eine wahre Kämpferin steckte.
Mir stiegen Tränen in die Augen, so stolz war ich auf sie. »Aber sag mal, Maman, wie hast du dich denn in Paris verständigt? Doch wohl nicht auf Deutsch.«
»Nein, mein Schatz, auf Französisch«, erwiderte sie schmunzelnd.
Als sie unsere verwirrten Mienen sah, sagte sie: »Tja, meine lieben Kinder, ich muss euch leider gestehen, dass ich durchaus Französisch spreche. Aber wenn ihr das gewusst hättet, hättet ihr bestimmt nicht eure kleinen Geheimnisse vor mir ausgeplaudert.«
Wir starrten sie mit offenem Mund an.
Einige Tage später räumte Cécile Max’ Pariser Wohnung aus, ohne dass die Concierge oder die Gestapo es mitbekamen. Sie nahm all seine persönlichen Sachen mit, denn sie wollte nicht, dass den Deutschen auch nur irgendetwas davon in die Hände fiel.
Nachdem Max und meine Mutter sich ein paar Tage erholt hatten, begleitete Arnold sie zur Demarkationslinie. Dank der Familie Degout, die auch Fred, Oskar und Rosette bei ihrer Flucht geholfen hatte, überquerten sie sicher die Grenze. Arnold und Maman brachten Onkel Max zu Onkel Léon nach Toulouse, dann fuhren sie weiter nach Arles, wo sie Fred und Rosette in ihrem neuen Heim besuchten. Dort lernte Maman ihr erstes Enkelkind kennen: Maurice Jacques, der am 3. Februar 1942 zur Welt gekommen war.
Drei Wochen später kehrten sie und Arnold mithilfe der Degouts auf demselben Weg zurück. Nachdem unsere tapfere Mutter ihre abenteuerliche Mission erfüllt hatte, sprach sie kaum noch darüber. Umso mehr schwärmte sie von ihrem kleinen Enkel. Sie tat nie wieder etwas so Wagemutiges.
Das Weltgeschehen hielt uns weiter in Atem. Hitlers Panzerdivisionen standen vor den Toren Moskaus, Rommels Afrikakorps drang in Nordafrika immer weiter vor, und Malta wurde fast ununterbrochen bombardiert. Trotz der vereinten Kriegsanstrengungen der Alliierten und anfänglicher vernichtender Schläge gegen die italienische Flotte schien der Siegeszug des Faschismus unaufhaltsam zu sein. Meine Mutter, die Abend für Abend mit uns zusammen Radio hörte, war verzweifelt.
»Wo soll das alles noch hinführen?«, jammerte sie. »Kann denn niemand diesem Hitler das Handwerk legen?«
Auf Druck der Deutschen wurde Pétains Stellvertreter, Pierre Laval, zum Premierminister ernannt, der ganz offen mit dem Feind kollaborierte. Im Juni 1942 sagte er in einer Rundfunkansprache, dass er auf einen Sieg Deutschlands hoffe, da sich sonst der Bolschewismus in ganz Europa ausbreiten werde. Darüber hinaus erbot er sich, die Deutschen beim Aufspüren von Résistance-Kämpfern zu unterstützen.
Während Jacques schreckliche Ängste um seine Eltern im fernen Saigon ausstand, begann sich auch bei uns in Poitiers die Lage dramatisch zuzuspitzen.