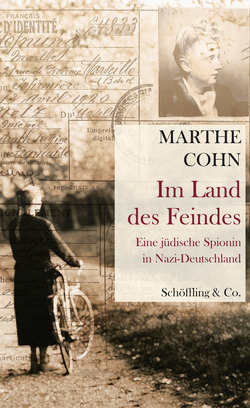Читать книгу Im Land des Feindes - Marthe Cohn - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEin leuchtender Stern
Jeden Abend zwischen halb sieben und halb acht kam die SS zu uns nach Hause, um zu überprüfen, ob wir die Sperrstunde einhielten und die unzähligen anderen Vorschriften befolgten, mit denen sie uns gängelten – ein Vorgeschmack auf das Leben hinter Stacheldraht. Die Regeln änderten sich fast täglich und jede einzelne musste strikt befolgt werden. Zuwiderhandlungen führten zu sofortiger Festnahme und Inhaftierung. Wir hatten schon von ausländischen Juden gehört, die mitten in der Nacht abgeholt worden waren. Rabbi Bloch erzählte, er hätte einige von ihnen im Lager für ausländische Juden am Stadtrand entdeckt, aber die meisten wurden vermisst.
An sieben Tagen in der Woche kamen immer dieselben SS-Männer in unser Haus, um uns auf ihrer Liste abzuhaken: Adjutant Wilhelm Hipp, zuständig für jüdische Angelegenheiten, sowie drei oder vier seiner bewaffneten Schergen. Unser Haus war nur eins von vielen, das sie aufsuchten. Hipp war ein kleiner, hässlicher Mann, der wie ein Troll aussah. Gegenüber seinen Kollegen bezeichnete er sich gern als »König der Juden«. Er war ein typischer Vertreter jenes Schlägertyps, der in den dreißiger Jahren die Ränge der NSDAP füllte. Es überraschte mich immer wieder, dass er überhaupt intelligent genug war, um einen vollständigen deutschen Satz von sich zu geben, geschweige denn einen französischen. Ich hatte nichts als Verachtung für ihn übrig, wenn er wie ein Pfau mit seinen doppelten SS-Streifen am Revers herumstolzierte.
Zu diesem Zeitpunkt war unsere Familie schon ziemlich geschrumpft. Zuerst hatte uns Cécile verlassen, dann Fred und schließlich Arnold. Hipp hatte wohl schon lange den Verdacht, dass sich Bauern als Fluchthelfer betätigten, aber er konnte es nicht beweisen. Als Arnold auf Drängen meiner Mutter im Juni 1942 über die Grenze in den Süden entkam, ärgerte sich Hipp maßlos, durchsuchte mit hochrotem Gesicht unsere Wohnung und durchwühlte unsere Post, um irgendeinen Hinweis auf Arnolds Aufenthaltsort zu finden.
Ich erklärte Hipp, dass mein Bruder einfach verschwunden sei. »Wir machen uns große Sorgen«, behauptete ich. »Wir wären Ihnen dankbar für jede Information, die Sie uns geben könnten.« Aber das kaufte Hipp mir nicht ab.
Nicht lange danach, am 17. Juni 1942, einem herrlichen Sommernachmittag, kam Noël Degouts Sohn Yves zu uns. Er war mit dem Fahrrad gefahren und völlig außer Atem. »Die Deutschen sind in unserem Haus«, stieß er mit schweißnassem Gesicht hervor. »Die Gestapo. Sie verhören jeden Einzelnen.«
Im Nachhinein scheint es verrückt, aber wir dachten keine Sekunde an unsere eigene Sicherheit. Damals wussten wir noch nicht, wozu die Nazis fähig waren. Das wusste niemand. Wir lauschten heimlich jeden Abend der BBC, aber da erfuhren wir wenig darüber, was mit den Juden in Europa geschah. Wir hatten nicht die leiseste Ahnung, was ihnen bevorstand. Wir gaben Yves ein Stück Brot und ein Glas kalte Milch, dankten ihm, dass er uns gewarnt hatte, und schickten ihn wieder nach Hause.
Abends saßen wir um unseren großen Esstisch aus poliertem Mahagoni und aßen Kirschen, die ein Ladenbesitzer meiner Mutter für uns Kinder mitgegeben hatte, obwohl er dafür ins Gefängnis hätte wandern können. Vor dem offenen Fenster zischten die Schwalben vorbei, während in der Wohnung Vaters unzählige antike Uhren tickten, bevor sie schließlich acht Uhr schlugen.
Wenige Minuten später hämmerte es an die Tür, begleitet von stürmischem Klingeln. Kurz darauf kamen Hipp und seine Männer hereingestürmt. Jacquie war zu diesem Zeitpunkt sieben und lebte seit vier Jahren bei uns. Inzwischen war er an die abendlichen Besuche gewöhnt, die so viele unglückliche Kindheitserinnerungen zurückbrachten. Unser größtes Problem war sein vorlautes Mundwerk. Es war meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass er in Gegenwart der SS-Männer kein Deutsch sprach und damit verriet, dass wir alles verstanden, was unsere unliebsamen Besucher untereinander sagten.
Ich legte ihm die Hände auf die Schultern und flüsterte ihm zu, dass er still sein solle. Jacquie gehorchte, aber mit einem Mund voller Kirschen blieb ihm auch nichts anderes übrig. Bevor ich ihn davon abhalten konnte, spuckte er die Kerne mit erstaunlicher Treffsicherheit auf die Deutschen. Nachdem ein Kirschkern direkt vor Hipp auf dem Boden gelandet war, schlug ich Jacquie fest auf die Hand.
»Non, Jacquie!«, schimpfte ich. Ich wagte nicht, mir auszumalen, was passiert wäre, wenn der Kirschkern sein Ziel getroffen und einen dunkelroten Fleck auf Hipps makelloser Uniformjacke hinterlassen hätte. »So etwas macht man nicht. Auch im Krieg muss man immer höflich sein.«
Wir saßen schweigend da, während wir darauf warteten, dass uns Hipp wie üblich auf seiner Liste abhakte. Pavel war verständlicherweise vorsichtig im Umgang mit Deutschen und versteckte sich immer hinter der Standuhr, wenn sie kamen. Er schrumpfte sichtlich, als Hipps Blick auf ihn fiel.
Hipp stolzierte auf dem eleganten Esszimmerteppich auf und ab, während er jeden Einzelnen von uns fixierte. Seine schwarzen kniehohen Stiefel glänzten so sehr, dass ich mich darin hätte spiegeln können. Er hatte ein arrogantes Grinsen aufgesetzt, das mir Angst machte.
»Wer von euch ist Stéphanie?«, bellte er plötzlich.
Bevor einer von uns irgendetwas sagen konnte, erhob sich Stéphanie schwankend. Sie litt an einer chronischen Nierenentzündung und war ziemlich geschwächt.
»Das bin ich«, sagte sie leise.
»Sie sind verhaftet«, schnauzte Hipp, packte sie am Arm und führte sie zur Tür. Als er sie losließ, konnte man deutlich die Abdrücke seiner Wurstfinger erkennen. Die beiden bewaffneten Wachen mit ihren stahlgrau glänzenden Gewehren nahmen sie in die Mitte. Wir sahen uns an, aber keiner von uns wagte es, sich einzumischen. Stéphanie gab mit einem Nicken zu verstehen, dass sie bereit war, mitzugehen, und lächelte uns aufmunternd zu. Ihr letzter Blick galt unserer kleinen blonden Mutter, die kerzengerade in einer Ecke des Raums stand, die Finger so fest ineinander verhakt, dass ihre Knöchel weiß durch die Haut schimmerten.
Nachdem die SS-Männer abgezogen waren, herrschte absolute Stille. Keiner von uns hatte sich geregt, seit sie das Zimmer betreten hatten. Nachdem meine Mutter die ganze Zeit die Fassung bewahrt hatte, sackte sie jetzt in sich zusammen und ließ sich auf einen Stuhl sinken.
»Sie kommt nie mehr zurück. Das weiß ich«, klagte sie und schlug sich mit der Faust auf die Brust.
In unserem Kummer vereint, saßen wir da und dachten an Steph. Ich sah sie vor mir, wie sie lachend den Kopf in den Nacken warf und ihr langes Haar über ihren Rücken fiel, während wir im Garten unserer Nachbarn in Metz Äpfel pflückten. Ich dachte an die Nächte, in denen wir zusammen mit Cécile kichernd im Bett gelegen, uns gegenseitig abenteuerliche Geschichten erzählt und über die Jungs getuschelt hatten, für die wir schwärmten. Ich versuchte, meine Mutter zu beruhigen, aber sie war untröstlich. Es war, als wäre in ihr ein Licht erloschen.
Mein Vater saß aschfahl und verhärmt am Esstisch, die Lippen fest aufeinandergepresst, den Kopf in die Hände gestützt. Fast ein Jahr lang hatten wir kein Wort miteinander gewechselt, weil ich seine Erziehungsmethoden missbilligte. Ich war wild entschlossen, dafür zu sorgen, dass unser kleiner Cousin, der schon so viel durchgemacht hatte, von seinen Wutausbrüchen verschont blieb. Das hatte ich meinem Vater bei unserem letzten Gespräch deutlich gesagt. Inzwischen war unsere Beziehung auf dem Tiefpunkt angelangt. Doch in den furchtbaren Minuten nach Stéphanies Verhaftung hatte ich das starke Bedürfnis, zu ihm zu gehen und ihn zu trösten. Aber mein Stolz hielt mich zurück.
Eineinhalb Stunden später hörten wir unten auf der Straße ein Auto vorfahren. Da nur die Deutschen Fahrzeuge besaßen, dachten wir zunächst, dass es ein SS-Fahrer wäre, der Stéphanie zurückbrachte. Dann hörten wir auf dem Bürgersteig Schritte und kurz darauf hämmerte jemand mit einem Gewehr an die Tür. Es war Hipp.
»Ihre Tochter weigert sich, mit uns zusammenzuarbeiten. Sie ist unverschämt und aufsässig«, schrie er meinen Vater an und packte ihn am Arm. »Ich verhafte Sie ebenfalls. Sie kommen mit.«
Wieder standen wir schweigend und nach außen hin gelassen da, während mein Vater seinen Hut nahm und unsanft zur Tür befördert wurde. Da hielt ich es nicht länger aus. Ich rannte zu ihm und schlang ihm die Arme um den Hals.
»Papa, ich hab dich lieb«, sagte ich und stellte mich auf die Zehenspitzen, um seinen Bart zu küssen. Zu meiner großen Freude drückte er mich fest an sich. Er warf meiner Mutter einen liebevollen Blick zu und ging dann mit hoch erhobenem Kopf aus dem Zimmer.
Ich fürchtete mich vor der Reaktion meiner Mutter und wollte sie auch Rosy und Hélène ersparen.
»Kommt, Mädchen«, sagte ich betont munter zu meinen jüngeren Schwestern, »machen wir uns fertig fürs Bett. Ihr wisst ja, wie böse Papa sein wird, wenn er nach Hause kommt und ihr immer noch nicht ausgezogen seid. Wir sollten Maman und Großmutter jetzt allein lassen.« Unsere alte Großmutter saß da wie ein Häufchen Elend.
Während der nächsten Stunden klopfte es immer wieder an unsere Wohnungstür. Es war nicht das ungeduldige Hämmern der Gestapo, sondern das zögernde Klopfen von Freunden und Nachbarn, die alle die Ausgangssperre missachteten, um nach uns zu sehen. Es hatte sich herumgesprochen, dass wir unerwünschten Besuch gehabt hatten und dass jemand verhaftet worden war. Als ich die Tür öffnete, fiel mir Jeanine Rieckert, meine Mitschülerin aus der Schwesternschule, in die Arme.
»O Marthe, ich bin ja so froh, dich zu sehen!«, rief sie mit leuchtenden Augen. »Ich habe gehört, dass die Gestapo hier war, und hatte schreckliche Angst, dass sie dich mitgenommen hätten.« Die Erleichterung stand ihr ins Gesicht geschrieben.
»Mir geht’s gut, Jeanine«, sagte ich und bat sie, hereinzukommen. »Aber Stéphanie haben sie mitgenommen und Papa. Ich wäre gern an ihrer Stelle mitgegangen.«
Diese netten Menschen trösteten uns und wünschten uns viel Kraft, bevor sie wieder nach Hause eilten, um nicht von den deutschen Patrouillen erwischt zu werden. Meine Mutter nahm ihr Mitgefühl mit ausdruckslosem Gesicht entgegen. Apathisch saß sie da und starrte auf die Tür. Sie war felsenfest davon überzeugt, dass die Deutschen jeden Moment zurückkommen und uns alle mitnehmen würden.
Als kurz vor Mitternacht unten vor unserem Haus ein Auto vorfuhr, wurde mir ganz elend zumute. Dann hörten wir Schritte und Rosy und Hélène rannten im Nachthemd zu meiner Mutter. Jacquie klammerte sich ängstlich an seine geliebte Hélène. Aber es war nur unser Vater, der mit bleichem Gesicht hereinkam. Er sah aus, als kehrte er gerade von einer langen, kräftezehrenden Reise zurück.
»Wo ist Stéphanie?«, fragte meine Mutter bestürzt.
»Sie wird noch verhört.« Zitternd setzte sich mein Vater auf einen Stuhl »Sie haben mich in denselben Raum wie sie gebracht und mich unter Drohungen aufgefordert, sie zum Reden zu bringen. Sie wollten alles über Degouts Hof wissen. Sie wollten, dass sie Monsieur Degout verriet, aber sie weigerte sich. Ich habe ihnen gesagt, dass sie nichts wüsste. Ich habe wirklich alles versucht, um die Situation zu entschärfen. Ich habe sogar angeboten, dass sie mich statt ihrer festhalten sollten, aber sie haben einen Brief von Stéphanie auf dem Bauernhof gefunden. Irgendjemand hatte seinen Bezugsschein für Tabak bei uns vergessen und sie hat ihn an Monsieur Degouts Adresse geschickt und den Brief mit ihrem Namen unterschrieben.«
Bezugsscheine für Tabak waren während des Kriegs eine beliebte Tauschware und der betreffende Flüchtling war sicher überglücklich, als er seinen zurückbekam. Aber in ihrer Gutmütigkeit hatte sich meine Schwester verraten und damit der SS ungewollt den Beweis geliefert, dass Monsieur Degout Flüchtlingen half. Warum hatte sie nur diesen Brief unterschrieben?
»Wird sie durchhalten, Papa?«, fragte ich, weil ich mir um ihre Gesundheit Sorgen machte.
»Sie hat einen starken Willen«, antwortete er mit brüchiger Stimme. »Sie weigert sich, Monsieur Degout zu verraten. Ich habe versucht, sie dazu zu bringen, die Wahrheit zu sagen, etwas entgegenkommender zu sein und die Deutschen glauben zu machen, dass sie zu so etwas überhaupt nicht fähig wäre, aber sie hat nicht mitgespielt. Sie blieb stur. Sie hat ihnen gesagt, dass sie lieber sterben würde, als einen Unschuldigen zu verleumden.« Er hielt inne und ließ den Kopf sinken.
»Aber, Marthe, sie ist so schrecklich müde«, fuhr er kaum hörbar fort. »Sie haben sie gezwungen, während des ganzen Verhörs zu stehen. Einmal wollte sie sich am Schreibtisch abstützen, weil sie so erschöpft war, und da haben sie sie angebrüllt und ihr befohlen, sich gerade hinzustellen.«
Meine Augen füllten sich mit bitteren Tränen. Ich schwor mir, niemals zu vergessen, was Hipp und seine Männer Steph angetan hatten. Niemals.
Das Klima in Frankreich verschlechterte sich täglich. Elf Tage nach Stéphanies Verhaftung wurde allen Juden im besetzten Teil Frankreichs, die älter als sechs Jahre waren, befohlen, einen gelben Stern zu tragen. Rabbi Elie Bloch riet uns, ihn als Auszeichnung zu sehen. Wir könnten doch stolz auf unser Judentum sein. Aber seine aufmunternden Worte konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass es eine weitere Demütigung für uns war. Jeder von uns bekam einen grellgelben sechseckigen Stern aus Stoff, mit dem Wort JUIF oder JUIVE darauf. Er musste sorgfältig abgetrennt und mit der Hand auf jedes neue Kleidungsstück aufgenäht werden. Sicherheitsnadeln waren verboten. Wenige Tage nach Inkrafttreten dieser Verordnung wurde Rosy, damals gerade mal sechzehn, auf der Straße von den Deutschen angehalten. Sie drohten ihr an, sie zu verhaften. Ihr »Verbrechen« bestand darin, dass sie sich mit Druckknöpfen beholfen hatte. Zum Glück kam sie mit einer Verwarnung davon.
Eigentlich sollte der Stern dazu dienen, dass wir öffentlich geächtet wurden, aber das Gegenteil war der Fall, denn wenn wir mit unseren gelben Abzeichen durchs Viertel liefen, überquerten ganze Familien der katholischen Gemeinde extra die Straße, um uns zu begrüßen; die Männer lüfteten sogar die Hüte, und alle äußerten sich missbilligend über die Diskriminierung, der wir ausgesetzt waren. Rabbi Bloch hatte recht: Der Stern war eine Auszeichnung, auf die wir stolz sein konnten.
Im Krankenhaus verbot mir der Verwaltungsleiter, den Stern an meiner Schwesterntracht zu tragen, obwohl die jüdischen Patienten dazu gezwungen waren. »Bei uns gibt es so etwas nicht«, sagte er mit vor Wut blitzenden Augen.
Aber der Stern war mein geringstes Problem; Stéphanie ging mir nicht aus dem Sinn. Als politische Gefangene wurde sie ins Gefängnis von Poitiers gebracht, wo auch Fred inhaftiert gewesen war, aber diesmal bekamen wir keine Besuchserlaubnis. Am 10. Juli 1942 wurde sie einundzwanzig und statt in unserem Wohnzimmer mit Dédé Walzer zu tanzen, saß sie krank und allein im Gefängnis. Wir warteten verzweifelt auf Neuigkeiten. Kurz darauf erzählten uns Frauen, die man entlassen hatte, dass unsere kluge Stéphanie trotz ihrer Jugend und ihrer angegriffenen Gesundheit ihre inoffizielle Anführerin geworden war.
»Sie war die Mutigste von uns allen«, meinte eine Frau lächelnd. »Jeden Deutschen, der auch nur in ihre Nähe kam, ließ sie ihre Verachtung spüren. Sie hat uns in Arbeitsgruppen eingeteilt und lässt Ihnen ausrichten, dass es ihr gut geht.«
Ich dachte an meine stille, sanftmütige Schwester und wunderte mich über die plötzliche Verwandlung. Zu Hause hatte sie nie etwas von einer Anführerin an sich gehabt, aber die Kriegsumstände hatten sie offenbar verändert. Ich fragte mich, wie ich mich wohl an ihrer Stelle verhalten würde.