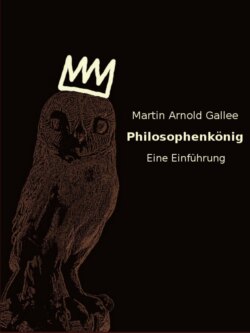Читать книгу Philosophenkönig – eine Einführung - Martin Arnold Gallee - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Aristoteles (384 – 322 v. Chr.)
ОглавлениеDie Frage, mit der sich das nun folgende Kapitel beschäftigt, ist identisch mit der Frage, die sich die Menschen in Athen 347 v. Chr. stellten: Was kommt nach Platon, oder besser: Was kann überhaupt noch nach Platon kommen, das eine originelle und eigenständige Philosophie darstellt und nicht etwa einfach das Denken des Meisters wiederholt? – Dabei fällt die aus heutiger Sicht zu gebende Antwort auf diese Frage deutlich anders aus als damals in Athen. Denn wen auch immer man dort als fähig ansah, in die großen Fußstapfen Platons zu treten (etwa, indem man ihn zu seinem Nachfolger als Leiter der von ihm gegründeten Akademie bestimmte) – es war jedenfalls nicht Aristoteles. Die bloße Tatsache, dass Aristoteles aus Stagira im Nordosten Griechenlands stammt und daher in Athen Zeit seines Lebens ein Ausländer ohne Bürgerrechte bleibt, hat ihn dort im Allgemeinen und an der Akademie im Besonderen zum Außenseiter gemacht. Eine direkte Konsequenz dieser Tatsache ist, dass sich um die nachgelassenen Schriften Aristoteles´ bei seinem Tod weit weniger Menschen kümmerten, als das bei Platon der Fall gewesen war. Was uns von Aristoteles erhalten geblieben ist, umfasst daher wohl nur noch etwa ein Viertel dessen, was er insgesamt geschrieben hat. Und das ist nur der quantitative Aspekt[1]!.
Darüber hinaus schreibt Aristoteles – modern gesprochen – für zwei unterschiedliche Zielgruppen: seine Schüler und Kollegen an der von ihm selbst gegründeten Schule[2]! sowie das außerakademische Publikum[3]!. An die erstgenannte Gruppe richten sich dabei die sogenannten esoterischen Schriften[4]!, für die zweite Gruppe waren dagegen die exoterischen Schriften bestimmt[5]!. Sowohl der Inhalt als auch der Stil beider Arten von Werken sind grundverschieden. Die exoterischen Schriften sind wesentlich zugänglicher und zum Teil sogar in Dialogform gefasst. Sie behandeln die Themen, mit denen sich Menschen allgemein beschäftigen (die Gerechtigkeit, das Gute etc.), sie sind aber auch klar auf ein Publikum gemünzt, das erst noch von der Philosophie überzeugt werden muss. Von dieser Gruppe der Aristotelischen Werke ist so gut wie nichts erhalten geblieben; bereits in der Spätantike musste man die exoterischen Schriften aus dem rekonstruieren, was andere Autoren davon in ihre Werke übernommen haben, und sich dabei auf deren Glaubwürdigkeit verlassen. – Nicht viel besser sieht es mit den esoterischen Schriften aus. Von diesen sind zwar auch die meisten verloren gegangen, wohl vor allem die Schüler und Kollegen von Aristoteles haben aber immerhin einige davon erhalten[6]!.
Leider ist das nicht alles, was sie mit diesen Schriften gemacht haben. Denn da es sich dabei nicht um philosophische Texte im eigentlichen Sinn, sondern vielmehr um für den Lehrbetrieb gedachte Skripte handelte, wurden diese nicht nur von Aristoteles selbst, sondern auch von seinen Schülern redigiert und umgeschrieben. In jedem Fall zeichnen sich die esoterischen Schriften (die auch Pragmatien genannt werden) durch einen wesentlich akademischeren Stil aus als die für ein breiteres Publikum gedachten Werke. Sie setzen nicht nur wesentlich mehr an Kenntnissen voraus, sondern sind auch oft sehr dicht formuliert, was das Verständnis nicht eben erleichtert. Auch der Bezug zur Praxis, der in Platons Dialogen immer wieder im Vordergrund steht und dort die Argumentation nachvollziehen hilft, fehlt – ausgerechnet – in Aristoteles´ Pragmatien oft ganz.
Was uns in Form des Corpus Aristotelicum (des Aristotelischen Werks) gegenübertritt, ist also ein in mehrfacher Hinsicht verkürzter Eindruck von einer Philosophie, von der sich nichtsdestoweniger sagen lässt, dass sie das europäische Denken bis zum Beginn der Neuzeit beherrscht hat wie außer ihr nur die Werke Platons[7]!. In verschiedensten Bereichen berufen sich noch heute Philosophen auf Aristotelische Argumente, und wo seine Ansichten als überholt gelten (etwa in der Naturphilosophie), da hatten sie schon eine Jahrtausende währende und erfolgreiche Überzeugungsgeschichte hinter sich, die ihren modernen Nachfolgern mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht vergönnt sein wird.
Zu der bedauerlichen Überlieferungslage der Aristotelischen Werke gehört auch, dass wir keine Kenntnisse darüber besitzen, ob und wie der Autor seine Schriften zu einem Gesamtwerk zusammengefügt sehen wollte, eine entsprechende Systematik liegt nicht vor. Als weitaus problematischer hat sich allerdings herausgestellt, dass sich Andere berufen gefühlt haben, diese Aufgabe an Aristoteles´ Stelle zu übernehmen – ein Aspekt, hinter dem sich mehr philosophische Brisanz verbirgt, als man auf den ersten Blick meinen könnte.
Andronikos von Rhodos (1. Jahrhundert v. Chr.), der erste Herausgeber des Corpus Aristotelicum, brachte die einzelnen Schriften in eine Ordnung, die für lange Zeit den Blick auf das Werk des philosophus prägen sollte. Dass er eines von dessen Büchern deshalb Metaphysik nannte, weil in seiner Systematik direkt davor die Physik kam[8]!, ist dabei noch ein recht harmloser Aspekt, denn immerhin geht es im 12. Buch (das entspricht in etwa unserer Einteilung in Kapitel) der Metaphysik tatsächlich um das Erkennen dessen, was sich jenseits (meta) des Sinnlichen, und damit physisch Gegebenen (physika) befindet. – Wesentlich schwerer wiegt im Rahmen der Anordnung der Aristotelischen Werke, dass noch vor der Physik[9]! eine Gruppe von sechs Abhandlungen gebildet wird, die sich angeblich als logische bzw. methodologische Vorübungen verstehen und den Titel Organon, also Werkzeug, bekommen haben.
Ganz abgesehen davon, dass es sehr fraglich ist, ob Aristoteles hier überhaupt eine einheitliche Gruppe von Schriften vor Augen hatte (nur zwei verweisen aufeinander), besteht das eigentliche Problem der Betitelung als Organon darin, dass der Eindruck entsteht, der Autor der betroffenen Werke würde unter Logik oder Methodologie etwas der Welt Enthobenes verstehen, das auf diese angewandt wird. Obwohl diese Meinung erstaunlich lange gewirkt hat (es gibt sogar Logik-Lehrbücher aus dem 20. Jahrhundert, die auf dieser Meinung über Aristoteles aufbauen), könnte nichts dem Aristotelischen Denken ferner liegen und seinem Verständnis abträglicher sein.
Denn Aristoteles steht – genau so wie Sokrates und Platon – fest auf dem Boden des ontologischen Paradigmas. Das bedeutet, dass die Welt und ihre Wahrheit für ihn der letzte Bezugspunkt allen menschlichen Tuns ist. Natürlich nimmt Aristoteles wie seine Vorgänger das Denken und die Sprache zur Kenntnis, und wie sie macht er sie auch ganz explizit zum Thema. Das bedeutet jedoch nicht, dass ihnen dieselbe Bedeutung zukäme wie der Welt bzw. dem Sein. Denken und Sprache haben im ontologischen Paradigma nur eine mediale Bedeutung[10]!; das heißt, sie haben über die Welt, so wie sie ist, zu informieren, und sie haben nur Sinn, solange sie diese Funktion erfüllen[11]!. Es handelt sich bei ihnen nicht um eigenständige Sphären, sie stehen zur Welt also im selben Verhältnis wie früher das Geld zum Gold, durch das es immer vollständig gedeckt sein musste.
Das ist somit der philosophische Hintergrund, vor dem sich das Grundlagendenken von Aristoteles entfaltet, und der auf jeden Fall berücksichtigt werden muss, wenn man die Argumentationsstruktur seiner Werke verstehen will.
Es liegt angesichts solcher Probleme bei der Systematisierung der Aristotelischen Werke von fremder Hand nahe, sich zunächst einmal anzusehen, was der Philosoph selbst über die Einteilung der Wissenschaften zu sagen hat, um diese Aussagen dann so weit wie möglich auf seine eigenen Schriften zurück zu beziehen. Dabei gehört für ihn die Philosophie ohne Zweifel zu den Wissenschaften (eigentlich ist es sogar genau umgekehrt: Die Wissenschaften gehören noch zur Philosophie), was auch mit seinem Kriterium für Wissenschaftlichkeit zu tun hat: Wissenschaften beschäftigen sich für Aristoteles nur mit allgemeinen Dingen, eine Wissenschaft vom Einzelnen gibt es nicht[12]!. Auf die Gründe dafür werden wir noch zu sprechen kommen.
Die oberste Einteilungsebene der Wissenschaften nach Aristoteles geht direkt zurück auf das Thema des menschlichen Weltverhältnisses. Dabei übernimmt Aristoteles von Parmenides und Platon den Gedanken, dass das Wahre auch das Unveränderbare ist. Das ist aber eben noch nicht alles, was es zum Verhältnis des Menschen zur Welt zu sagen gibt. Vielmehr lässt sich die Welt in einen Teil untergliedern, dem der Mensch ohnmächtig gegenübersteht, und in einen, den er durch sein Handeln verändern kann. Und entlang genau dieser Grenze zieht Aristoteles nun die Linie zwischen Theorie und Praxis. Der Aristoteles‐Experte Günther Bien hat das auf folgende präzise Formulierung gebracht:
Der Herausnahme der Sphäre einer spezifisch zum Menschen gehörigen Welt, d.h. alles dessen, was […] in unserer Verfügungsgewalt steht, aus der Gesamtheit dessen, was als ein unverfügbar Seiendes vorgegeben und hinzunehmen ist, entspricht die Trennung von Theorie und Praxis bei Aristoteles. ‚Theoria’ ist die Weise, wie sich der Mensch vernünftig in Bezug setzt zu dem, was durch diese menschliche Zuwendung nicht verändert und verwandelt wird, nämlich interesseloses Wissenwollen, wie sich die Dinge an sich verhalten. ‚Praxis’ ist der Daseinsvollzug und die Selbstverwirklichung des Menschen durch Handeln im Raume der so ausgegrenzten Welt.[13]!
Damit ergibt sich zunächst eine Zweiteilung in eine theoretische und eine praktische Philosophie. Diese Trennung ist bei Aristoteles sehr strikt, was eben daran liegt, dass die Wahrheit der Welt nur beobachtet bzw. festgestellt, nicht aber verändert werden kann, weil sie ja immer gleich ist. Deshalb kann die Theorie nur interesselos sein. Die Praxis ist hingegen von menschlichen Zielsetzungen beeinflusst, weil sie sich auf den Teil der Welt bezieht, der für den Menschen disponibel ist. Diese scharfe Trennung ist für uns heute nicht mehr leicht nachvollziehbar, weil sich vor allem in der Neuzeit der Gedanke durchsetzt, dass zwar die physikalische Welt vollständig determiniert ist, der Mensch im Denken hingegen vollkommene Freiheit genießt[14]!. Wie alle Denkvorgänge und ‐strukturen sind Theorien daher für uns heute wie selbstverständlich Instrumente, die zu bestimmten Zwecken eingesetzt werden – nach dem Motto, dass eben nichts so praktisch ist wie eine gute Theorie[15]!. Die Theorie ist also für uns in den menschlichen Zwecksetzungshorizont eingebettet, und genau das ist sie für Aristoteles nicht. Wenn wir Theorie betreiben, so seine feste Überzeugung, geht es uns nur um die Gewinnung von Wissen, nicht um dessen praktische Umsetzung. Und weil diese Überzeugung aus den Eigenschaften der Welt gewonnen wurde, kann es zwischen den Bereichen der Theorie und der Praxis ebenso wenig Überschneidungen geben wie zwischen den auf dieser Grundlage getrennten Feldern der theoretischen und der praktischen Philosophie. Was immer also genau in beiden enthalten ist, es hat nichts miteinander zu tun.
Dass Aristoteles diese Abgrenzung anhand der Welt und ihres Bezugs zum Menschen festmacht, ist zunächst als deutliche Absage an Platon zu verstehen. Denn während es die Welt für Platon nicht Wert ist, differenziert behandelt zu werden, und er daher eine Einheitsmethode für alle ihre Bereiche entwirft, bringt Aristoteles hier und an vielen anderen Stellen einen Aspekt ins Spiel, der der Bedeutung der Welt in seinem Denken deutlich Ausdruck verleiht: die Angemessenheit. Die Differenzierung von theoretischer und praktischer Philosophie ist angemessen, weil sie wie alles Angemessene „der zugrunde liegenden Sache entspricht”[16].
Innerhalb der Praxis bzw. der praktischen Philosophie nimmt Aristoteles eine weitere Unterscheidung vor, die nicht vom Verhältnis des Menschen zur Welt, sondern von seinem Bezug zu seinem Handeln abhängt. Dabei kann sich dieses Handeln einmal in einem Ergebnis oder Werk manifestieren, das dem Handelnden vor der Handlung vor Augen stand. Das klassische Beispiel dafür ist der Handwerker, der etwas herstellt; das Themenfeld dieser Art von Handlung umfasst aber alles, das als zweckhaft verfolgtes Werk vom Vorgang der Handlung selbst abgetrennt werden kann. Aristoteles redet in diesem Zusammenhang vom Hervorbringen bzw. von poiesis (griech. für ‚Wirken’), das über das Charakteristikum der Zweckhaftigkeit definiert ist: „Jeder Hervorbringende tut dies zu einem bestimmten Zweck, und sein Werk ist nicht Zweck an sich, sondern für etwas”[17]. – Wenn der Zweck einer Handlung dagegen in der Handlung selbst besteht, es also keine darüber hinausgehende Motivation des Handelns gibt, redet Aristoteles von praxis bzw. von Handeln im engeren, eigentlichen Sinn: „Das Handeln ist […] Zweck an sich”[18].
Poiesis und Praxis haben also für Aristoteles gemeinsam, dass sie auf das bezogen sind, was nicht notwendig und daher immer gleich ist, sondern „was sich auch anders verhalten kann”[19] – und damit möglicherweise unter dem Einflussbereich des Menschen steht. Während sich die herstellende Poiesis dabei aber immer auf eine bestimmte äußere Zwecksetzung bezieht und sich darüber hinaus in einem von ihr selbst abgrenzbaren Werk manifestiert, trägt die Praxis bzw. das Handeln im engeren Sinn ihren Zweck in sich – „die poiesis hat ein von ihr verschiedenes Ziel, die praxis nicht. Denn das gute Handeln ist selbst ein Ziel”[20].
Die übergeordnete Bedeutung der praxis für Aristoteles wird daran deutlich, dass er das Leben insgesamt als solche versteht – „Leben ist praxis und nicht poiesis”[21]. Das Ziel des Lebens liegt also immer in ihm selbst und nicht außerhalb. Ein gelungener Lebensvollzug ruht folglich in sich selbst und wird als eudamonia (griech. für ‚Glück’ im Sinne von ‚Glückseligkeit’) bezeichnet. Die Aristotelische Ethik wird daher auch als eudämonistisch bezeichnet – sie orientiert sich an einem Leben, das zur Glückseligkeit führt.
Gemäß der drei Bereiche Theorie, praxis und poiesis grenzt Aristoteles nicht nur als Erster theoretische und praktische Philosophie allgemein voneinander ab, er stellt in diesem Zusammenhang vielmehr drei Arten von Wissenschaften einander gegenüber: die theoretischen, die praktischen und die poietischen. Dabei ist ‚praktisch’ hier nun im engeren Sinn von praxis (also als Gegenbegriff zu poiesis innerhalb des umfassenderen Praxisverständnisses) gemeint. Alle drei Arten von Wissenschaft haben jeweils einen Objektbereich – „[d]ie theoretische Wissenschaft ist Wissenschaft von etwas, und so auch die poietische und praktische”[22]. Dieser Objektbereich ist zwar von einer Wissenschaftsart zur nächsten verschieden, wie erwähnt umfasst er aber immer nur Prinzipien, also Allgemeines[23] – vom Einzelnen gibt es keine Wissenschaft. Über diese Zuordnung von Gegenstandsbereichen hinaus wird die Eigenständigkeit der drei Wissenschaftsarten auch daran deutlich, dass Aristoteles jeder von ihnen jeweils eine besondere Fähigkeit zurechnet, die im jeweiligen Bereich erzielt werden kann; dazu gleich mehr.
Wenn man sich dem Aristotelischen Werk anhand dieses von ihm selbst ausgegebenen Leitfadens nähert, so orientieren sich die theoretischen Wissenschaften an dem, was als Wahrheit immer gleich ist und vor allem vom Menschen nicht verändert werden kann. Dieser ist gegenüber der Wahrheit immer nur Zuschauer, und das griechische theorein hat ursprünglich auch genau diese Bedeutung von reiner Betrachtung. Die theoretischen Wissenschaften sind rezeptiv, sie suchen die Wahrheit ohne Interesse und ohne äußere Zwecksetzung. Die charakteristische Fähigkeit, die es im Bereich der theoretischen Wissenschaft zu erwerben gilt, ist die sophia bzw. Weisheit. Sie ist, dem Objektbereich der Wissenschaft generell folgend, ein Wissen vom Allgemeinen, das heißt, von den Prinzipien des jeweiligen Teils der Welt[24].
Dabei benennt Aristoteles „drei theoretische Philosophien”[25], die sich aufgrund ihres jeweiligen Gegenstandes in einer Rangordnung befinden. Den höchsten Rang nimmt die sogenannte Erste Philosophie oder prima philosophia ein, die allerdings selbst aus mehreren Teilgebieten besteht. Aus diesem Grund ist das als Metaphysik bezeichnete Werk (s.o.) keine einheitliche Monographie, sondern umfasst selbst wiederum mehrere Unterbereiche, die darüber hinaus nicht nur dort, sondern auch an anderen Stellen des Corpus Aristotelicum behandelt werden. Schon aus diesem Grund sollte jeder Versuch der Systematisierung des Werks von Aristoteles inhaltlich und nicht nach Büchergruppen vorgehen.
Die Erste Philosophie umfasst nach Aristoteles zunächst die Lehre vom Seienden bzw. als dessen höchstem Prinzip die Lehre von Gott. Sie ist also Ontologie und Theologie in einem. Dabei macht Aristoteles das Zugehören dieser beiden Disziplinen zu den theoretischen Wissenschaften klar, um dann zu erklären, dass und warum es sich bei ihnen in dieser Gruppe wiederum um die höchste Stufe handeln muss:
Gibt es etwas Ewiges […], so muss offenbar dessen Erkenntnis einer theoretischen Wissenschaft angehören […]. Denn unzweifelhaft ist, dass, wenn sich irgendwo ein Göttliches findet, es sich in einer solchen [ewigen, unveränderlichen] Natur findet, und die würdigste Wissenschaft die würdigste Gattung des Seienden zum Gegenstand haben muss.[26]
Die besonders im sogenannten Mittelalter populären Versuche, Aristoteles´ Philosophie im Sinne des christlichen Glaubens zu interpretieren, setzen an solchen Stellen an, obwohl der Aristotelische Gott wesentlich mehr einem unpersönlichen Prinzip entspricht und vor allem nichts Monotheistisches an sich hat. Dazu kommt, dass die Gottesfrage bei Aristoteles nicht einfach aus der Theologie heraus gestellt wird, vielmehr führen die naturphilosophischen Studien zu dieser Frage. In einem im Rahmen der Geschichte der Religion eher seltenen Vorgang macht Aristoteles explizit, dass die Hinwendung zur Transzendenz nicht etwa einer vorgängigen Abwendung von den Naturphänomenen folgt; vielmehr führt erst eine Auseinandersetzung mit dem Diesseits dazu, die sich dort stellende Erklärungsfrage bis auf letzte, eben jenseitige Prinzipien zu verfolgen[27]!. Dies wird später eine von mehreren Gelegenheiten darstellen, bei denen Immanuel Kant an Aristoteles anknüpft.
Natürlich wird die Ontologie bei Aristoteles nicht nur wegen ihres Übergehens in die Theologie zum Teil der Ersten Philosophie gemacht. Vielmehr knüpft der philosophus mit der Frage nach den Grundstrukturen des Seienden an Untersuchungen an, die die griechische Antike bereits vor Sokrates interessiert hat[28]!. Dabei ist für ihn als Philosoph die Welt zwar im Wesentlichen an sich relevant, Aristoteles bezieht wie Sokrates und Platon aber den Menschen in seine ontologischen Überlegungen mit ein. Nicht nur, dass sich der Gegenstand der theoretischen Wissenschaften und damit eben auch der Ontologie von dem her bestimmt, was für den Menschen nicht änderbar ist; sondern er wird von Aristoteles auch aus der Perspektive des Menschen thematisiert. So sind die obersten Prinzipien des Seienden, die Kategorien, zwar auf die Realität bezogen, alle zehn[29]! gehen aber insofern auf das menschliche Weltverhältnis zurück, als sie aus der Alltagssprache gewonnen wurden. Aristoteles abstrahiert vom Sprachverhalten auf die zehn Arten von Fragen, die an das Seiende gestellt werden können, ohne dass eine von ihnen auf irgendeine andere reduziert werden könnte[30]!. Es geht also auch hier um die menschliche Sicht der Welt, was allerdings nicht bedeutet, dass damit bereits eine erst wesentlich spätere Stufe der Philosophie erreicht wäre, in der sie dem Denken und der Sprache gegenüber der Welt eine eigenständige Sphäre einräumen würde. Aristoteles ist, wie oben erläutert, fest im ontologischen Paradigma verankert, und das bedeutet in Bezug auf die Kategorien, dass sie zwar auch in sprachlicher Hinsicht thematisiert und manchmal auch charakterisiert werden. Der Zugang zu den Kategorien ist sprachlicher Natur, das war oben mit medialer Bedeutung gemeint. Daraus darf aber nicht gefolgert werden, dass die Kategorien für Aristoteles etwas Sprachliches wären. Genau so, wie man mit Geld (das ja an sich nur einen minimalen Materialwert hat) sorglos handeln kann, solange es durch Gold gedeckt ist, kann man mit sprachlichen Größen operieren, solange klar ist, dass deren einzige Aufgabe im Rückbezug auf das Seiende besteht – und das ist eben für Aristoteles so klar wie unter anderem für seine beiden berühmten Vorgänger. In den beiden für das Kategorienthema ausschlaggebenden Schriften, den Kategorien und der Metaphysik, lässt Aristoteles daran auch überhaupt keinen Zweifel aufkommen: Die Liste der Kategorien, „die das Seiende bestimmen”[31]!, enthält selbst keine einzige mentale oder sprachliche Größe.
Dabei zieht Aristoteles das Modell der Alltagssprache auch heran, um im Rahmen der zehn Kategorien eine bestimmte auszumachen, der ein höheres Maß an Sein zukommt als den anderen neun. Bei der ersten Kategorie handelt es sich um das Wesen bzw. die Substanz, wie der im Original verwandte griechische Ausdruck ousia auch übersetzt wird. Diese Substanz genießt gegenüber allen anderen Kategorien einen ontologischen Vorrang, insofern Letztere im Vergleich zu ihr nur Akzidenzien, also Nebensächlichkeiten sind[32]!. Sie können nur auf der Basis der Substanz existieren und ausgesagt werden, diese benötigt die Akzidenzien hingegen nicht, sie ist ontologisch eigenständig. Das Wesen, so könnte man auch sagen, ist als erste Kategorie immer der Kern einer Sache – wobei Aristoteles diesen Kern allerdings auf zwei sehr unterschiedliche Arten versteht.
Zum Einen ist die Substanz, also die erste Kategorie, das konkrete Einzelding, die hier und jetzt vorliegende Sache oder Person, z.B. Sokrates am Mittwochmorgen auf dem Athener Marktplatz. Dieses Einzelding bezeichnet Aristoteles auch als erste Substanz. Die zweite Substanz, also die andere Variante der ersten Kategorie, sind dagegen die Arten und Gattungen, also allgemeine Größen. Es gehört zu den vielen Seitenhieben auf Platon, die sich im Corpus Aristotelicum finden, dass der ersten Substanz (also den Einzeldingen) innerhalb der ersten Kategorie ein ontologischer Vorrang gegenüber der zweiten Substanz (den allgemeinen Arten und Gattungen) eingeräumt wird – das, was der große Platon als das vernachlässigbare und unbedeutende Einzelne betrachtet hatte, ist bei Aristoteles gleichbedeutend mit einem Höchstmaß an ontologischem Gehalt! Einig ist sich Aristoteles mit seinem Lehrer nur darin, dass es von diesem Einzelnen keine wissenschaftliche Erkenntnis geben kann, da Letztere nur allgemein, also in Prinzipien möglich sei[33]!.
Dieser methodologische Vorrang der allgemeinen Größen, zu denen Aristoteles auch die Platonischen Ideen zählt, bedeutet für ihn nun eben nicht, dass daraus auch auf die Existenz dieser Größen geschlossen werden könne[34]. So schließt sich Aristoteles zwar der Argumentation in Platons Dialog Parmenides an, man brauche zur geistigen Orientierung immer auch allgemeine Bezugspunkte der Identifikation, dennoch finden sich in seinem Werk von der Frühschrift Über die Ideen[35]! bis zur Metaphysik immer wieder höchst kritische Anmerkungen zu den Ideen Platons.
Dabei sieht Aristoteles das größte Übel im Zusammenhang mit den Platonischen Ideen in der seiner Meinung nach von seinem Lehrer vertretenen Sphärenfremdheit der Ideen und der Dinge, die keine Ideen sind. Nicht unbedingt in Einklang mit den tatsächlichen Verhältnissen nimmt Aristoteles dabei Sokrates in Schutz und behauptet, diesem sei es nur um allgemeine Definitionen gegangen. Erst Platon und seine Schule hätten später über die sinnlich zugänglichen Dinge hinaus „bestimmte andere, beständige Naturen neben den wahrnehmbaren [Naturen]”[36]! angenommen – und in dieser Annahme sieht Aristoteles nun „die Ursache für alle Schwierigkeiten, die sich bezüglich der Ideen ergeben”[37]!.
Denn weder könne Platon erklären, wie sich eine Teilhabe der wahrnehmbaren Dinge an den Ideen angesichts der Tatsache gestalten solle, dass doch beide Sphären getrennt voneinander existieren, und darüber hinaus eine einzige Idee für eine unendlich große Menge an Gegenständen ‚zuständig’ sei. Auch könne nicht wirklich jedem Gegenstand eine Idee entsprechen, weil es dann auch negative Ideen für all die Gegenstände geben müsse, die eine bestimmte Eigenschaft nicht aufweisen. Darüber hinaus ergeben sich für Aristoteles auch bei der Zuordnung von Ideen zu Gegenständen Schwierigkeiten. So bemüht Aristoteles mehrfach das Argument vom ‚dritten Menschen’, das belegen soll, dass ein konkreter Mensch der Idee vom Menschen nicht ohne ein drittes Element zugeordnet werden kann, das die Frage beantworten hilft, ob etwas überhaupt unter die Idee vom Menschen fällt[38]!. Und schließlich sei Platons Gedanke, dass die Ideen eine Art normative Kraft gegenüber der Welt ausübten, verfehlt, weil ja schließlich keine Regel ihre eigene Anwendung regeln könne[39]!. – Kurz gesagt: Bei den Platonischen Ideen handelt es sich laut Aristoteles um nichts als „leere Redensarten”[40] – und das ist noch eine der freundlicheren Übersetzungen[41]!.
Aristoteles selbst setzt nun genau dort an, wo Platon mit den Ideen seiner Ansicht nach den größten Fehler begangen hat: bei der Trennung der Sphären zwischen den Ideen auf der einen und den Dingen, die keine Ideen sind, auf der anderen Seite. Dabei ist sein eigener Ansatz in vielen Aspekten nicht weit weg von Platon, versucht aber genau in diesem Punkt konsequent zu bleiben. Es gibt zwischen dem, was bei Aristoteles an die Stelle der Platonischen Ideen tritt, und den ‚normalen’ Gegenständen keine Grenze ontologischer Natur, sie gehören vielmehr einem gemeinsamen Bereich an. Dabei lässt sich das Aristotelische Vorgehen in diesem Zusammenhang auf einen Begriff bringen: eidos, also Form oder Gestalt.
Aristoteles verwendet eidos in unterschiedlichsten Zusammenhängen, dabei ist je nach Kontext entweder von der äußeren Form oder aber von der inneren Struktur oder dem wesenhaften Kern einer Sache oder eines Lebewesens die Rede[42]!. Damit ist bereits der hauptsächliche Unterschied zu Platon im oben erläuterten Sinn benannt: Für Aristoteles findet sich das Wesen einer Sache nicht außerhalb ihrer in einer fremden Sphäre, es ist ihr vielmehr immanent, gehört ihr also zu.
Wie sehr es Aristoteles um diese auf die innere Form gerichtete Perspektive geht, zeigt sich vor allem in seinen logischen Schriften[43]!. Dabei ist allerdings erneut zu beachten, dass mit der Logik nicht eine eigenständige Denk‐ oder Sprachebene gemeint ist, die Struktur des logischen Kalküls hat vielmehr die innere Form der Welt wiederzugeben (sie ist also in gewisser Hinsicht eine Naturwissenschaft!). In diesem Zusammenhang gehört es zu den Aristotelischen Errungenschaften, dass er mit seiner formalen Betrachtungsweise von den jeweils betroffenen Inhalten ganz absehen kann. Die nach ihm benannten logischen Schlussformen, die Syllogismen, zeichnen sich dadurch aus, dass auf der Basis von zwei Voraussetzungen (Prämissen), nämlich einem Ober‐ sowie einem Untersatz, ein Schluss (conclusio) folgen muss. Dieser Aspekt der Notwendigkeit wird von Aristoteles selbst immer wieder betont: „Ein Syllogismus ist eine Rede, in der, wenn etwas gesetzt wird, etwas von dem Gesetzten Verschiedenes notwendig dadurch folgt”[44]. Da die Logik, wie erläutert, die Struktur, also die Form der Welt wiedergeben soll, kann vom Inhalt sowohl der Prämissen als auch des Schlusses abgesehen werden. Bei einem Syllogismus der Form
Erste Prämisse (Obersatz): Alle A sind B.
Zweite Prämisse (Untersatz): Alle C sind A.
Schlussfolgerung (Conclusio): Alle C sind B.
ist es also unerheblich, was für die Variablen A, B und C eingesetzt wird, so lange für die gleichen Variablen immer die gleichen Inhalte eingesetzt werden[45]!. Da Aristoteles seine Logik auch über die beiden Kategorien der Quantität und der Qualität variiert[46]!, ergibt sich (zusammen mit weiteren Elementen wie etwa der Lehre von den Gegensätzen) ein umfassender logischer Apparat, der für die nächsten 2000 Jahre verbindlich bleiben sollte. So wird etwa noch Immanuel Kant in seiner Kritik der reinen Vernunft bemerken, die Logik habe seit Aristoteles „bis jetzt keinen Schritt vorwärts […] tun können”[47]!.
Was sich allerdings verändern wird, ist die allgemeine Interpretation der Logik. Es ist für Aristoteles klar, dass sie die innere Struktur und Form der Welt wiedergibt. Dass es in seiner Logik etwa ein Widerspruchsverbot gibt, liegt für ihn einfach daran, dass die Welt nicht widersprüchlich ist. Mit dem Verlassen des ontologischen Paradigmas wird sich daher auch die Frage stellen, worauf sich die Logik bezieht. Zwar scheint im Rahmen des mentalistischen Paradigmas die Antwort mit dem Denken schnell festzustehen, es fanden sich allerdings schnell Kritiker, die den berechtigten Einwand erhoben, dass in den Köpfen wirklicher Menschen nur selten logisch vorgegangen wird. Folglich schlug etwa Kant vor, die Logik nicht be‐, sondern vorschreibend zu verstehen – „nicht, wie wir denken, sondern, wie wir denken sollen”[48]. Doch spätestens mit dem Aufkommen mehrerer und sich gegenseitig widersprechender Logiksysteme im 19. Jahrhundert erwies sich auch dieser Vorschlag als Sackgasse. Mit der ‚linguistischen Wende’, also dem Beginn des sprachlichen Paradigmas in der Philosophie zu Beginn des 20. Jahrhunderts war zwar die Möglichkeit gegeben, die Logik nunmehr sprachlich zu orientieren – bezüglich der Frage, in welchem Verhältnis diese Sprache aber etwa zu unserer Alltagssprache steht, war man damit aber immer noch nicht weiter. Bei Ludwig Wittgenstein werden wir zu dieser Frage allein zwei völlig unterschiedliche Auffassungen finden. Bis heute fragen sich Studenten der Philosophie völlig zu Recht, warum sie mit formaler Logik gequält werden, obwohl wir auf die Frage ihrer Bedeutung im Rahmen des Horizonts unserer Erkenntnis und unseres Weltverhältnisses insgesamt nach wie vor noch keine befriedigende Antwort gefunden haben.
Für Aristoteles stellen sich solche Fragen noch nicht. Daher kann er das, was er in der Logik hinsichtlich der Welt als Ganzes macht (also ihre innere Struktur freizulegen), mittels des eidos bei jedem einzelnen Ding vorführen, nämlich die Frage nach seinem Wesen stellen, das ihm allerdings – darin besteht ja der zentrale Gesichtspunkt, den Aristoteles gegenüber Platon geltend macht – nicht fremd gegenübersteht, sondern ihm vielmehr innewohnt[49]!.
Dabei dient das eidos eines Dings zunächst einmal zur Beantwortung der Sokratischen Frage, was etwas ist. In diesem Zusammenhang wird eidos als Art verstanden – „zum Beispiel gehört der individuelle Mensch zu einer Art, Mensch”[50]. Das eidos erfüllt hier also eine Identifikationsaufgabe, funktional deckt sich das mit den Platonischen Ideen. Auch die Rolle der Ideen als paradeigmata, also als Muster, transformiert der philosophus auf sein Konzept des eidos[51]!. Darüber hinaus wird eine weitere Aufgabe von diesem übernommen, die allerdings schon in einen anderen Bereich der theoretischen Philosophie hineinragt, die Naturphilosophie[52]!.
Auch dieser Teil der Corpus Aristotelicum wartet mit einigen Höhepunkten auf, dabei besteht eine direkte Verbindung vor allem zwischen dem Konzept des eidos und der Lehre von den vier Ursachen. Wie bei den Kategorien ist auch hier die Vielfalt ein deutlicher Wink in Richtung der Einheitsphilosophie Platons, und im Sinne der Angemessenheit postuliert Aristoteles bei den Ursachen „dieselbe Anzahl wie die der Bedeutungen, die die Frage nach dem Warum anzunehmen vermag”[53]!.
Dabei unterscheidet Aristoteles bei der Erklärung eines Sachverhalts zwischen einer kausalen Ursache – „das (jeweilige) erste Bewegende”[54] –, die auch als causa efficiens bezeichnet wird. Darunter wird etwa ein handelnder Mensch verstanden, aber auch ein Gegenstand, der einen anderen anstößt. Wenn wir heute von Ursache sprechen, haben wir zumeist diese (und nur diese) Ursachendimension vor Augen. Aristoteles dagegen bezieht – zweitens – in seine Behandlung der Kausalthematik auch den materialen Aspekt mit in seine Betrachtungen ein. Eine so geartete Ursache erklärt etwa das Zerbrechen einer Fensterscheibe durch die physikalischen Eigenschaften des Glases und nicht nur (wie die causa efficiens) durch den Stein, der durch die Scheibe geflogen ist. Über diese causa materialis hinaus kommt nun – drittens – wieder das eidos ins Spiel, insofern im Rahmen der causa formalis auch das Wesen von etwas als Ursache verstanden wird. Aristoteles gibt sich große Mühe, zu erklären, warum für ihn die Form einer Sache als Wesen zu einer ihrer Ursachen gehören könnte. So weist er bei der Frage „warum ist dies, z.B. Ziegel und Steine, ein Haus?”[55] darauf hin, dass weder der Baumeister (als causa efficiens) noch die von diesem verwendeten Stoffe (als causa materialis) als Erklärung hinreichen, vielmehr müssen Letztere von Ersterem in eine bestimmte Form gebracht werden, die als eidos das Wesen des Hauses ausmacht. Obwohl es mit dieser Ursachenart eine weitere Funktion gibt, die das eidos anstelle der Platonischen Ideen übernimmt (eben die Erklärung von sinnlich wahrnehmbaren Dingen), und ihm damit natürlich eine große Bedeutung innerhalb des Aristotelischen Werks zukommt, haben sich spätere Naturforscher hier zu eingeengt gefühlt. Ihnen ging die Frage nach dem Wesen schlicht zu weit, wie der berühmte Mathematiker und Physiker Galileo Galilei (1564‐1642) beispielhaft bemerkt:
[E]ntweder wollen wir spekulativ versuchen, das wahre und innere Wesen der natürlichen Substanzen zu durchdringen, oder wir wollen uns mit der Kenntnis einiger ihrer Erscheinungen begnügen. – In das Wesen einzudringen, halte ich ebenso für ein unmögliches Unterfangen wie eine leere Mühe.[56]
Die neuzeitlichen Naturforscher haben sich also in diesem Punkt von Aristoteles klar abgewandt. Es sollte nicht das letzte Mal bleiben, dass dem menschlichen Forschritt mit einer solchen Reduktion (hier: auf das sinnlich Wahrnehmbare) auf die Sprünge geholfen wird – mit allerdings nicht immer nur positiven Konsequenzen. Wie für die causa formalis gilt auch für die vierte der Aristotelischen Ursachen, die causa finalis, dass sie im Inneren einer zu erklärenden Sache zu finden ist. Entsprechend ist gerade die Neuzeit mit diesem Aspekt nicht sehr freundlich umgegangen. Dabei wird eine zu erklärende Sache auf das hin bezogen, was als ihr Ziel (griech. telos) immer schon in ihr steckt und sie folglich durch diese causa finalis erklärt. So steckt im Samen schon die Pflanze, im Kind der Erwachsene, in der Zwecksetzung die Handlung etc. Diesem Erklärungsansatz hat die Aristotelische Naturphilosophie auch ihren Titel Teleologie zu verdanken, obwohl, wie gesagt, die causa finalis nur eine von vier Ursachen ist.
Man sollte bei aller modernen Kritik an der Aristotelischen Naturphilosophie und vor allem der causa finalis aber nicht übersehen, dass in ihr ein Theoriestück enthalten ist, das für uns heute nicht nur in den empirischen Wissenschaften unentbehrlich ist. Denn das telos einer Sache, ihr Ziel, steckt für Aristoteles als causa finalis immer schon im Modus der dynamis, also der Möglichkeit, in ihr; ihre Umsetzung erfolgt in den Modus der energeia, also der Wirklichkeit. Diese Erweiterung unseres Weltbezugs um eine modale Dimension[57]! ist heute aus den meisten Feldern der Forschung nicht mehr wegzudenken.
Mit der Ersten Philosophie, der Mathematik und der Naturphilosophie sind alle Teile der theoretischen Philosophie im Corpus Aristotelicum benannt. An sie schließt der von Aristoteles empfohlene bios theoretikos, das der Theorie gewidmete Leben, an – für den philosophus ist das kein unwichtiges, und schon gar kein rein privates Thema:
Wer über die beste Verfassung die Untersuchung in sachgemäßer Weise anstellen will, der muss notwendig zuerst bestimmen, welches das wünschenswerteste Leben ist.[58]
Dabei zeigt sich für Aristoteles, dass der bios theoretikos seinem praktischen Pendant, nämlich dem bios politikos (dem sittlich-politische Leben), überlegen ist, weil er eigenständig ist und nicht der Anerkennung durch andere Menschen oder materieller Güter bedarf[59]!.
Dieser Vorrang der Theorie gegenüber der Praxis bedeutet jedoch keinesfalls, dass die praktische Philosophie bei Aristoteles nur eine Nebenrolle spielen würde. Der Praxis kommt hier vielmehr eine zu, die in der Philosophie ihresgleichen sucht. Das beginnt bei der bereits beschriebenen Differenz von praxis und poiesis, also dem herstellenden und dem selbstzweckhaften Handeln, die Aristoteles zur weiteren Unterteilung der Wissenschaften in praktische und poietische heranzieht.
Dabei kommt in ihrer philosophischen Bedeutung den praktischen Wissenschaften ein größeres Gewicht zu, wiewohl sich die Unterscheidung von praxis und poiesis als sehr einflussreich erwiesen hat. Die an der praxis orientierten Wissenschaften werden daher auch als die praktische Philosophie Aristoteles´ bezeichnet, obwohl unter Letztere ja eigentlich auch die an der poiesis orientierten Disziplinen fallen würden. Dass zu der in diesem Sinn engeren Begriff der praktischen Philosophie die Nikomachische Ethik sowie die Politik gezählt werden, bedarf einer kurzen Erläuterung, die allerdings auch eine klare Distanz zwischen Aristoteles und uns deutlich werden lässt.
Gleich zu Beginn der Politik macht Aristoteles (hier im völligen Einklang mit seiner Zeit) klar, dass dem Kollektiv der Vorrang gegenüber dem Einzelnen gebührt. Für ihn ist also „der Staat der Natur nach früher als […] der einzelne Mensch, weil das Ganze früher sein muss als der Teil”[60]!. Der Mensch kann als Mensch also nur auf der Basis einer Sozialgemeinschaft existieren, er ist somit nicht etwa aus freier Wahl, sondern bereits auf der begrifflichen Ebene ein zoon politikon, ein soziales und politisches Wesen. Das bedeutet auch, dass in der griechischen Antike weder die Unterscheidung zwischen einem Menschen und einem Bürger, noch die zwischen den entsprechenden Gruppen, also zwischen Gesellschaft und Staat, sinnvoll ist – und folgerichtig gilt das Selbe für die sich an die beiden Rollen wendenden Disziplinen, Ethik und Politik[61]!. Beide, Nikomachische Ethik und Politik, machen folglich die praktische Philosophie des Aristoteles im oben beschriebenen Sinn aus, ihre Zielgruppen sind identisch[62]!.
Da aufgrund der Einheit von Mensch und Bürger in der griechischen Antike zwischen Moralität und Legalität (also zwischen sittlich angemessenem und gesetzeskonformem Handeln) ebenfalls nicht unterschieden wird, umfasst die von Aristoteles untersuchte Lebensform des bios politikos die sittlich‐politische Ganzheit. Dabei soll diese vor allem einem von niederen Antrieben geleiteten Leben entgegengestellt werden. Um das zu erreichen, sollte sich der Mensch für Aristoteles an seiner Vernunft orientieren, was zweierlei beinhaltet. Erstens sollte man sich an der sittlichen Tugend ausrichten, die im Zweifelsfall zur Mitte zwischen einem Zuwenig und Zuviel an Leidenschaften rät. In einer Kampfsituation zeichnet sich etwa der Tapfere weder durch Feigheit noch durch blinde Angriffslust aus, sondern durch eine vernunftgeleitete Mischung. Zweitens ist es durch eine besondere Fähigkeit, die phronesis oder Klugheit, möglich, die sittlichen Tugenden in einer jeweiligen Situation passend anzuwenden[63]!. So wie die sophia im Bereich der Theorie gibt es also auch in der praxis eine eigenständige Fähigkeit. Zwar ist sie der sophia untergeordnet, allerdings ist sie insofern eigenständig, als sie sich auf einzelne Situationen bezieht und insofern aus der allgemeinen sophia nicht abgeleitet werden kann. Sie erfordert also Erfahrung, was Aristoteles durch die Bemerkung zum Ausdruck bringt, ein junger Mensch könne zwar schon Mathematiker aber eben nicht klug sein[64]!.
Die sittliche Tugend und die Klugheit führen also gemeinsam zu einem bios politikos, der als Vorbild für andere Menschen gelten kann. Allerdings versteht Aristoteles das nicht nur als bloßen Vorschlag, seine praktische Philosophie hat eine gegenüber den tatsächlichen Verhältnissen durchaus kritische Haltung. Er geht aber im Sinne des oben zum Verhältnis des Einzelnen zum Staat Gesagten davon aus, dass die sozialen und politischen Institutionen so gestaltet sein müssen, dass der Mensch zum richtigen Leben angeleitet wird. Konsequenterweise widmet sich Aristoteles daher der Frage der Verfassung von Staaten, und das nicht nur theoretisch. Er studiert fast 150 staatliche Ordnungen seiner Zeit, die darauf aufbauende Lehre von den drei Staatsformen[65]!, die jeweils entweder in guter oder entarteter Form auftreten können, hat auf die politische Philosophie noch lange gewirkt. Allerdings muss auch hier ein Unterschied zu unserer heutigen Vorstellung von Staaten deutlich gemacht werden, insofern jeder (Stadt‐)Staat für Aristoteles und seine Zeit auf persönlicher Freundschaft basiert, und nicht, wie für uns, auf einem unpersönlichen, rein funktionalen Verhältnis[66]!.
Die staatliche Ordnung soll nach Aristoteles den Menschen also dazu anleiten, ein im oben beschriebenen Sinn sittlich-politisches Leben zu führen und so den Zustand der Glückseligkeit, der eudamonia, zu erreichen. In der Zielsetzung sind sich Mensch und Staat also letztlich gleich – „dasselbe Leben ist notwendig das Beste, sowohl für jeden einzelnen Menschen als für die Staaten und Menschen insgemein”[67].
Trotz dieses Vorrangs der praktischen gegenüber den poietischen Wissenschaften im Rahmen der praktischen Philosophie (Leben ist eben praxis und nicht poiesis), haben auch die Ausführungen Aristoteles´ zu den poietischen Disziplinen lang anhaltenden Einfluss zu verzeichnen gehabt – teilweise bis heute. Dabei fallen zwar im Sinne des oben zur poiesis Gesagten zunächst alle Disziplinen, die an der Herstellung einer Sache interessiert sind – also das Handwerk, die Dichtung, die Medizin etc. – unter die poietischen Wissenschaften. Auch lässt sich in allen von ihnen die diesem Bereich von Aristoteles zugeordnete besondere Fähigkeit, die techné, also eine Art Kunstfertigkeit, ausmachen. Konkret thematisiert wird die poiesis zumindest in dem uns überlieferten Werk des Aristoteles aber vor allem in der Rhetorik und der Dichtkunst.
Sowohl in der Rhetorik als auch in der Poetik grenzt sich Aristoteles weiter von Platon ab, insofern er im ersten Fall der Redekunst durchaus positive Seiten abgewinnen kann und sie sogar als relativ eigenständige Erkenntnisform neben die etablierten Wissenschaften stellt[68]. Er präsentiert in diesem Zusammenhang Regeln für gute Redner, wobei in der Folge vor allem die Einheit von Ethos, Pathos und Logos nachhaltig gewirkt hat[69]!. In der Dichtkunst, für die Platon in seinem Staat keine Rolle vorgesehen hatte, prägt sein Schüler mit dem Ausdruck mimesis (also Nachahmung im weitesten Sinn) nicht nur die Diskussion für lange Zeit, er stellt auch eine Theatertheorie auf, die noch auf Shakespeare und Schiller großen Eindruck hinterlassen wird[70].
Trotz dieser umfassenden Systematisierung in theoretische, praktische und poietische Wissenschaften ist das Aristotelische Werk noch immer nicht voll umgrenzt. So hat er etwa auch ausführliche Naturstudien betrieben, die zwar seinem eigenen Kriterium für Wissenschaftlichkeit zufolge als Einzelfalluntersuchungen nicht wissenschaftlich sind, aber dennoch als empirisches Datenmaterial eine wichtige Vorstufe darstellen[71]!.
In diesem echten Interesse für die Sinnesdaten kommt aber auch ein ganz allgemeiner Charakterzug des Aristotelischen Denkens zum Vorschein: Die Welt ist es nach ihrer Platonischen Diskreditierung wieder wert, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Das gilt auch für die theoretischen und praktischen Mittel, die wir immer nach dem Prinzip der Angemessenheit auf sie anwenden sollten. (Wenn Raffael in seiner bereits im Sokrates-Kapitel erwähnten Schule von Athen (1511) also Platon Richtung Himmel – also jenseits der Welt – zeigen lässt, Aristoteles hingegen auf den Bildbetrachter – also in die Welt hinein –, dann hat diese Darstellung trotz aller möglichen Relativierungen einige Berechtigung.)
Und auch der Blick auf den Menschen hat sich deutlich gewandelt. Sicher, bis zum klaren Vorrang des Individuums gegenüber dem Kollektiv ist es noch ein weiter Weg (wie heute in vielen Teilen der Welt immer noch), auch hält Aristoteles Sklaven immer noch für Dinge[72]! und Frauen für nicht viel mehr. Im Unterschied zu Platon wird der Mensch insgesamt aber wenigstens nicht mehr darauf reduziert, sich von staatlichen Institutionen gemäß einer optimierten Welt der Ideen zurechtbiegen zu lassen. Er hat, richtiges Handeln aus den richtigen Überzeugungen vorausgesetzt, jetzt die Möglichkeit wissenschaftlicher Erkenntnis und lebensweltlicher Glückseligkeit – und das ist wesentlich mehr, als ihm die Philosophie vor Aristoteles zu bieten hatte.