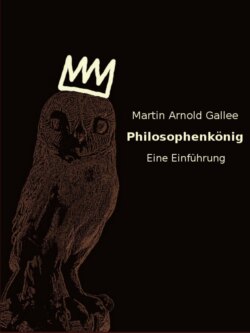Читать книгу Philosophenkönig – eine Einführung - Martin Arnold Gallee - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Platon (427 – 347 v. Chr.)
ОглавлениеAn Platons Lebensdaten ist zu erkennen, dass er zum Zeitpunkt des Todes von Sokrates noch ein junger Mann war. Er hatte seinen Lehrer etwa acht Jahre lang begleitet, dessen Hinrichtung stellte für ihn ohne jeden Zweifel ein traumatisches Erlebnis dar. Es sollte nicht die einzige Enttäuschung in seinem langen Leben bleiben, wenn auch die größte. Und ganz abgesehen von dem persönlichen Schmerz, den Platon aufgrund des Todes seines Lehrers erlitten haben mag, haben ihn sowohl dieses Ereignis als auch dessen Umstände nicht zuletzt als Philosoph geprägt. Die von Platon aus dem Tod von Sokrates gewonnene Einsicht, die sein gesamtes Werk bei allem Facettenreichtum durchzieht, lautet: Mit dieser Welt stimmt etwas nicht.
Das ist zunächst einmal ganz nahe liegend auf die politischen Verhältnisse in Athen zu beziehen, denen Platon denn auch umgehend für über zehn Jahre entfloh, bevor er im Jahr 387 zurückkehrte und seine berühmte Akademie gründete. Es ist aber noch wesentlich mehr als das gemeint. Wie wir im letzten Kapitel gesehen haben, bilden die für uns heute getrennten Bereiche der Gesellschaft und des Staates in der griechischen Antike noch eine Einheit. Die moderne, erst von Thomas Hobbes (1588‐1679) eingeführte Unterscheidung zwischen Mensch und Bürger ist für Platon folglich genauso wenig relevant wie die zwischen Ethik und Politik. Der Schritt von der Verurteilung der politischen Zustände in Athen (und ganz grundsätzlich aller Staaten, wie er in seinem Siebten Brief erklärt) zu einem Denken, das die Welt überhaupt als im Verfall befindlich ansieht, ist für einen in der griechischen Antike beheimateten Philosophen wie Platon also wesentlich kleiner, als er uns heute erscheinen mag. Und auch wenn die diesbezügliche Gleichsetzung von Athener polis und der Welt insgesamt (wie alle kulturellen Selbstverständlichkeiten) in den Schriften Platons nicht explizit auftaucht, durchzieht seine pessimistische Sicht der Dinge Platons gesamtes Werk. – Dabei belässt er es allerdings nicht bei der Feststellung des Verfallens der Welt, sondern sucht darüber hinaus nach Lösungen hinsichtlich der Frage, wie der Mensch einer solchen zerfallenden Welt gegenüber tritt und treten sollte. Sein Erfolg als Philosoph verdankt sich stark diesem therapeutischen Gesichtspunkt.
Dabei ist eine solche Bezeichnung von Platon als erfolgreichem Philosophen genau genommen eine starke Untertreibung. Sein Werk beherrschte das westliche Denken bis mindestens ins 12. Jahrhundert hinein, und das, obwohl die meisten seiner Schriften erst nach dem Fall von Konstantinopel 1453 mit einigen der von dort fliehenden Gelehrten nach Mitteleuropa gelangten. Und trotz der Tatsache, dass viele großen Philosophen von Aristoteles bis Nietzsche in zentralen Punkten Platon ausdrücklich widersprechen, ist dessen Denken bis heute relevant, auch wenn die Ansichten darüber, in welchem Grad dies der Fall ist, auseinander gehen. Für Ludwig Wittgenstein steht immerhin fest, dass „die Fragen, die wir diskutieren, dieselben Fragen sind, die Platon diskutierte”[1], und für den Philosophen und Mathematiker Alfred North Whitehead (1861-1947) ist es sogar „die sicherste allgemeine Charakterisierung der philosophischen Tradition Europas […], dass sie aus einer Reihe von Fußnoten zu Platon besteht”[2].
Herbert Schnädelbach geht sogar noch weiter. Er bemerkt zu dem wohl berühmtesten Lehrstück der Platonischen Philosophie, dem sogenannten Höhlengleichnis: „[M]an könnte die ganze Philosophiegeschichte auch als Geschichte seiner Interpretation schreiben”[3]. Ob diese Vermutung zutreffend ist oder nicht, kann hier natürlich nicht geklärt werden, es besteht allerdings kein Zweifel darüber, dass damit ein Teil der Philosophie Platons benannt ist, der als Einstiegspunkt ihrer Darstellung sehr geeignet ist. Nicht nur, dass das Höhlengleichnis das Zentrum der Politeia darstellt, die oft als Hauptwerk Platons angesehen wird. Darüber hinaus laufen im Höhlengleichnis (gemeinsam mit zwei ergänzenden Gleichnissen, dem Sonnen- und dem Liniengleichnis) alle Stränge der Argumentation Platons zusammen, sodass es ratsam erscheint, sich sein umfangreiches Denken von dort aus zu erschließen. Zumal die Hauptrolle in der Politeia an einen alten Bekannten vergeben ist.
Das Höhlengleichnis ist, wie fast alle Schriften Platons[4]!, in Dialogform verfasst. Als Erzähler und souveräne Hauptfigur tritt Sokrates auf, auch dies ein gewohntes Bild in Platons Werken, von dem es allerdings einige bemerkenswerte Ausnahmen gibt, auf die wir noch zu sprechen kommen. Als Gesprächspartner fungiert ein gewisser Glaukon, der sich allerdings weitgehend auf die Rolle des Stichwortgebers beschränkt und nur selten Zwischenfragen stellt – wohl die, die Platon an der jeweiligen Stelle von seinen Lesern erwartete[5]!. Diesem Glaukon präsentiert Sokrates nun die folgende fiktive Situation:
Stelle dir […] Menschen vor in einer höhlenartigen Wohnung unter der Erde, die einen nach dem Lichte zu geöffneten und längs der ganzen Höhle hingehenden Eingang habe, Menschen, die von Jugend auf an Schenkeln und Hälsen in Fesseln eingeschmiedet sind, so dass sie dort unbeweglich sitzen bleiben und nur vorwärts schauen, aber links und rechts die Köpfe wegen der Fesselung nicht umzudrehen vermögen; das Licht für sie scheine von oben und von der Ferne von einem Feuer hinter ihnen; zwischen dem Feuer und den Gefesselten sei oben ein Querweg; längs diesem denke dir eine kleine Mauer erbaut, wie sie die Gaukler vor dem Publikum haben, über die sie ihre Wunder zeigen.[6]
Der Vergleich am Schluss ist nicht zufällig gewählt. Denn Sokrates fährt fort:
So stelle dir nun weiter vor, längs dieser Mauer trügen Leute allerhand über diese hinausragende Gerätschaften, auch Menschenstatuen und Bilder von anderen lebenden Wesen aus Holz, Stein und allerlei sonstigem Stoffe, während, wie natürlich, einige der Vorübertragenden ihre Stimme hören lassen, andere schweigen.[7]
Das Feuer am Eingang der Höhle erfasst die Gegenstände, die über die Mauer ragen und wirft ihre Schatten über die Gefangenen hinweg an die Wand der Höhle, die sie gezwungenermaßen anschauen. Anders gesagt: Die gefesselten Menschen sehen immer nur die Schatten der Dinge und nicht die Dinge selbst. Da sie aber nie etwas anderen kennen gelernt haben als die Situation in der Höhle, würden sie „nichts für wahr gelten lassen als die Schatten jener Gebilde”[8]. Sie verwechseln die Schatten mit den echten Dingen, wobei zu dieser Täuschung beiträgt, dass die Gespräche der Personen hinter der Mauer (die die Gegenstände dort vorbeitragen) von der Wand vor den Gefangenen widerhallen, sodass die Schatten zu sprechen scheinen.
Bis hierhin scheint Platon zunächst auf eine metaphorische Art nur eine – allerdings wichtige – Unterscheidung zu wiederholen, die schon für seinen Lehrer von großer Bedeutung war: die metastufige Differenz von echtem und Scheinwissen[9]!, also des Unterschieds zwischen den echten Dingen hinter der Mauer einerseits und den von diesen geworfenen Schatten andererseits. Diese Differenz ist auch tatsächlich wichtig für Platon, sogar so wichtig, dass er dafür zwei Begriffe einführt: die wahre Erkenntnis, episteme[10]!, steht dabei der bloßen Meinung, doxa[11]!, gegenüber. (Was allerdings in diesem Zusammenhang gerne übersehen wird, ist die Tatsache, dass die hinter der Mauer vorbeigetragenen Gegenstände echte Dinge relativ zu ihren Schatten an der Wand sind. Platon lässt jedoch keinen Zweifel daran, dass es sich um Duplikate – also etwa Statuen – handelt, denen relativ zu den Dingen außerhalb der Höhle selbst nur eingeschränkt Echtheit zugeschrieben werden kann. In welcher Form, werden wir noch sehen.)
Allerdings macht Platon auch die Frage der Quelle der Erkenntnis bzw. ihres Scheins zum Thema. In diesem Zusammenhang kommt nun der Tatsache, dass die gefesselten Höhlenbewohner sich mit (und von) ihren Sinnen täuschen lassen, eine entscheidende Bedeutung zu. Denn Platon lässt keinen Zweifel daran, dass die Situation in der Höhle natürlich nicht wörtlich, wohl aber als Metapher der menschlichen Weltbegegnung insgesamt zu verstehen ist. Den Hinweis durch Glaukon: „Ein wunderliches Gleichnis, […] und wunderliche Gefangene!”[12] beantwortet Sokrates nämlich so: „Leibhaftige Ebenbilder von uns!”[13].
Da die Situation der Gefangenen also zumindest prinzipiell der conditio humana insgesamt entspricht, stellt das Höhlengleichnis eine erkenntnistheoretische Stellungnahme Platons dar. – Kurz gesagt: Unsere Sinne täuschen uns, der Mensch kann sich bei seinem Weltverhältnis der Wahrheit auf diesem Weg somit nicht nähern. Diese Ansicht über die menschliche Erkenntnis ist unter der Bezeichnung Rationalismus äußerst wichtig geworden, seine Vertreter reichen von Gottfried Wilhelm Leibniz (1646‐1716) über René Descartes und viele andere bis zu den heutigen sogenannten Konstruktivisten. Während Platon diesen Gedanken ausarbeitet und in der Philosophie populär macht, stammt er ursprünglich von einem Denker, von dem wir nicht viel mehr wissen, als dass er zwischen dem Ende des sechsten und dem Anfang des fünften Jahrhunderts v. Chr. gelebt hat: Parmenides.
Platon macht aus dem Einfluss der Gedanken „des Vaters Parmenides”[14]! auf ihn kein Geheimnis, in dem Dialog Parmenides wird ihm sogar gestattet, Platons (von Sokrates vertretene) Ansichten mit einigem Erfolg zu kritisieren. Dabei basiert das Gewicht von Parmenides´ Ansichten auf einem einzigen Werk, das heute nur noch als Fragment erhalten ist: ein Lehrgedicht mit dem Titel Über die Natur. Darin schildert der Autor in einer sehr bildhaften Sprache die Fahrt in einem Pferdewagen Richtung Himmel, wo ihm eine Göttin den Unterschied von echtem und falschem Wissen erklärt[15]!.
Dabei ist zunächst nicht überraschend, dass die Göttin die Sinne – „das blicklose Auge und das dröhnende Gehör”[16] – als Quelle der Wahrheit ausschließt. Letztere ist nämlich unveränderlich und ewig, die sich ständig ändernden Sinneseindrücke können bereits aus diesem Grund nur Täuschungen liefern. Es gibt nach Parmenides kein Entstehen und Vergehen, das wahre Sein ist ewig: „Ohne Ursprung, ohne Aufhören”[17]!.
Die einzige Möglichkeit des Menschen, Erkenntnisse über das Sein zu gewinnen, ist das Denken, „denn dasselbe ist Denken und Sein”[18]. Das heißt aber auch (und auch dieser Gedanke wird über Platon die Philosophie nachhaltig beeinflussen), dass das Denken nicht über das Sein hinausgehen kann. Etwas, das nicht ist, kann auch nicht gedacht werden[19]! – Platons Probleme mit der Kunst im Allgemeinen und den Dichtern im Besonderen[20]! finden sich hier ebenso bereits vorgezeichnet wie die Jahrtausende lange Schwierigkeit der Wissenschaft, Sprache und Theorien als Instrumente anzuerkennen, die die Welt nicht abbilden oder nacherzählen, sondern gezielt verändern sollen.
Dass sich der Einfluss, den Parmenides mit seinem Lehrgedicht auf Platon gehabt hat, nicht nur auf diesen inhaltlichen Aspekt beschränkt, wird besonders deutlich, wenn man den weiteren Verlauf des Höhlengleichnisses betrachtet. Wie Sokrates dort erläutert, wird einer der Gefangenen von seinen Fesseln gelöst und genötigt, in der Höhle umher zu gehen. Man erklärt ihm die Zusammenhänge, zeigt ihm das Feuer (an das sich seine Augen erst langsam gewöhnen müssen) und sagt ihm, dass er damit nun „dem wahren Sein schon näher sei und sich zu schon wirklicheren [!] Gegenständen gewandt habe”[21], während die Schattenbilder nur Täuschungen gewesen seien. Dieser völlig verwirrte Mensch wird dann auch noch aus der Höhle hinausgeführt und lernt mit der Sonne und den durch sie beschienenen Gegenständen nun endgültig das wahre Sein sowie die wirklichen Gegenstände kennen – dass Platon den Ausgang aus der Höhle und die Hinführung zum Licht der Sonne ausdrücklich als ein „Hinaufziehen”[22] bezeichnet, ist dabei eine klare Anspielung auf die Himmelfahrt im Lehrgedicht von Parmenides[23]!.
Mit diesem kurzen Szenario ist der Kern der Platonischen Philosophie dargestellt, auch wenn das Höhlengleichnis selbst an dieser Stelle noch nicht vorbei ist. Denn Platon kann es sich nicht verkneifen, die Frage zu stellen, was passieren würden, wenn dieser der Wahrheit nun kundige Mensch „wieder hinunter käme”[24] und seinen ehemaligen Mitgefangenen in der Höhle von seinen Erkenntnissen berichten würde. Dass sich die in der Dunkelheit Zurückgebliebenen gegen die Wahrheit wehren und den Wissenden wegen dessen Versuch, sie auch der Erkenntnis zuzuführen, gar umbringen („würden sie ihn nicht ermorden, wenn sie ihn in die Hände bekommen […] könnten?”[25]) ist nicht schwer als deutliche und kritische Anspielung auf das Schicksal seines Lehrers Sokrates zu verstehen.
Der eigentliche philosophische Gehalt des Höhlengleichnisses beginnt aber bei der bereits oben erläuterten erkenntnistheoretischen Zurückweisung des sinnlichen Weltzugangs: Die Sinne, so Platon in Übereinstimmung mit Parmenides, täuschen den Menschen und sind tatsächlich nur Schatten der wahren Dinge[26]!. Sie suggerieren Veränderungen, die es in Wahrheit gar nicht geben kann, denn die Wahrheit ist ewig und immer gleich.
Das Organ des menschlichen Weltbezugs, das geeignet ist, die Wahrheit zu erfassen und das ebenfalls bereits bei Parmenides in den Mittelpunkt des Interesses gerückt wird, ist demgegenüber das Denken.
Eine Präzisierung dieser erkenntnistheoretischen Zusammenhänge legt Platon in einem zweiten Gleichnis am Ende des sechsten Buches der Politeia vor, dem Liniengleichnis. Dabei steht die Linie stellvertretend für das menschliche Weltverhältnis und die dabei möglichen Zugangsformen. Auf der obersten Ebene, so erläutert Sokrates, ist die Linie in zwei Teile untergliedert, die der sinnlichen und denkenden Form des Weltbezugs entsprechen: Sichtbares und Denkbares.
Der Rolle der bereits im Höhlengleichnis zur Sprache gekommenen Sonne widmet Platon zunächst ein eigenes Gleichnis, das Sonnengleichnis. Der aus der Höhle hinauf ans Tageslicht gebrachte Mensch sieht dort Dinge, die von der Sonne bestrahlt werden, anders gesagt: Er sieht die wahren Dinge dank der Sonne. Sie selbst gehört nicht zu diesen Dingen, ermöglicht aber erst deren Wahrnehmung. Um einen erst viel später von Kant eingeführten Ausdruck zu benutzen: Die Sonne ist die Bedingung der Möglichkeit, also die notwendige Bedingung des Sehens der wahren Dinge.
Das scheint nun angesichts des im Höhlengleichnis zu den Sinnen Gesagten sowie der im Liniengleichnis erläuterten Aufteilung in Formen menschlicher Weltverhältnisse in das Sichtbare und Denkbare zu einem Widerspruch zu führen. Denn wenn die Sinne den Menschen immer über die wahren Dinge täuschen, wie kann dann ausgerechnet die Sonne für Erkenntnisse sorgen?
Licht ins Dunkel bringt in diesem Fall die Einsicht, dass wir auch heute noch in vielen Sprachen über das Wissen und die Erkenntnis metaphorisch reden (etwa, wenn uns ein ebensolches Licht aufgeht), wir benutzen also Ausdrücke, die dem Feld der Sinnlichkeit entnommen sind, beziehen uns dabei aber auf Geistiges. Und genau so geht Platon vor, wenn er die Sonne als, wie er schreibt, „Kopie”[27] von etwas Anderem versteht – und dieses Andere ist ebenso dem Bereich des Denkens zuzuordnen wie unser Zugang zu den wahren Dingen, die von der Sonne ‚beleuchtet’ werden. Der aus der Höhle zur Sonne aufgestiegene Mensch vollzieht also erkenntnistheoretisch betrachtet auch den Wechsel von den täuschenden Sinnen zum Denken – und die Frage, die dann noch zu beantworten wäre, ist die, was denn dieses Andere ist, für das die Sonne im Höhlengleichnis steht, und was genau es ermöglicht.
Wir sind damit bei einem Teil der Platonischen Philosophie angekommen, dem zwar ohne Frage einige Bedeutung zukommt, der aber im Lauf der Zeit so ausführlich zum Objekt der Interpretation gemacht wurde, dass man zu Recht zwischen den bei Platon tatsächlich zu findenden Positionen und dem als abgeschlossene Lehre präsentierten Platonismus unterscheidet. Gemeint ist die so genannte Ideenlehre, der seit Aristoteles und seiner Kritik an ihr sowohl an Umfang als auch philosophischer Bedeutung ein weitaus größeres Gewicht beigemessen wird als das bei Platon selbst der Fall ist. Im Übrigen geht Platon in mehreren seiner Werke (vor allem im Parmenides) kritisch auf sein eigenes Denken in Bezug auf die Ideen ein; der erste Kritiker Platons in dieser Hinsicht ist also nicht etwa Aristoteles, sondern Platon selbst[28]!.
Gerade durch die ständige Weiterentwicklung seiner Argumentation macht Platon das Vorhaben, sich bezüglich der Ideen an seinem Werk selbst statt an populären, vereinfachten Versionen der Ideenlehre zu orientieren, aber auch selbst nicht gerade einfach. Das beginnt bereits mit der Frage, wo die Behandlung dieses Themas bei ihm eigentlich einsetzt. Der gängigen Einteilung von Platons Werk in drei Phasen folgend wird seine Auseinandersetzung mit den Ideen oft auf die Mittel‐ und Spätphilosophie beschränkt, was auch besagen soll, dass die (eher Sokratisch verstandene) erste Phase von diesem Thema weitgehend unberührt ist. Nun findet sich der erste Beleg des Ausdrucks idea aber bereits in dem Dialog Euthyphron – und der gehört zu den sogenannten ‚Sokratischen’ Dialogen der ersten Phase. Darüber hinaus gibt es Interpreten, die das, was Platon der Sache nach mit den Ideen sagen möchte, bereits noch früher (nämlich im Protagoras[29]) zu finden glauben. Und je länger die Auseinandersetzung Platons mit den Ideen dauert, desto mehr verschiebt sich die Bedeutung dessen, was mit idea gemeint ist, sodass in späteren Werken wie dem Sophistes oder dem Timaios das, was davor möglicherweise an berechtigter Kritik an Platon hätte vorgetragen werden können, schon nicht mehr aktuell ist.
Wie erwähnt, betreibt Platon diese Kritik in einigen Schriften ohnehin auch selbst. Man wird also letztlich nicht umhinkommen, bei der Darstellung von Platons Philosophieren über die Ideen seinem Denken zu folgen und sich an Inhalten und nicht an der sprachlichen Oberfläche zu orientieren. Wenn man das tut, ergibt sich allerdings ein deutlich anderes Bild als das von der Ideenlehre gewohnte, und das philosophische Profil Platons nimmt eine teilweise unerwartete Form an.
Bei dem Versuch, sich dem Platonischen Verständnis der Ideen zu nähern, erweist es sich als ratsam, zwei Fragen zunächst getrennt zu behandeln, die sich thematisch zwar überschneiden, sich in der Diskussion aber beide als eigenständige Gesichtspunkte der Philosophie Platons erwiesen haben. Dabei geht es erstens um die Ideen selbst und die Frage, worum es sich bei ihnen genau handelt und wo sie sich eigentlich befinden, und zweitens um das Verhältnis der Ideen zu den Dingen, die keine Ideen sind – um mit einer solchen Formulierung zunächst einmal alle Möglichkeiten offen zu halten.
Die Beantwortung der ersten Frage kann relativ übergangslos an dem anknüpfen, was bereits im letzten Kapitel im Zusammenhang mit Sokrates zur Sprache gekommen und dort als dessen Position geschildert worden war[30]!. Diese zeigt sich unter anderem in einem Gespräch, das Sokrates mit Euthyphron über die Frömmigkeit führt:
Oder ist nicht das Fromme dasselbe und sich selbst gleich in jedem Handeln und das Unfromme wiederum zwar allem Frommen entgegengesetzt, sich selbst aber gleich, indem alles, was unfromm sein wird, seine Gestalt gemäß der Unfrömmigkeit hat?[31]!
Was bei der Schilderung der Sokratischen Position noch als bloße Frage nach dem Allgemeinen erschien, bekommt jetzt, also im Lichte der parmenideisch-platonischen These von der Unveränderlichkeit des Wahren, eine deutlich andere Färbung. Denn damit werden nun die beiden Themenstränge der Wahrheit und der Ewigkeit mit dem der Idee zusammengeführt. Die Ideen sind also zunächst offensichtlich thematisch so aufgeteilt wie die ‚normalen’ Dinge der Welt (das Fromme, das Unfromme etc.[32]!), im Unterschied zu diesen gibt es von ihnen aber nicht mehrere Vorkommnisse, sondern immer nur eine Einheit, die darüber hinaus stets gleich bleibt.
Durch die Verknüpfung von Wahrheit und Unveränderlichkeit kommt den Ideen also ein höherer ontologischer Status zu als den gewöhnlichen Dingen:
Denn es handelt sich jetzt bei unserer Untersuchung nicht vorzugsweise um das Gleiche, sondern ebenso um das Schöne an sich und um das Gute an sich und um das Gerechte und um das Fromme und […] um alles, dem wir den Stempel des ‚Seins an sich’ aufdrücken […].[33]
Die Frage, was die Ideen sind, ist natürlich von der nach ihrem Ort nicht wirklich zu trennen. Für Sokrates, ob er nun nach dem Allgemeinen oder aber tatsächlich nach den Ideen gefragt haben sollte, scheint die Antwort festzustehen: Das Fromme ist in jedem Handeln, die Ideen sind für Sokrates zunächst lebensweltimmanent[34]! – sie befinden sich also in der gleichen Sphäre wie ihre gewöhnlichen Pendants.
Soweit jedenfalls das bekannte Bild vom an der Praxis orientierten und lebensnahen Sokrates. Es gibt allerdings zu den Ideen – wenn man im Zusammenhang mit ihm davon sprechen möchte – aus der Sicht von Sokrates noch etwas mehr zu sagen, was vor allem ihren Ort betrifft. Denn bereits in der Apologie bringt er das menschliche Wissen sehr eng mit der techné, also dem Gedanken des Herstellens von etwas in Verbindung. Und in diesem Zusammenhang kann nun von einer Sphärengleichheit von den Ideen und den gewöhnlichen Gegenständen nicht mehr gesprochen werden. Denn für Sokrates ist das Herstellen – wenn es nicht „planlos und ziellos”[35] vor sich gehen soll – immer an eine Idee gebunden[36]!, die der Hersteller vor der eigentlichen Herstellung erfasst.
Diese Tatsache mindert weder die Orientierung an der Praxis durch Sokrates (denn die Ideen sind ja immer noch handlungsleitend) noch den Status der Ideen als wahres Sein (schließlich bleiben sie das, was in allen Handlungen gleich ist und einen wiederholten Handlungsvollzug ermöglicht). Es bedeutet aber, dass Ideen und Handlungen nicht mehr in der selben Sphäre zu verorten sind, denn die vor einer Handlung erfasste Idee und die Handlung selbst fallen nicht in einem Punkt zusammen, sondern sind getrennt.
Allerdings will Sokrates, wie gesagt, mit dieser Trennung kein von der Lebenswelt isoliertes akademisches Wissen etablieren, man hat die Ideen im Zusammenhang mit ihm daher auch als Handlungswissen bezeichnet[37]!. – Dabei ist der Handlungsbegriff bei Sokrates so weit gefasst, dass er in seine Argumentation sowohl handwerkliche als auch verbale Aktionen einbetten kann, wie das folgende Zitat zeigt:
Sag, der gute Mann, das heißt der, der auf das Beste hin redet, wird doch nicht planlos und ziellos sagen, was er sagt, sondern indem er hinschaut auf etwas, wie auch alle anderen [!] Handwerker auf ihr Werk hinschauen? Keiner von ihnen verwirklicht etwas, indem er planlos und ziellos dieses und jenes aufsammelt, sondern damit das, was er verwirklicht, durch ihn eine bestimmte Gestalt habe.[38]
Und diese Gestalt ist eben die idea, auf die er bereits vor der Handlung ‚hingeschaut’ hat. Die Wortwahl macht auch darauf aufmerksam, dass jeder erkenntnistheoretische Diskurs in der griechischen Antike insofern unter von den heutigen sehr verschiedenen Vorzeichen stattfand, als das Denken als menschlicher Weltzugang noch lange nicht so etabliert und begrifflich ausgestattet war wie in der Gegenwart. Denn obwohl die Orientierung an der Idee geistiger Natur ist, ist das Wort, das den Zugriff auf sie beschreibt, der Sinnlichkeit entnommen: hinschauen[39]!.
Für Sokrates existieren also vor und unabhängig von konkreten Handlungen Ideen, die den Menschen hinsichtlich seiner jeweiligen Handlung leiten können – eine andere Funktion haben sie nicht. Dennoch ist damit, was den Ort der Ideen angeht, eine oft Platon zugeschriebene Ansicht etabliert: dass nämlich Ideen und Nicht‐Ideen in zwei getrennten Sphären existieren. Für diese auch als Zwei‐Welten‐Lehre bezeichnete Ansicht ist später – u.a. von Aristoteles – ausdrücklich Platon und nicht Sokrates kritisiert worden[40]!, was wohl bereits aufgrund der Tatsache zurückgewiesen werden muss, dass Platon den Gedanken einer solchen Sphären-Trennung im Parmenides ablehnt – ihn aber dort interessanterweise ausdrücklich von Sokrates vortragen lässt.
Was im Parmenides allerdings auf Platon zurückgeht, ist der Gedanke, dass die Ideen nicht nur auf menschliche Handlungen zu beschränken sind, sondern prinzipiell jedem Ding eine Idee entspricht[41]. Damit ist in Bezug auf die Bedeutung dieses Themas eine massive Erweiterung verbunden, die nicht mehr nur das Feld des praktischen Handelns in der Lebenswelt, sondern potentiell auch Bereiche wie die Ontologie, eher abstrakte Erörterungen zur Moral sowie die Wissenschaft abdeckt. Darüber hinaus hatte Platon bereits im Symposion klargestellt, dass für ihn die Ideen nicht nur den Status bloßer Begriffe haben, sondern tatsächlich selbständig (und vor allem unabhängig von ihrem erkannt Werden durch den Menschen) existieren[42]!.
Wie seine Kritiker in der Folgezeit immer wieder angemerkt haben, stellen sich Platon mit diesen beiden Denkelementen, also der Universalität der Ideen und ihrer Realität, diverse Probleme in den Weg, die er ihrer Ansicht nach nicht gänzlich aus der Welt schaffen kann: Ganz abgesehen von der gewöhnungsbedürftigen Vorstellung einer idealen Entsprechung von Krankheiten und anderen negativen Dingen ist – gerade angesichts von Platons an der Welt geäußerten Kritik hinsichtlich ihrer Abweichung von den Ideen – unklar, wie sich die Zuordnung beider Bereiche vollziehen soll. Ist zum Beispiel ein verfallenes Haus eine schlechte Manifestation der Idee des Hauses – oder aber umgekehrt eine perfekte Manifestation der Idee eines verfallenen Hauses? Platon selbst wird solche Fragen in seinen späteren Dialogen aufgreifen, nach Meinung vieler seiner Interpreten aber nicht wirklich befriedigend beantworten können.
Platons eigene Ansichten zum Ort der Ideen lassen sich besser erläutern, wenn wir uns nun der zweiten Frage (der nach dem Verhältnis der Ideen zu den Dingen, die keine Ideen sind) zuwenden. Davor muss trotz des geistigen Zugangs zu den Ideen, der für Sokrates und Platon außer Frage steht, klargestellt werden, dass diese dennoch nicht in den Gedanken des Menschen, der auf die Ideen zugreift, zu verorten sind. Dieser als Mentalisierung der Ideen bekannt gewordene Vorgang findet – mit dem wichtigen Übergang der Interpretation der Ideen als ‚Gedanken Gottes’ im sogenannten Mittelalter – erst viel später bei Descartes und Locke statt.
Was nun die zweite oben genannte Frage, also die nach dem Verhältnis der Ideen zu den Dingen, die keine Ideen sind, angeht, lassen sich einige Ansätze Platons zu einer Antwort nachweisen. Ganz abgesehen von der beständigen Weiterentwicklung seines Denkens bereitet den Interpreten bis heute vor allem die Tatsache Probleme, dass diese Ansätze Platons nicht nur zumeist unklar formuliert sind, sondern sich darüber hinaus auch noch zum Teil deutlich widersprechen. Allerdings finden sich in diesem thematischen Zusammenhang auch einige der einflussreichsten Gedanken Platons, die bis in die Gegenwart nachwirken.
Bereits im Höhlengleichnis hatte Platon das Verhältnis zwischen den Dingen, die hinter der Mauer entlang getragen werden, und den Schatten, die ja schließlich von ihnen geworfen werden, differenziert dargestellt. Die Schatten sind einerseits nicht die wahren Dinge, sie stehen allerdings mit ihnen in Verbindung und sind nicht völlig von ihnen losgelöst. Platon redet deshalb im Phaidon davon, dass die Ideen ihren Schatten ‚gegenwärtig’ seien und sich mit ihnen ‚in Gemeinschaft’ befänden[43]. Andererseits betont er mit dem Ausdruck chôris (griech. für ‚Trennung’) auch die Wesensfremdheit beider Sphären, der Ideen und der Dinge der Alltagswelt[44]. Dabei übernimmt Platon von Sokrates auch den Gedanken der Einheit der Ideen im Vergleich zur Vielheit der Gegenstände, für die sie jeweils stehen können. Einer Idee entspricht also immer eine (potentiell unendliche) Vielzahl von Dingen, die alle zu ihr im Verhältnis der Schatten zum Original stehen – eine Idee kann folglich unzählige Schatten werfen. Ebenfalls im Phaidon bezeichnet Platon die Ideen daher auch als Ur-Muster der Dinge, die für sie stehen (paradeigmata)[45]!. Noch im Parmenides lässt er den Titelhelden (der in diesem Dialog Platons eigene Ansichten vorträgt) erläutern, wer auf die Ideen ganz verzichten wolle, werde „nichts haben, wohin er seinen Verstand wende”[46].
Darüber hinaus versucht Platon, das Verhältnis der Ideen zu ihren Bezugspunkten in der Alltagswelt durch den Ausdruck der Teilhabe (methexis) zu verdeutlichen[47]. Auch hier ist allerdings nicht ganz klar, wie sich eine solche Beziehung angesichts der doch angeblich ebenfalls bestehenden Getrenntheit beider Sphären und der Tatsache, dass eine Idee dabei an unzähligen Dingen teilhat, vollziehen sollte; Platon ist in vielen Fällen für genau diese Unklarheit grundlegend kritisiert worden.
Das gilt auch für seinen Versuch, die Ideen als kausale Ursache ihrer Entsprechungen zu präsentieren. Schon im Höhlengleichnis sagt Sokrates von der Sonne, „dass sie die Mutter von allen Dingen […] der sichtbaren Welt und von allen […] Anschauungen gewissermaßen die Ursache ist”[48]. Auch wenn, wie sich noch zeigen wird, die Sonne nicht für alle Ideen steht, sondern nur für eine bestimmte, ist damit bereits angedeutet, dass es sich bei den Nicht‐Ideen – zumindest bei der Frage, was und wie sie sind – um Wirkungen der Ideen handelt. Schon im Euthyphron redet Sokrates bei der Diskussion über die Frömmigkeit daher von „jener Gestalt […], durch die alles Fromme fromm ist”[49]. Wie bei der These der Teilhabe der Nicht-Ideen an den Ideen stellt sich aber auch hier die kritische Frage, wie die beiden Sphären der Ideen und der Nicht‐Ideen trotz ihrer Getrenntheit in einem Verhältnis wie dem der Kausalrelation stehen sollen.
Obwohl dieser Ansatz der Verursachung durch die Ideen bei allen Vorbehalten auch seine Anhänger gefunden hat[50]!, ist es ein weiterer Versuch Platons in dieser Hinsicht gewesen, der bis heute den größten Einfluss genießt. Das hat auch damit zu tun, dass Platon in diesem Zusammenhang die Ideen ausdrücklich als Antwort auf eine reale Problemstellung präsentiert und nicht mit einer fiktiven Geschichte gleichsam aus dem Hut zaubert.
Dabei geht es thematisch um den Bereich der Wissenschaft, die in der griechischen Antike seit Euklid zumeist mit der Mathematik bzw. Geometrie gleichgesetzt wurde. Platon kritisiert dabei die Wissenschaftler („die, welche sich mit der Messkunst und den Rechnungen und dergleichen abgeben”[51]) dafür, dass sie die Größen, die sie ihren Argumentationen zugrunde legen („das Gerade und Ungerade und die Gestalten und die drei Arten der Winkel und was dem sonst verwandt ist”[52]), einfach als völlig geklärt annehmen und „keine Rechenschaft weiter darüber weder sich noch anderen geben zu dürfen glauben, als sei dies schon allen deutlich”[53]. In der heutigen Philosophie würde man sagen: Platon bemängelt, dass die Wissenschaftler den Status der Grundbegriffe ihres Objektbereichs nicht klären. Das bedeutet aber letztlich, dass noch nicht einmal klar ist, wovon die betroffenen Wissenschaften eigentlich handeln!
Zumindest mit diesem kritischen Hinweis zeigt sich Platon als treuer Schüler seines Lehrers Sokrates, der ja – wie wir im Vorkapitel gesehen haben – genau an dieser Stelle ansetzte. Auch das von Sokrates (zwar nicht im wissenschaftlichen Rahmen, wohl aber innerhalb der Alltagssprache) immer wieder vollzogene Zurückweisen nur beispielhafter Antworten auf die Frage nach dem Allgemeinen wird von Platon übernommen und in seine Terminologie übersetzt. – So kritisiert er, dass die genannten Wissenschaftler
sich der sinnlich sichtbaren Dinge bedienen und ihre Demonstrationen auf jene beziehen, während doch nicht auf diese als solche […] ihre Gedanken zielen, sondern nur auf das, wovon jene sinnlich sichtbaren Dinge nur Schattenbilder sind […].[54]
Geschickt belässt es Platon damit nicht wie Sokrates bei der destruktiven Kritik am Scheinwissen, sondern präsentiert mit dieser Wendung die Ideen als Antwort auf die Frage nach dem Status der mathematischen und geometrischen Gegenstände. Denn offenbar dienen die sinnlich wahrnehmbaren Hilfskonstruktionen (zum Beispiel an der Tafel) nur der Erörterung, der tatsächliche Bezug dieser Wissenschaften liegt demgegenüber im Bereich „jener Gedankenurbilder, […] die niemand anders schauen kann als mit dem Auge des Geistes”[55]. Die Ideen helfen uns also, die Frage zu beantworten, worauf sich Mathematik und Geometrie eigentlich beziehen, sie etablieren damit den bis heute gültigen Begriff vom theoretischen Gegenstand. Der Vorschlag, die Ideen einfach als Bedeutung von Allgemeinbegriffen zu verstehen, hat hier seinen Ursprung.
Diese auf die Wissenschaft bezogene Argumentation Platons verträgt sich im Übrigen auch gut mit dem Sokratischen Gedanken der Herstellung und Hervorbringung auf der Basis eines vorher ‚geschauten’ Musters. Denn nunmehr können konkret stattfindende Rechnungen oder Zeichnungen als an der jeweils dahinter stehenden Idee orientiert verstanden werden, wobei dabei festzustellende Unterschiede als verschiedene Grade der Realisierung der einen Idee zu interpretieren wären. Dass sich das Rechnen und Zeichnen in diesem Zusammenhang als nach Regeln ablaufend präsentiert, verweist auf einen weiteren wichtigen Aspekt des Verhältnisses von Ideen und Nicht-Ideen.
Dabei fällt zunächst auf, dass Platon auch zwei Varianten dieser Frage behandelt, die zum Einen das Verhältnis der Ideen untereinander und zum Anderen den Bezug der Ideen zu den Menschen betreffen. In diesem Zusammenhang war oben die Rolle der Sonne noch offen geblieben, die den aus der Höhle befreiten Menschen zwar zunächst blendet, dann aber durch ihr Licht das Sehen der Gegenstände außerhalb der Höhle ermöglicht. Man könnte zunächst versucht sein, die Sonne als die Ideen allgemein zu verstehen und die Dinge, die sie bescheint, als die Gegenstände der Alltagswelt. Das läge zwar nahe, ist aber im Höhlengleichnis nicht gemeint. Vielmehr bedeutet der Aufstieg aus der Höhle bereits den Abschied von der täuschenden Welt der Sinne, der Bereich außerhalb der Höhle steht insgesamt für die Sphäre der Ideen bzw. des Denkens. – Was bedeuten dann aber die Sonne und die von ihr beleuchteten Gegenstände?
Nun, der aus der Höhle kommende Mensch hat es eigentlich nicht direkt mit der Sonne zu tun, er hat schließlich genug damit zu kämpfen, dass ihr Licht, das die Gegenstände reflektieren, ihn blendet. Dass dabei unzählige Gegenstände von einer einzigen Sonne beleuchtet werden, deutet bereits an, dass es für Platon auch innerhalb der Ideenwelt eine Struktur bzw. sogar eine Hierarchie gibt. Im Szenario des Höhlengleichnisses ist diese allerdings simpel gestrickt: Es gibt viele gewöhnliche Ideen und es gibt die eine, die höchste Idee – die Idee des Guten. Und eben nur diese Idee wird durch die Sonne dargestellt. Dabei steht die Idee des Guten durchaus in einem ähnlichen Verhältnis zu den anderen Ideen wie diese zu den Gegenständen des Alltags. Das heißt, so, wie die gewöhnlichen Dinge durch die Ideen zu dem werden, was und wie sie sind, lässt sich die Idee des Guten als Ursache der gewöhnlichen Ideen verstehen. Und während sich diese mit der Idee des Guten in einem System der Teilhabe befinden, also genau so mit ihr verknüpft sind wie die Nicht‐Ideen mit ihnen, existiert die Idee des Guten aus sich heraus und ist nicht von anderen Ideen abhängig – sie ist vielmehr „Grund und Anfang des Ganzen”[56]!.
Diese ideen-interne Struktur hat auch Auswirkungen auf das Verhältnis des Menschen zu den Ideen. Denn so wie die Sonne im Gleichnis dem aus der Höhle Entkommenen das Sehen der von ihr beleuchteten Gegenstände ermöglicht, ist der Mensch erst durch die Idee des Guten in der Lage, gedanklich auf die gewöhnlichen Ideen zuzugreifen. In diesem Zusammenhang ist bei Platon allerdings nicht von einem Lernprozess üblicher Art die Rede, vielmehr geht er davon aus, dass die menschliche Seele, bevor sie in den Körper gesperrt wurde, die Ideen bereits ‚geschaut’ hat und sich daran erinnert. Die Idee des Guten ermöglicht dem Menschen also die Wiedererinnerung (anamnesis) an die gewöhnlichen Ideen – darin besteht die Aussage des Sonnengleichnisses[57]!.
Vor diesem Hintergrund der Klärung der inner‐idealen Verhältnisse kann nun auch das oben begonnene Liniengleichnis weiter präzisiert werden. – Dort war ja der menschliche Weltbezug auf der obersten Einteilungsebene der Linie in eine sinnliche und eine denkende Relation segmentiert worden. (Im Übrigen kann es in diesem Zusammenhang im Anschluss an das zu Parmenides Gesagte nicht überraschen, dass Platon den ersten Teil auch mit dem bloßen Meinen, der doxa, in Verbindung bringt, den zweiten Teil hingegen mit dem Wissen, der episteme.) Auf einer zweiten Ebene unterteilt Platon nun zunächst den Bereich der Sinnlichkeit weiter in ein Segment, das Spiegelbildern, Schatten und ähnlichen Täuschungen entspricht, wie sie die Gefangenen im Höhlengleichnis vor sich an der Wand sehen (A), sowie einen zweiten Teil, der mit den sinnlich wahrnehmbaren Dingen korrespondiert, etwa solchen, wie sie in der Höhle hinter der Wand entlang getragen werden (B). – Der Bereich des Denkens zerfällt hingegen in einen Teil, der die mathematischen Gegenände betrifft (C), sowie schließlich die Ideen (D). – Obwohl sich diese Darstellung auch buchstäblich linear verstehen lässt, nämlich als Steigerung von der Täuschung (A) zum Wissen (D), arbeitet Platon den philosophischen Gehalt des Liniengleichnisses auf der Basis einer der wichtigsten mathematischen Methoden seiner Zeit heraus: der Analogie. Demnach verhält sich A zu B genau so wie C zu D. Das bedeutet, die mathematischen Gegenstände sind für Platon in genau dem Sinn Schatten der Ideen, wie es die Schatten in der Höhle im Vergleich zu den Gegenständen hinter der Mauer sind. – Und das Verhältnis von B zu D, also der sinnlich wahrnehmbaren Dinge zu den Ideen, wiederholt sich mit der Relation zwischen den gewöhnlichen Ideen und der Idee des Guten.
Es ist nun alles andere als ein Zufall, dass die höchste aller Ideen für Platon nicht etwa in der Idee des Seins oder einer anderen deskriptiven, also beschreibenden Kategorie besteht, sondern in einer normativen, vorschreibenden – eben der des Guten. Denn der Philosoph Platon versteht sein Denken vor allem als Orientierungshilfe in einer Welt, der seiner Ansicht nach der Verfall droht. Wie sein Lehrer Sokrates hat auch Platon also ein praktisches Anliegen, allerdings in einem wesentlich größeren Umfang[58]!. Er sieht die Ideen (deren Bereich er ja im Unterschied zu Sokrates universalisiert) als eine bzw. die einzige Möglichkeit, der Welt und den in ihr handelnden Menschen Halt zu geben und die Chance zu bieten, sich an einem verbindlichen Maßstab auszurichten.
Zu all den bereits von Platon ins Spiel gebrachten Antworten auf die Frage nach dem Verhältnis von Ideen und gewöhnlichen Gegenständen kommt folglich noch eine letzte hinzu: Die Ideen üben eine normierende Kraft gegenüber der Welt aus.
Platon diskutiert seine Gedanken zu den Ideen daher nicht nur in eher theoretischen Bereichen wie der Wissenschaft, sondern sehr oft auch im Feld des Praktischen, etwa der Moral oder der Politik. An der bereits oben aus dem Phaidon zitierten Stelle wird dieser Übergang deutlich, wenn Platon bemerkt, seine Untersuchung drehe sich nicht nur „um das Gleiche, sondern ebenso um das Schöne an sich und um das Gute an sich und um das Gerechte und um das Fromme”[59].
Deskriptiv verstanden helfen uns die Ideen also, die Dinge der Alltagswelt überhaupt zu identifizieren, zu verstehen (hier kommt auch erneut die Kausalrelation ins Spiel) und im Fall der Wissenschaften ihren Status zu klären. Darüber hinaus liefert uns die Lehre von der anamnesis, also der Widererinnerung, eine Erklärung für unser Wissen. In normativer Hinsicht bieten die Ideen dagegen eine Orientierungshilfe für das menschliche Leben – und das ist bei Platon sowohl individuell, auf den einzelnen Menschen, als auch auf die Gemeinschaft der Polis bezogen, also kollektiv gemeint.
Die Versuche Platons, die Orientierung aller Vorgänge in der Welt (die menschlichen Handlungen eingeschlossen) an den Ideen sicherzustellen, münden bei ihm schließlich in dem Vorschlag, selbst die staatlichen Strukturen an diesem Ziel auszurichten. Das Ergebnis seiner diesbezüglichen Überlegungen fasst Platon in der Politeia zu einer der einflussreichsten politischen Theorien der Philosophiegeschichte zusammen. Obwohl in der Politeia die Gerechtigkeit die thematische Oberfläche besetzt, ist es nichtsdestotrotz der staatlich garantierte Einfluss der Ideen auf das menschliche Leben, der Platons Argumentationsziel ausmacht. Die Gerechtigkeit fungiert dabei als Beurteilungskriterium und Indikator bezüglich bestimmter staatlicher Ordnungen.
Wie sehr der Platonische Idealstaat tatsächlich an diesem praktischen Ziel der Garantie der Orientierung menschlichen Handelns an den Ideen (und nicht etwa an abstrakten Vorstellungen zum Gerechtigkeitsbegriff) ausgerichtet ist, zeigt sich auch daran, dass seine Struktur anthropomorph, also dem Menschen nachgebildet ist[60]!. Wie der Mensch besitzt der Staat drei Teile, dabei entsprechen die menschlichen Seelenteile (Vernunft, Emotion und Begehren) den drei Ständen im Staat (Herrscher, Krieger und Händler). Bezogen auf den einzelnen Menschen und den Staat sind diesen drei Teilen dabei die Tugenden der Weisheit, der Tapferkeit und der Besonnenheit zugeordnet.
Der Staat ist nach Platon dann gerecht bzw. der Mensch glücklich, wenn jeder der drei Teile das macht, was ihm naturgemäß zukommt. Wie insbesondere die neuzeitlichen Interpreten Platons (etwa Karl Raimund Popper in seiner Offenen Gesellschaft) kritisch angemerkt haben, ist damit allerdings soziale Mobilität im Sinne eines Aufgabenwechsels ausgeschlossen. Jeder Mensch gehört nach Platon in eine der drei Gruppen wie in eine Kaste, bereits die (staatlich gelenkte) Erziehung soll auf die frühzeitige Entwicklung der entsprechenden Fähigkeiten hinwirken. Ohne jede Frage sind die von Platon in diesen und anderen Zusammenhängen vorgeschlagenen sehr weit reichenden Machtbefugnisse des Staates mit dem Demokratieverständnis der heutigen Welt nicht zu vereinbaren[61]!.
Platons eigentliches Anliegen im Staat, also die Garantie des Einflusses der Ideen auf die Welt, ist nun für ihn dadurch realisiert, dass der Platz der Herrschenden denjenigen vorbehalten ist, die mit den Ideen bekannt sind, die sie also ‚geschaut’ haben. An einer in diesem Zusammenhang zentralen Stelle lässt er Sokrates daher erklären:
Wenn nicht […] entweder die Philosophen Könige werden in den Staaten oder die jetzt so genannten Könige und Gewalthaber wahrhaft und gründlich philosophieren und also dieses beides zusammenfällt, die Staatsgewalt und die Philosophie, […] eher gibt es keine Erholung von dem Übel für die Staaten, lieber Glaukon, und ich denke auch nicht für das menschliche Geschlecht.[62]
Die Macht im Staat muss also, kurz gesagt, an die Philosophenkönige gehen, weil nur sie den Einfluss der Ideen auf die Welt garantieren können.
So sehr Platon für den Wunsch nach weisen Herrschern angesichts der tatsächlichen Zustände gelobt und/oder als naiv belächelt worden ist – seine eigenen Versuche, seine Staatstheorie in die Praxis umzusetzen, endeten enttäuschend. Mehrfach reiste er nach Syrakus auf Sizilien, um sich mit den dortigen Machthabern Dionysos I. (388 v. Chr.) und dessen Sohn Dionysos II. (366 v. Chr.) über grundlegende politische Reformen im Sinne des Philosophen auseinander zu setzen. Allerdings erwiesen sich beide als dermaßen unbelehrbar, dass Platon frustriert wieder abreiste.
Nicht zuletzt unter dem Eindruck dieser gescheiterten Umsetzungsversuche unterzog Platon seine politische Philosophie einer gründlichen Überarbeitung und fasste sie in den etwa drei Jahre vor seinem Tod geschriebenen Nomoi zusammen. Der Titel besagt im Deutschen ‚Gesetze’ – und damit ist das Programm dieser Staatsphilosophie auch bereits im Kern charakterisiert. Abgesehen davon, dass die Nomoi wesentlich weniger radikal in ihren Forderungen hinsichtlich der staatlichen Strukturen sind, ist die Figur des Philosophenkönigs durch eine Gesetzesherrschaft ersetzt. Das kommt nun zwar unserem modernen Verständnis von Rechtsstaatlichkeit bereits wesentlich näher, ist in der Folge aber vor allem aus philosophischer Sicht von Aristoteles bis Wittgenstein immer wieder kritisiert worden, insofern – so etwa Letzterer – keine Regel ihre eigene Anwendung regeln könne und eine solche nur auf Gesetze begrenzte Herrschaft nicht funktionsfähig wäre. Abgesehen davon, dass die Autorschaft Platons nicht ganz geklärt ist[63]!, hat er sich mit der Kritik an den Nomoi altersbedingt nicht mehr auseinandersetzen können.
Auch in einer weiteren wichtigen Angelegenheit hat Platon seine Ansichten innerhalb seines Alterswerks grundlegend revidiert. So werden sowohl im Sophistes als auch im Timaios die Ideen nicht mehr explizit den sinnlich wahrnehmbaren Gegenständen der Welt gegenübergestellt! Das heißt, dass man – wenn man diese beiden Dialoge in das von Platons Philosophie gezeichnete Bild einfließen lässt[64]! – die bis heute geläufige Abgrenzung von Ideen und sinnlich wahrnehmbaren Dingen nicht ohne Weiteres ihm zuschreiben kann. Genau aus diesem Grund war im Rahmen dieses Kapitels immer nur von einer Entgegensetzung der Ideen zu Dingen, die keine Ideen sind, die Rede, nicht aber von einem Gegensatz ‚Idee – Sinnliches’[65]!.
Nicht zuletzt aufgrund der überragenden Bedeutung der Politeia hat sich die Variante des Platonischen Ideendenkens etabliert, die eine Entgegensetzung der Ideen zu den sinnlich wahrnehmbaren Dingen beinhaltet, denn dort werden die Ideen tatsächlich als nicht-sinnlich bezeichnet. Das ändert aber nichts daran, dass zum Gesamtbild Platons als Philosoph auch seine späteren, sicherlich nicht zuletzt als Reaktion auf die Kritik an seiner Argumentation vorgetragenen Ausführungen gehören – und die zeigen eben in eine ganz andere Richtung als die im Platonismus angenommene.
Eine Konstellation, in der die Ideen möglicherweise selbst sinnlich wahrnehmbar sind, aber deshalb ja noch nicht ihre Funktionen verlieren, rückt Platon nun unvermittelt in die Nähe eines Denkers, den man erstens nicht in einer Einführung in die Philosophie und zweitens schon gar nicht in diesem Kapitel vermutet hätte: Johann Wolfgang Goethe (1749‐1832).
Wenig bekannt ist, dass der Autor solcher Klassiker wie dem Faust oder dem Werther seine bedeutendste Leistung in einem ganz anderen Bereich sah: der Naturforschung. In Johann Peter Eckermanns Gesprächen mit Goethe betont der Meister noch drei Jahre vor seinem Tod, dass die 1810 veröffentlichte Farbenlehre, die Goethes Methodologie der Naturforschung enthält, im Vergleich mit allen seinen poetischen Werken seine wichtigste Veröffentlichung darstelle[66]!. Uns interessiert hier aber weder diese von Goethe geäußerte Selbsteinschätzung, noch die Tatsache, dass seine Farbenlehre von der Physik bis heute weitgehend ignoriert wird. Was dagegen im Zusammenhang mit Platon relevant ist, ist die Art Goethes, Naturforschung zu betreiben und die dabei zum Einsatz gebrachten Methoden.
Das Programm von Goethes Naturforschung lässt sich kurz so zusammenfassen: „Man suche nur nichts hinter den Phänomenen: sie selbst sind die Lehre”[67]. Das heißt, dass der Versuch, die Phänomene der Natur zu erklären, selbst nur wiederum auf sinnlich Wahrnehmbares zurückgreifen darf – und nicht etwa auf abstrakte und unanschauliche mathematische Modelle. In diesem Sinne, so Goethe, „ruhen meine Naturstudien auf der reinen Basis des Erlebten”[68]. Die für ihn einzig akzeptable Methode besteht daher darin, einen „Zusammenhang der Erscheinungen”[69] herzustellen, und im Rahmen einer solchen Konstellation Vorgänge zu erklären. Diese werden letztlich auf ein bestimmtes und für sie verantwortliches Phänomen zurückgeführt, das ihren historischen Ursprung darstellt: das Urphänomen.
Angesichts des zuletzt zu Platon Gesagten kann es nun nicht verwundern, dass in der Philosophie zumindest die These diskutiert wird, dass es sich bei den Ideen, die ja im Spätwerk Platons in die Nähe von sinnlich Wahrnehmbarem gerückt werden, und den Urphänomenen Goethes um enge Verwandte handelt. Die Ansicht, „dass Platons Ideen und Goethes Urphänomen nur verschiedene Ausdrücke für dieselbe Sache sind”[70], ist zwar bis heute eine Minderheitsmeinung geblieben, wer aber ein wirklich umfassendes Bild der Philosophie Platons erhalten möchte, sollte sich auch solchen Überlegungen zumindest nicht prinzipiell verschließen – akzeptiert sind sie damit ja noch nicht. Interessant ist jedenfalls, dass Goethe selbst die Parallele zu Platon zieht: „Meine Farbenlehre ist auch nicht durchaus neu. Platon [hat] vor mir dasselbige gefunden und gesagt”[71].
Gerade der erst in Platons späten Dialogen vollzogene Statuswandel der Ideen macht aber abschließend auch noch einmal deutlich, wie wichtig es im Sinne authentischer Darstellung und intellektueller Redlichkeit ist, der Versuchung zu widerstehen, Platons Denken als glatte, widerspruchslose Einheit zu präsentieren. Dieser immer leicht zu nehmende Ausweg ist im Grunde genommen genau das, wodurch sich der Platonismus definieren lässt – und der hat mit Platon bekanntlich nicht viel zu tun.
Eine philosophisches Werk, so hat der Stuttgarter Philosoph und Heidegger-Schüler Hans-Georg Gadamer einmal bemerkt, kann man am besten „als Antwort von einer Frage her verstehen, auf die es die Antwort ist”[72]. Und in Platons Fall muss man nach dieser Frage auch nicht lange suchen: Wie kann dieser Welt im Verfall geholfen werden – und damit auch den Menschen, die in ihr leben? Seine Antwort besteht in einem Werk, das den Ideen (in welcher Formulierung auch immer) eine zentrale Orientierungs- und Regelungsfunktion zuschreibt – und an die Welt, in der und auf die sie angewandt werden sollen, eine Patientenrolle vergibt, unter der auch ihre Bewohner zu leiden haben. Der Mensch ist als Element einer Welt, mit der etwas ganz grundlegend nicht stimmt, immer auch Teil des Problems, und so wird er im Rahmen von Platons Philosophie auch behandelt. Ihm wird die Fähigkeit zur Einsicht in das Wahre und die sich daraus ergebende Kompetenz, das Richtige zu tun, schlicht abgesprochen; der Mensch bleibt bei Platon völlig unabhängig vom Alter immer ein zu erziehendes Kind. Platon will Strukturen schaffen, die Welt und Mensch in den Griff bekommen – wie das Verhältnis beider dabei aussieht, ist zwar als Gesichtspunkt in seiner Philosophie prominent vorhanden, spielt aber gegenüber dem therapeutischen Gesichtspunkt eine sekundäre Rolle.
Diese Haltung gegenüber der Welt erklärt auch, warum der Universalgelehrte Platon, der mit der Politeia innerhalb einer einzigen Schrift sowohl
die Ontologie (Existenz der Ideen),
die Epistemologie (Erkenntnis der Ideen),
die Pädagogik (Lernen der Ideen durch anamnesis),
die Politische Philosophie (Kenner der Ideen als Herrscher) sowie
die Wissenschaftstheorie (Ideen als geistige Gegenstände)
und darüber hinaus einige weitere Disziplinen abdeckt, der Welt noch nicht einmal soviel Bedeutung beimisst, dass er die in ihr vorhandenen Bereichsgrenzen zum Anlass nehmen würde, auch den intellektuellen Zugriff auf sie im Sinne der Angemessenheit in mehrere Disziplinen zu unterteilen. Für Platon gibt es nur eine Einheitswissenschaft, deren Aufteilung in einen theoretischen und einen praktischen Teil bzw. noch weitergehende Differenzierungen finden sich erst bei Aristoteles.