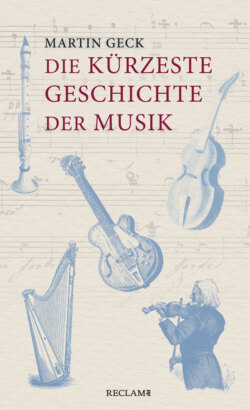Читать книгу Die kürzeste Geschichte der Musik - Martin Geck - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Von der mythischen Macht der Musik
… und den Stimmen der Naturvölker
ОглавлениеKann man sich eine Welt ohne Musik vorstellen? Ohne Gesang, Tanz, Hausmusik, Konzert? Ohne die Nationalhymnen oder die Schlachtrufe der Fußballfans? Ohne Musik in der Diskothek, im Radio, im Fernsehen, im Kino? Ohne Schallplatte, CD, DVD und was es sonst alles gibt?
Manche Menschen dürften Schwierigkeiten haben, nur einen einzigen Tag ohne Musik auszukommen! Was mich betrifft, so würde ich zwar lieber ohne Musik leben als verhungern. Wenn ich aber zu entscheiden hätte, ob die Menschheit – in einer weltweiten Fastenaktion – auf den Verzehr von Fleisch oder auf den Genuss von Bachs, Mozarts und Beethovens Kompositionen verzichten sollte, so würde ich mit Sicherheit das Fleisch vom Speisezettel absetzen und die Musik behalten.
Für Menschen, die in einer Wohlstandsgesellschaft aufgewachsen sind, mag dieses Beispiel reichlich seltsam klingen; ein Angehöriger eines Naturvolks jedoch würde mich sofort verstehen.
Inzwischen gibt es nur noch wenige Naturvölker, also Lebensgemeinschaften, die seit Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden weitab von jeder Zivilisation an ihren traditionellen Riten festhalten und uns auf diese Weise eine Ahnung davon vermitteln, wie früher einmal die ganze Menschheit gelebt haben könnte. Ein Naturvolk, von dem sich zumindest kleine Gruppen bis heute erhalten haben, ist der westafrikanische Stamm der Dan. Dort bekam der deutsche Ethnologe Hans Himmelheber vor ein paar Jahrzehnten zu hören: »Die Musik ist sehr wichtig für uns. Ohne sie würden wir uns einfach hinsetzen und sterben. Denkt doch an die schwere Arbeit: ein Mann, der den Busch für eine Pflanzung niederschlägt; die Frauen, die den Reis stampfen! Deshalb sind Arbeitsgruppen, die von Musikern unterstützt werden, so wichtig. Wir haben keine Maschinen, die uns helfen. Aber dafür haben wir die Musik.«
Von einem anderen afrikanischen Stamm heißt es: »Bei den Woloff ist die Bedeutung des Trommelns für die gemeinschaftliche Arbeit so groß, dass sich die Arbeitsgruppe des Dorfes Njau während einiger Monate zur Untätigkeit verurteilt sah, als ihr bester Trommler infolge Trauer um einen nahen Verwandten ausfiel.« Musik dient hier nicht – wie bei uns – vor allem der Unterhaltung, Ablenkung und Entspannung. Es wäre allerdings auch falsch, in ihr eine Art Aufputschdroge zu sehen. Für die alten Kulturen ist sie vielmehr ein unverzichtbarer Kraftstoff: Während die zivilisierten Menschen ihre Maschinen mit Benzin betreiben, »tanken« die Dan Musik: Sie erst gibt ihnen die Kraft, über den Tag hinauszusehen und die schwere Arbeit des Buschrodens zu tun, die erst Wochen oder Monate später Früchte tragen wird. Allgemein könnte man sagen: Musik lässt sie ihre Existenz als sinnvoll erleben. Sie sind nicht allein mit der Natur, mit der schweren Tätigkeit und mit der bangen Frage, ob und wie es morgen weitergeht; in der Musik haben sie eine Begleiterin. Deren pulsierender Rhythmus macht deutlich, dass wir Menschen nicht in der Unendlichkeit der Zeit versinken: Wir werden von einer Ordnung gehalten – ebenjener Ordnung, die die Musik vorgibt.
Da ist die Vorstellung einsichtig, dass die Menschen die Musik nicht selbst erfunden, sondern von den Göttern als Geschenk erhalten haben – als eine Gabe, die sie in ihrer Schwachheit immer wieder stark macht. »Erst die Götter, dann die Musik, dann die Menschen.« So heißt es jedenfalls in vielen Sagen.
Hazrad Inayat Khan, ein indischer Weiser, überliefert folgende Legende: Während der Erschaffung der Welt konnte man die Seele sehen, wie sie frei herumflog und alles interessiert betrachtete – das Werden des Klangs, Tag und Nacht, Wasser und Erde, Pflanzen und Tiere. Und je reicher die Welt wurde, desto spannender fand die Seele alles, was um sie herum passierte. Am sechsten Tag schaute sie zu, wie der Schöpfer einen Körper aus Lehm formte. Sie erschrak fürchterlich, als sie ihn sagen hörte: »Deine Aufgabe ist es, in diesem Körper zu wohnen!« Die Seele protestierte lauthals: »Niemals! Ich bin frei, und meiner Natur entspricht es, unbeschränkt zu sein; wie soll ich mich da in ein Gefängnis begeben?« Da ließ der Schöpfer die Engel musizieren, und durch deren Musik wurde die Seele von einer nie gekannten Sehnsucht ergriffen. Diese Sehnsucht war es, die sie dazu brachte, den Körper neu zu sehen und schließlich darin zu wohnen.
Die griechische Sage erzählt vom Sänger Orpheus, der mit seinem Gesang wilde Tiere zähmt und sogar seine Gattin Eurydike dem Totenreich vorübergehend entreißen kann. Und in der 29. Rune des finnischen Nationalepos Kalevala zaubert der muntere Held Lemminkäinen durch lange Lieder und schönen Gesang in eine karge Insellandschaft Wälder, Seen, Quellen, Blumen und Geschmeide – die Jungfrauen, die ihn umschwärmen, sind begeistert.
Da ist sie wieder, die mythische Macht der Musik. Der alttestamentliche Prophet Elisa vermag dem dürstenden Volk eine Wasserader aufzutun, indem er von einem Musiker, der ihm vorspielt, seherische Kraft erhält. Sprichwörtlich sind die »Posaunen von Jericho«, von denen das biblische Buch Josua erzählt: Sieben Priester ziehen an sieben Tagen um die belagerte Stadt und blasen auf sieben Widderhörnern; am siebten Tag stürzen Jerichos Stadtmauern ein.
Wo in den alten Mythen und den Bräuchen der Naturvölker von der Macht der Musik die Rede ist, geht es natürlich nicht nur um kriegerische Anlässe. So gab es bei den Ammassalik-Eskimos auf Ostgrönland noch vor hundert Jahren regelmäßig Singwettstreite, die handgreifliche Auseinandersetzungen geradezu überflüssig machen sollten. Das sah so aus: Im Sommer trafen sich die zerstrittenen Parteien bei den gemeinsamen Fangplätzen, um sich in hellen Sommernächten »anzusingen«. Nächtelang dauerten die mit gegenseitigen Anschuldigungen und Schmähungen gespickten »Verhandlungen«, bis eine der beiden Parteien, zermürbt oder beschämt, abzog.
Fast ebenso alt wie der menschliche Gesang sind einfache Musikinstrumente. Auch sie haben ganz unterschiedliche Funktionen. Das Hauptinstrument der Ureinwohner von Ozeanien etwa ist das Schwirrholz – ein dünnes, meist ovales Holzbrettchen, das an einer Schnur herumgewirbelt wird. In seinem Heulen glaubt man die Stimme der Ahnen zu hören. Auf Kriegszügen verleiht das mitgeführte Schwirrholz dem Träger die Kraft und den Mut seiner Vorfahren. Frauen und Kinder dürfen es bei strenger Strafe nicht sehen.
Von den Bambuti-Pygmäen, einem Zwergvolk in Afrika, wird berichtet: »War eine Frau ihrem Manne gegenüber unbotmäßig, zänkisch oder hat sie ihn gar gebissen, dann surrt zur Nachtzeit das Schwirrholz in der Nähe ihrer Hütte. Sie weiß, dass ihr das gilt; schleunigst begibt sie sich zu ihrem Klan und erbittet ein Geschenk, um damit ihre Schuld zu sühnen.«
Die Musikkapellen der nordwestafrikanischen Haussa werden nach einer festen Rangordnung zusammengestellt: Holztrompeten sind einzig und allein dem König vorbehalten. Doppelglocken stehen bedeutenden Vasallen zu; hölzerne Hörner und Oboen dürfen nur zu Ehren von Beamten im Rang eines Distrikthäuptlings erklingen.
Besonders interessante Funktionen haben Sprechtrommeln, wie sie in fast allen Naturvolkkulturen der Nachrichtenübermittlung dienen. Auf Malekula, einer den Neuen Hebriden zugehörigen Insel, hat man für jeden wichtigen Gegenstand und jedes typische Alltagsereignis ein eigenes Trommelmotiv. Sucht ein Mann zum Beispiel sein Nitavu-Schwein, so trommelt er das Signal: »Wo ist mein Nitavu-Schwein?« Hat ein anderer das Schwein gesehen, antwortet er mit dem Signal »sumpsumpndew«, das heißt: »Ich bringe dir dein Schwein zurück!« Oder er teilt ihm den genauen Aufenthaltsort des Tieres mit oder nennt den Klan eines Mannes, von dem er weiß, dass er das Tier gefunden hat.
Solche Trommelmotive sind keineswegs nur rhythmische Abfolgen von Schlägen nach der Art »kurz-lang-lang«, »lang-kurz-kurz«. Vielmehr versucht der Trommler, die Klangschattierungen der menschlichen Stimme nachzuahmen, sein Instrument also wirklich zum »Sprechen« zu bringen. Dazu braucht er im wahrsten Sinne des Wortes Fingerspitzengefühl; und die Empfänger seiner Botschaften müssen feine und geübte Ohren haben.
Die Mazateco-Indianer aus der Provinz Oaxaca in Mexiko verwenden anstatt der Trommel eine Pfeifsprache. Will ein Mazateco die Aufmerksamkeit eines anderen erwecken, pfeift er dessen Namen. Dann stellt er ihm pfeifend eine Frage, warnt ihn vor einem Fremden oder Ähnliches. Sechs-, siebenmal kann der Dialog hin- und hergehen.
In weit größerem Maße als bei uns ist die Musik der Naturvölker körperzentriert. Beim Singen legt man gern eine Hand an Schläfe, Ohr, Wange oder Hals, um den Klang der Stimme zu verändern oder ihr Vibrieren zu unterstützen. Und natürlich betrachtet man den Körper als ein ideales Rhythmusinstrument. Klatschen, mit den Fingern schnipsen, auf die Brust trommeln, mit den Füßen stampfen – all das ist Musik, die jeder schnell erlernen kann und die doch großen Spaß macht.
Freilich gibt es auch bei Naturvölkern musikalische Tätigkeiten, die Spezialisten vorbehalten sind. Das sind zum einen Berufsmusiker, die ihre Instrumente virtuos beherrschen. Zum anderen handelt es sich um Schamanen und Medizinmänner, die bei ihren rituellen Handlungen mit Musik arbeiten. Bei den Blackfoot-Indianern etwa glaubt der Medizinmann, dass seine Macht untrennbar mit ein oder zwei Gesängen verbunden ist. Er spürt, dass er sie durch übernatürliche Vermittlung empfangen hat, deshalb darf sie niemand außer ihm verwenden. Und wenn jemand vom Stamm der Iglulik-Eskimos den Beruf des Schamanen erlernt, so muss er zum Abschluss seiner Ausbildung magische Formeln und Gesänge beherrschen, die Krankheiten heilen, gutes Wetter oder Jagderfolg bewirken.
Bei den südostaustralischen Kurnai fällt einer bestimmten Gruppe von Berufssängern, die man Bunjil-venjin nennt, die Aufgabe zu, Liebeslieder zu komponieren und vorzutragen, wenn ein verliebter junger Mann sie darum bittet. Alle im Dorf können das Lied hören, und eine Freundin teilt dem angeschwärmten Mädchen mit: »Dieses Lied wird zu deinen Ehren gesungen!« Dann fällt es ihm schwer, sich dem Liebeszauber zu entziehen.
Die Maori auf Neuseeland wiederum singen ihre »oriori« – Lehrgedichte mit oftmals kompliziertem Inhalt – bereits Säuglingen vor. Die können natürlich noch nicht verstehen, was man ihnen da über Ereignisse der Stammesgeschichte oder über alte Mythen erzählt. Doch schon früh bekommen sie das Gefühl: »Ich gehöre zu meinem Volk und bin ein Teil seiner Geschichte.«
Übrigens kennt kaum ein Naturvolk ein Wort, das unserem Begriff von Musik entspricht. Zwar unterscheidet man bestimmte Lieder oder Tänze nach den Ritualen, zu denen sie gehören, und man benennt auch diverse Instrumente und die Arten, sie zu spielen. Unbekannt ist hingegen »Musik« als eine abstrakte Größe. Und natürlich gibt es auch keine Notenschrift. Denn einerseits ist das, was wir »Musik« nennen, für die Naturvölker sehr wichtig; andererseits ist diese Musik nur »vorhanden«, wenn sie sich einem bestimmten Gesang, einem speziellen Fest usw. zuordnen lässt.
Wir Heutigen finden es zwar seltsam, wenn wir ein Morgenlied am Abend singen. Aber es hindert uns niemand daran. Und wenn dieses Morgenlied in der Klavierschule steht, üben wir es selbstverständlich auch am Nachmittag. Ein Mazateco-Indianer oder ein Ammassalik-Eskimo fände das verrückt. Er würde sagen: »Dann hat die Musik keine Kraft.« Oder gar: »Das ist verboten. Damit verstoßen wir gegen den Willen der Götter.«
IN PUNCTO TECHNIK hat es unsere Gegenwart weiter gebracht, als sich unsere Vorfahren je hätten träumen lassen. Das gilt auch für die Musik. Unsere Musikinstrumente sind höherentwickelt als diejenigen der Naturvölker, und viele Kompositionen sind komplizierter als ehedem. Überdies können wir uns Musik bequem vom Tonträger vorspielen lassen – zu jeder Stunde und in allen Lebenslagen. Wir haben also Musik im Überfluss; oft ist sie geradezu eine Wegwerfware. Ein paradiesischer Zustand?
Ich denke Folgendes darüber: Ich lehre Musikgeschichte an einer Universität. Da finde ich es praktisch, dass ich zum Beispiel in einer Vorlesung über Beethovens Fünfte Sinfonie an den passenden Stellen Ausschnitte von einer CD abspielen kann. Denn ein Sinfonieorchester könnte ich natürlich nicht engagieren. Überhaupt freue ich mich an dem schönen Klang eines solchen Sinfonieorchesters und noch mehr an den phantastischen Einfällen des Komponisten, die ohne ein modernes Orchester nicht zum Klingen gebracht werden könnten. Doch zugleich habe ich höchsten Respekt vor den Naturvölkern: Während wir weiter in der Technik sind, waren sie näher an der Musik; diese erschien ihnen so notwendig wie die Luft zum Atmen und so direkt wie eine zärtliche Berührung oder ein heftiger Schlag.
Diese hohe Wertschätzung der Musik drücken auch die Mythen aus: »Ohne Musik läuft nichts in der Welt und bei den Menschen«, lautet ihre Botschaft. Und oft erscheint in ihnen Musik als der Atem, mit dem die Götter dem Menschen das Leben einhauchen.
Jeder, der musikalisch ist und Musik liebt, spürt etwas von dem göttlichen Atem in sich, der ihm das Gefühl gibt: »Ich bin nicht umsonst und nicht allein auf der Welt. Ich gehöre zu einem großen Ganzen.« Nennen wir es ruhig Musik!