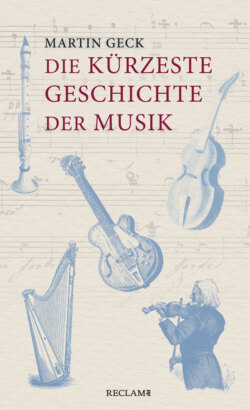Читать книгу Die kürzeste Geschichte der Musik - Martin Geck - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
»Soli deo gloria« oder
»Wes Brot ich ess, des Lied ich sing«?
Von den traditionellen Gattungen der Kirchenmusik
ОглавлениеBeginnen wir mit der Motette. Sie trägt ihren Namen nach dem französischen »mot«, das heißt »Wort«; und das kommt so: Einige der mittelalterlichen Komponisten, die Teile der Liturgie zu einer mehrstimmigen Komposition verarbeiteten, sahen keinen Sinn darin, allen Stimmen denselben Text zu unterlegen. »Wenn es in einem mehrstimmigen Stück schon verschiedene Melodien gibt«, so fanden sie, »sollte es auch verschiedene Texte geben; erst dadurch bekommt jede Stimme ihren eigenen unverwechselbaren Charakter.« Die Bezeichnung »Motette« steht also für die auch textlich eigenständigen Stimmen, welche zum liturgischen »cantus firmus« – meist ein Ausschnitt aus dem gregorianischen Choral – hinzukommen.
Die ersten solcher mehrtextigen Kompositionen sind nach dem heutigen Stand der Forschung um 1200 in der Komponisten- und Sängerschule der Pariser Kathedrale Notre-Dame entstanden – dem bedeutendsten Zentrum hochmittelalterlicher geistlicher Musik. Obwohl die Komponisten auch dort vor allem Kleriker waren, wurde es ihnen zu langweilig, sich ausschließlich mit gottesdienstlichen Texten und Weisen zu beschäftigen. Vielmehr bezogen sie in ihre Stücke das in Paris kursierende weltliche und volkssprachliche Liedgut mit ein. Manchmal schmuggelten sie geradezu schlüpfrige Texte in ihre geistlichen Werke.
Im Laufe der Jahrhunderte gelang es den Kirchenoberen allerdings, die Kirchenmusik von solchen Unreinheiten wieder zu säubern. Zur Zeit ihrer Hoch- und Spätblüte unter Giovanni Pierluigi da Palestrina – um die Mitte des 16. Jahrhunderts – ist es dann mit dem Wildwuchs endgültig vorbei: Nicht nur wegen der Ausgewogenheit des musikalischen Satzes, sondern auch wegen der Einheitlichkeit der liturgischen Texte sind Palestrinas Kompositionen ein Muster an Reinheit und Makellosigkeit.
Wo von »Motette« die Rede ist, meint man freilich nicht nur eine bestimmte Gattung kirchlicher Musik, sondern auch einen bestimmten Kompositionsstil, nämlich die Polyphonie, das heißt »das vielfältig Klingende«. Die zu ihrer Blütezeit meist vierstimmige Motette besteht aus selbständigen, in unterschiedlichen Abständen einsetzenden und pausierenden, oft einander imitierenden Stimmen. In diesem Sinne kann man die Teile der mehrstimmigen Messe – Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus mit Benedictus, Agnus Dei – als Spezialformen der Motette betrachten.
In der Geschichte von Motette und Messe stoßen wir auf eine lange Reihe von Namen großer Komponisten. Aus dem 14. Jahrhundert ragt Guillaume de Machaut hervor, der vor allem an der königlichen Kathedrale zu Reims wirkte, als Dichter und als Komponist gleich angesehen war und neben seinen geistlichen viele weltliche Werke schuf.
Die Musik des 15. Jahrhunderts wurde in besonderem Maße durch Guillaume Du Fay geprägt. Er stammte aus der berühmten Sängerschule der Kathedrale zu Cambrai im heutigen Nordfrankreich, stand in Diensten des päpstlichen Hofs sowie des Hofs von Savoyen und lebte zuletzt in seiner Heimat Cambrai. So prominent er seinerzeit war – von seiner Kunst hätte er sich nicht ernähren können. Er war darauf angewiesen, dass ihm seine weltlichen und kirchlichen Gönner gut dotierte Pfründen verschafften. An der Kathedrale zu Cambrai wirkte er nicht nur als Musiker, vielmehr trug er auch für die Weinvorräte des Domkapitels und für notwendige Kanalarbeiten Sorge.
Ähnliches ist von Josquin des Prez zu berichten. Von den Zeitgenossen ein »Fürst der Musik« genannt, wirkte er als Sänger und Komponist in der päpstlichen Kapelle und danach als Hofkapellmeister in Ferrara, um schließlich im französischen Condé Propst des Domkapitels zu werden. Als solchem unterstanden ihm der Dekan, der Schatzmeister, 25 Kanoniker, 18 Kapläne, 16 Vikare und sechs Chorknaben. Obwohl Josquin des Prez, der 1521 starb, kein Anhänger der Reformation war, wurde er von Martin Luther hoch verehrt. Durch ihn, meinte der Wittenberger Kirchengründer, habe Gott gezeigt, dass man das Evangelium auch durch die Musik predigen könne.
Palestrina, dessen Musik die Jahrhunderte überdauerte, entstammte ebenfalls der päpstlichen Cappella Sistina, musste diese allerdings verlassen, als Papst Paul IV. nach seinem Amtsantritt im Jahr 1555 dort nur noch Kleriker duldete. Jahrzehnte später heiratete er die wohlhabende Pelzhändlerswitwe Virginia Dormoli.
Überblickt man die Geschichte der Polyphonie von ihren Anfängen im 9. bis zu ihrer Hochblüte im 16. Jahrhundert und zugleich die Geschichte des Berufsstandes »Komponist«, so stellt man einen erstaunlichen Aufstieg fest: Binnen weniger Jahrhunderte werden aus unbekannten Mönchen, die in ihren Klosterzellen mit der Mehrstimmigkeit oft nur auf dem Papier experimentieren, kleine Musikfürsten mit hohem Ansehen. Darüber darf man freilich nicht vergessen, dass die kunstvolle Kirchenmusik bis ins 16. Jahrhundert hinein einen Luxus darstellt, den sich nur größere Höfe und reiche Kirchen leisten können. In den Dörfern und kleineren Städten kommt davon so gut wie nichts an.
Auf das Zeitalter der Motette und der Polyphonie folgt ab etwa 1600 dasjenige von Konzert und Generalbass. Die Menschen erleben damals einen gewaltigen stilistischen Umbruch, der nur mit dem Übergang zur »neuen Musik« im 20. Jahrhundert vergleichbar ist. Viele Musikforscher lassen hier die Neuzeit der Musikgeschichte beginnen.
Schauen wir noch einmal zurück: Die Motette und alle andere mehrstimmige Musik wurden in der Regel von einer kleinen Schola aufgeführt, die sich aus Mönchen und Sängerknaben zusammensetzte. Text und Melodie las man gemeinsam aus einem großen, im Altarraum aufgestellten Chorbuch ab. Musikinstrumente wirkten, wenn überhaupt, in untergeordneter Funktion mit.
Die »Schola cantorum«, wie man dieses liturgische Ensemble nannte, sang zwar auch zur Freude und Erbauung der Zuhörer, vorrangig aber zur Ehre Gottes. Es war deshalb nicht von entscheidender Bedeutung, ob die Zuhörer dem komplizierten polyphonen Gewebe der Motette wirklich folgen konnten; wichtig war, dass überhaupt kunstvolle Musik erklang.
Man kann in diesem Zusammenhang an die farbigen Kirchenfenster eines gotischen Domes denken, die manchmal so hoch oben oder an so versteckter Stelle angebracht sind, dass kein Kirchenbesucher die abgebildeten Motive im Detail erkennen kann. Gleichwohl sind diese Fenster mit großer Kunst und Sorgfalt angefertigt und keineswegs nutzlos: Wie der Gesang der Schola dienen sie dem Lob Gottes – nicht anders als jeder schön gewachsene Baum, jedes zweckmäßig geschaffene Tier, das durch seine bloße Existenz Gott lobt.
Während die Sänger der Schola Generation um Generation ihren Dienst verrichten, bricht allmählich eine neue Zeit herein: die Renaissance. Wörtlich übersetzt heißt das »Wiedergeburt«; und wiedergeboren werden soll die vorchristliche Ära der alten Griechen und Römer. In jener Zeit, so meinten die Menschen in der Renaissance, lief nicht alles in bloßer Andacht und allein zur Ehre Gottes ab. Es dominierte vielmehr eine »weltliche« Kunst, in welcher der Mensch sich in seiner eigenen Würde und mit seinen eigenen Fähigkeiten abbildete.
Ein typischer Renaissance-Künstler ist Leonardo da Vinci: Von ihm stammt nicht nur das bekannte Abendmahl, also eine biblische Szene, sondern auch das »weltliche« Porträt der Mona Lisa. Und er hat allerlei interessante Erfindungen gemacht, die zeigen, wie der Mensch durch kluge Planung seine Umwelt beherrschen kann.
Nun ist die Musik eine besonders traditionsverhaftete, geradezu langsame Kunst. Als sie sich um 1600 den Ideen der Renaissance mit Entschiedenheit öffnet, ist in den anderen Künsten schon fast alles vorbei. Doch jetzt dreht die Musik auf: Sie will ebenfalls nicht länger nur dienen, nur den Gottesdienst zieren. Zunehmend entstehen Werke, die für das weltliche Leben gedacht sind und unmittelbar das Gefühl ansprechen sollen. Außerdem versuchen sich die Komponisten mit Erfolg an reiner Instrumentalmusik.
Anstatt wie die Mönche früherer Generationen zu sagen: »In erster Linie machen wir eine komplizierte Kunst zur Ehre Gottes; in zweiter Linie achten wir darauf, dass sie schön klingt«, fordern sie umgekehrt: »Vor allem soll unsere Musik schön klingen und zu Herzen gehen; dass wir damit zugleich Gott ehren, versteht sich dann von selbst!« Den damals entstehenden Stil wird man später »Barock« nennen; hervorgegangen ist er aus dem Wunsch, Renaissance-Ideen nachzuholen.
Wie gesagt, werden jetzt zwei Kategorien wichtig: Konzert und Generalbass. »Konzert« wird meist mit »Wettstreit« übersetzt. Beim Klavierkonzert etwa »misst sich« der Solist mit dem Orchester; um 1600 aber geht es erst einmal um den »Streit« von zwei Vokalchören, und die frühesten Belege dafür stammen aus dem Markusdom von Venedig. Die »moderne« Kirchenmusik wird dort nicht mehr durch die Schola im Altarraum aufgeführt, sondern von zwei auf unterschiedlichen Emporen postierten Chören – manchmal sind es sogar vier Chöre auf vier Emporen. Sie singen sich wechselseitig zu: Der eine Chor beginnt laut, der andere antwortet leiser. Der eine wird von Violinen begleitet, der andere von Posaunen. Und manchmal wird ein Chor ganz durch ein Instrumental-Ensemble ersetzt.
Eine solche Musizierpraxis hat zwar Vorbilder in der Psalmodie; vor allem aber kommt sie aus der Volksmusik und vom geselligen Singen her: Die Gruppe der Frauen singt eine Strophe, die Männer antworten mit einer anderen. Oder: Ein Vorsänger beginnt, die übrigen Chormitglieder folgen. Die Struktur derartiger Musik ist vergleichsweise einfach und »natürlicher« als die einer Motette. Zumal viele prächtige Instrumente hinzukommen, macht das Ganze auf die Hörer einen zauberhaften Eindruck.
Es ist kein Zufall, dass diese konzertante Mehrchörigkeit ihre erste Blüte im Stadtstaat Venedig erlebt hat. Zum einen steht dort wegen des florierenden Überseehandels so viel Geld zur Verfügung wie nirgendwo sonst; man kann daher problemlos eine größere Truppe von Berufsmusikern bezahlen. Zum anderen bedarf es, um auswärtigen Besuchern zu imponieren, repräsentativer Staatsakte.
Man stelle sich vor, die Stadtregierung hätte die zwei japanischen Prinzen, die 1585 mit ihrem Gefolge zu einem offiziellen Besuch eintreffen, in der Staatskirche von San Marco mit einer zwar kunstvollen, aber auch schwer verständlichen Motette begrüßt, vorgetragen von einer kleinen Schola im Altarraum. Das hätte gewiss weniger Eindruck gemacht als das schon fast plakativ einfache, jedoch höchst effektvolle Musizieren eines modernen vokal-instrumentalen Ensembles. Mit vier Chören sei für die japanischen Gäste musiziert worden, schwärmt noch achtzig Jahre später der Chronist Francesco Sansovino: »Eine neue Bühne wurde für die Sänger errichtet. Zu den beiden bereits vorhandenen Orgeln kam eine dritte; und die anderen Instrumente machten die schönste Musik – mit Hilfe der besten Sänger und Musiker, die man in der Gegend finden konnte.«
Allerdings lässt sich die Gattung des geistlichen Konzerts nicht allein aus dem Wechselspiel zwischen vokal-instrumentalen Chören oder zwischen einem Chor und einem oder mehreren Solisten erklären. Auch ist es nicht mit dem Hinweis getan, dass eine dem Tanz nahestehende Metrik die Fasslichkeit von Kunstmusik begünstigt. Den Erfolg bringt besonders die neue Dur-Moll-Harmonik. Diese operiert bevorzugt mit der Kadenz, die von den Dreiklängen über der ersten, vierten und fünften Stufe (I – IV – V – I) gebildet wird.
Vor allem die Kadenzharmonik ist es, welche eine Komposition im modernen Sinne »spannend« macht. Zu ihrer klanglichen Umsetzung bedient man sich des Generalbasses, also einer Instrumentengruppe, welche die Komposition mit einer kontinuierlichen Folge von Akkorden »begleitet«. Dafür finden damals harmoniefähige Instrumente wie Orgel, Cembalo und Laute Verwendung; zur Verstärkung des Bassfundaments geht oft ein tiefes Streich- oder Blasinstrument mit.
Die vom »Basso continuo« realisierte Dur-Moll-Harmonik kann man mit einem Koordinatensystem vergleichen, das es dem Hörer erleichtert, in einem Musikstück die Orientierung zu behalten, auch wenn kühne harmonische Gänge über Höhen und durch Tiefen oder gar auf Abwege führen. Nicht zu Unrecht hat man ihre Entdeckung mit derjenigen der Zentralperspektive in der Malerei verglichen.
Im Verlauf des 17. Jahrhunderts verändert die Gattung »geistliches Konzert« ihr Aussehen kontinuierlich. In Deutschland geht man bald zu kleineren, solistischen Besetzungen über – nicht zuletzt im Zeichen des Dreißigjährigen Krieges, der das Musikleben auf eine fast unvorstellbare Weise zum Erliegen bringt. Dennoch sind viele Tausende geistliche Konzerte geschrieben worden – unter anderem von Heinrich Schütz, dem bedeutendsten deutschen Komponisten des 17. Jahrhunderts, und von Dietrich Buxtehude, dem schon erwähnten Lübecker Lehrer Johann Sebastian Bachs.
Um die Wende zum 18. Jahrhundert wird die evangelische Kirchenmusik um eine neue Gattung bereichert: die Kantate. Die Motette des 16. und das geistliche Konzert des 17. Jahrhunderts waren einteilig gewesen und jeweils über nur eine Textsorte – Bibelwort oder Kirchenliedstrophe – komponiert worden. Nun wünscht man sich mehrteilige Werke mit womöglich verschiedenen Textsorten.
Doch wer ist »man«? Zunächst sind es die frommen Gottesdienstbesucher: »Zwar wollen wir«, melden sie sich zu Wort, »auf die alten Bibelsprüche und Kirchenlieder nicht verzichten, aber wir möchten auch neu geschaffene Glaubens- und speziell Jesus-Lieder hören. Um solche Lieder mögen die Herren Komponisten ihre geistlichen Konzerte gefälligst verlängern.«
Das geschieht tatsächlich, ergibt allerdings um die Wende zum 18. Jahrhundert so viel kreatives Durcheinander, dass bald ein Vorschlag von ganz anderer Seite kommt, nämlich von den Vertretern des Adels: »Das ist ja alles schön und gut«, sagen sie ihren Hofdichtern und -komponisten, »doch ihr müsst Ordnung in die Sache bringen und bei der Gelegenheit auch gleich dem modernen Musikgeschmack Rechnung tragen!« Und weil dieser Musikgeschmack von der Oper bestimmt ist, empfehlen sie, eine Kirchenkantate wie eine Oper anzulegen und passende Texte zu dichten, die wie ein Opernlibretto durch den regelmäßigen Wechsel von Rezitativ und Arie gekennzeichnet sind.
Damit sind wiederum die frommen Christen nicht einverstanden, denn die Oper ist für sie weltlicher Tand. Außerdem – wo bleibt da der Chor, wo ist der Platz für Bibelwort und Choral? An den Adelshöfen und in den Städten einigt man sich auf einen Mittelweg, dem auch Johann Sebastian Bach in vielen seiner etwa zweihundert erhaltenen Kirchenkantaten folgt: Der Kern der Kantate wird nach dem Vorbild der Oper als eine Folge von Rezitativen und Arien über moderne Dichtung gestaltet; den Kopf bildet ein Konzertsatz über ein Bibelwort oder ein Kirchenlied; und am Schluss steht ein schlichter vierstimmiger Choral.
ÄHNLICH DER ALLGEMEINEN GESCHICHTE der Menschheit ist die Geschichte der europäischen Kunstmusik ein kompliziertes Wechselspiel zwischen Anpassung und Autopoiese, also Selbsterschaffung.
Das Wort »Anpassung« verweist auf die Einsicht, dass Komponisten ihre Arbeit nicht im luftleeren Raum verrichten, sondern ihrem gesellschaftlichen Umfeld verpflichtet sind. Dieses bestimmt ihre Einfälle und Möglichkeiten, ohne dass sie oder andere darin unbedingt eine Beeinträchtigung sehen müssten. Dass zum Beispiel einem an der Kathedrale zu Reims tätigen Geistlichen des 14. Jahrhunderts nicht die Idee hätte kommen können, eine Oper Carmen zu komponieren und damit die Massen mitzureißen, liegt auf der Hand: Die Entwicklung war nicht so weit. Guillaume de Machaut, an den ich hier denke, tat vielmehr das, was sein Umfeld zuließ: Er schrieb Messen, Motetten und kunstvolle weltliche Lieder für Kenner.
Der Begriff »Autopoiese« beleuchtet die andere Seite der Medaille. Immer wieder gibt es Künstler, die mehr wollen, als im Augenblick möglich erscheint. Künstler, die Visionen haben, zu deren Verwirklichung sie Kämpfe führen und Opfer auf sich nehmen. Zwar kommen auch sie nicht ohne Kompromisse aus; so hat Bach mit dem »Kompromiss Kirchenkantate« leben müssen, ihm jedoch wunderbare Werke abgetrotzt! Da erschafft sich die musikalische Kunst selbst – manchmal geradezu entgegen ihrer Umwelt.
Auch heute kann man als Dirigent, Pianistin, Geiger, Bläser, Musiktherapeutin, Musiklehrer oder Musikkritikerin Dinge tun, welche die »Sache Musik« weiterbringen. Unverändert gibt es neue Perspektiven zu entwickeln – gerade in der Kunst. Solches gilt auch für diese kleine Geschichte der Musik: Die Tatsachen, von denen die Rede ist, könnte man sich oftmals anderswo zusammensuchen. Der Tonfall des Buches ist jedoch unverwechselbar, gehört allein dem Autor. – Und jeder sollte sich fragen: Wo bist du selbst unverwechselbar?