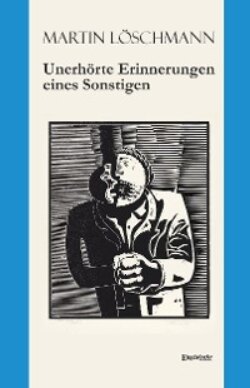Читать книгу Unerhörte Erinnerungen eines Sonstigen - Martin Löschmann - Страница 7
Ohne Schlittschuhe in den Krieg geschlittert
ОглавлениеEs ehrt unsere Zeit, dass sie genügend Mut
aufbringt, Angst vor dem Krieg zu haben.
Albert Camus
„Opa, wie hast du den Zweiten Weltkrieg erlebt?“, hatte mich Julika 2003 in einer E-Mail aus Chiang Mai gefragt. Im Geschichtsunterricht in ihrer internationalen Schule wurde der 2. Weltkrieg behandelt und im Rahmen einer Projektarbeit sollten Zeitzeugen befragt werden. Allein, wie vermittelt man Vierzehn-, Fünfzehnjährigen vieler Herren Länder in Thailand Kriegserlebnisse aus ferner Zeit und fernem Ort? Wie soll sich ein Großstadtkind wie Julika, ein Friedenskind, das Leben in Kriegszeiten in einem kleinen Dorf vorstellen können, in einer Gegend, deren Namen sie nie gehört hat. Ein Gott verlassenes Nest, wie soll sie sich da hineinversetzen?
Wie erzählt ein Großvater seiner Enkelin vom zweiten Weltkrieg, den sie aus dem Geschichtsbuch als einen von vielen Kriegen kennen lernt und der für sie vorab durch die vorgesetzte ZWEI relativiert wird? Jaja, der Ansatz, ein Enkelkind vor Augen über große Ereignisse in unserem Leben zu berichten, ist nicht gerade originär. Wer hat nicht alles versucht, sich über von Nachkommen eingeforderte Erinnerungen zu definieren. Ich denke an Jürgen Kuczynskis Anfang der 80er Jahre veröffentlichten kritischen Dialog mit meinem Urenkel, in der DDR geradezu verschlungen und 1997 mit schwarzen Marginalkennzeichnungen erschienen, die von der DDR-Zensur entfernte Stellen markierten. Ach, da fallen mir sofort andere Namen ein: „Im Leben sammelt sich was an“, sagt in Erwin Strittmatters Laden der Großvater zu seinem Enkel Esau, als der von seinen schriftstellerischen Ambitionen berichtet. Nach unserem Chinaaufenthalt fiel mir Der Kaiser von China von Tilman Rammstedt, Ingeborg-Bachmann-Preisträger, in die Hände: Aus der Höhlenperspektive, nämlich unterm Schreibtisch schlafend, essend, wohnend, beginnt ein Keith, die Hauptfigur in diesem Roman, das Leben seines Großvaters aufzurollen.
Mein Großvater war stets beleidigt, wenn man nicht auf ihn gehört hatte, dabei konnte man nie auf ihn hören, weil er einem immer erst im Nachhinein mitteilte, was man alles hätte anders machen sollen, aber ihn habe ja keiner gefragt, und schau, jetzt bist du nass, und schau, jetzt haben wir uns verfahren, und schau, jetzt bin ich tot.
Ich begann so: Als sich der Krieg ernstlich in mein Leben einmischte, näherte sich mein zehnter Geburtstag. In unserem kleinen Dorf hatte ich lange kaum etwas vom Krieg gespürt. Bedenke, ich war mal gerade vier, als der Krieg ausbrach. Mein erstes „Kriegserlebnis“ hatte ich im ersten oder zweiten Kriegsjahr. Mein Vater und einige Dorfhonoratioren saßen in der Wohnstube, um eine Rede Hitlers aus dem Radio, dem sogenannten Volksempfänger, zu hören. Uns Kinder kümmerte es wenig, wer da sprach und aus was für einem Gerät die Stimme kam, wir spielten vor dem Schlafgehen schnell noch Verstecke. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. 1 – 2 – 3 – ich komme! Zuerst versteckten wir uns in der Küche, darauf im Wohnzimmer. Verstecke ohne Geschrei ist, keine Frage, die halbe Freude, also immer kräftig mit Gebrüll durch die Stube. Mein Vater ermahnte uns leise zu sein. Man wollte kein Wort Hitlers verpassen, schließlich hatte der bis dato ausnahmslos Siege zu verkünden. Wir jedoch waren von unserem Spiel derart gefangen genommen, dass wir uns nicht bremsen konnten. Plötzlich sprang mein Vater auf, griff zum Siebensträhner, der ständig bedrohlich hinter der Anrichte im Wohnzimmer hing. Meinen größeren Schwestern gelang es, nach oben in ihr Zimmer zu flüchten. Ich wollte mich der Reichweite des mir bekannten Instruments gleichfalls entziehen, erreichte die Rettung verheißende Treppe, spürte aber schon den Atem meines Vaters im Nacken. Völlig unkontrolliert verpasste er mir fünf oder sechs Hiebe, während ich mit einem Bein eine Stufe nehmend nach oben stolperte. Gott sei Dank blieb er unten stehen und setzte mir nicht weiter nach, möglicherweise weil ich wie am Spieß schrie oder weil er schnell wieder zur Rede zurück wollte. Oben angelangt, zeigten sich Gisela und Renate, um mich zu trösten, indem sie die gestriemten Stellen bepusteten und Schmerzlinderung versprachen. Zu schreien hörte ich nicht eher auf, bis Irla mir klar machte, dass mein Weinen Vater dermaßen stören könne, dass er gleich noch einmal auftauchen würde.
Bernsdorf verfügte über einen Bahnhof und unsere Felder grenzten ein ganzes Stück lang an die Eisenbahnstrecke. Züge erwarten und beobachten, während ich die Kühe hüten musste, war eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Sie kamen aus einer unbekannten Welt, tauchten aus dem Wald auf, der unsere Felder nach Norden hin abschloss und fuhren in eine andere Welt, die uns jetzt zwar verschlossen, eines Tages aber erreichbar sein würde. Der absolute Höhepunkt war es immer wieder, wenn wir einen flachen Gegenstand auf das Gleis legten und die Veränderungen bestaunten, nachdem der Zug drüber gefahren war. Geldstücke waren geradezu ideal. Da mussten Münzen besorgt werden, und das war kein leichtes Unterfangen. Es konnten Tage vergehen, bis einer von uns einen Groschen aufgetrieben hatte. Wie oft haben wir das Ohr auf die Schienen gedrückt, um festzustellen, ob sich der planmäßige Zug oder gar ein Güterzug näherte, der zeitlich nicht vorauszubestimmen war. Eines Tages stellten wir etwas Neues an den Güterzügen fest. Über mehrere Waggons hinweg war zu lesen: Räder müssen rollen für den Sieg, denn es ist Krieg. Mehrmals haben wir den Satz in Weidenbaumrinde geschnitzt. Das war eine willkommene Abwechslung zur Pfeifenherstellung aus Weidenstöcken.
Meine Eltern wie andere geradeso wurden immer öfter aufgefordert, allerlei Dinge zu spenden. Was man im Krieg so braucht: Wolldecken, Handschuhe, Pulswärmer für die Soldaten, die im unerbittlich harten Winter in Russland kämpften. Kindersachen waren nicht gefragt.
Irgendwann hieß es, man brauche in Zukunft eine Schlachtgenehmigung. Richtig einschränken mussten wir uns deshalb anscheinend nicht, jedenfalls habe ich davon nichts gespürt. Als Bauern waren wir weitgehend Selbstversorger, immerhin besaßen meine Eltern den zweitgrößten Bauernhof und waren die reichsten Bauern im Dorf, da der größte Hof arg verschuldet war. Das bringt Kati aus der letzten Begegnung mit meiner nunmehr über 90 Jahre alten Schwester mit.
Ein französischer Kriegsgefangener tauchte auf unserem Hof auf. Irgendwo im Dorf gab es ein Gefangenenlager, einer der Gefangenen war Marcel, der bei uns schuftete. Als Gegenleistung wurde er verpflegt, billige Arbeitskraft dieser freundliche Mann aus Frankreich. Allzu gern wüsste ich, was aus ihm geworden ist – das schreibend, werde ich von der Erkenntnis überrascht: Der Wunsch nimmt erst beim Schreiben Gestalt an. Was soll’s, ich kenne nicht einmal seinen Familiennamen.
Einmal bin ich mitten in der Nacht von einem furchtbaren Lärm, durchsetzt mit Schreien, aufgewacht. Ich habe mich gefürchtet und zog die Bettdecke über den Kopf. Mir ein Herz fassend, stand ich schließlich auf und folgte den Schreien, öffnete ängstlich die Tür zur Küche, hinter der ich und wie sich zeigte zu recht etwas Furchtbares vermutete. Zwei Männer in Uniform und mein Vater standen um einen Gefangenen herum, einer der Uniformierten hatte einen Schlagstock in der Hand und holte gerade aus, als mein Vater mich in der Tür bemerkte und mich zurück ins Bett scheuchte. Am nächsten Tag gab es für die nächtliche Störung folgende Erklärung: Mehrere Gefangene seien aus dem Lager ausgebrochen, einen davon habe man in einem unserer Kornfelder in der Abenddämmerung gestellt und in die Bürgermeisterei gebracht. Man habe ihn verhört und durch Schläge versucht herauszubekommen, wie die Flucht bewerkstelligt worden sei und wo sich seine mit ihm geflohenen Gefangenen versteckten. Er habe zwar fürchterlich geschrien, als er gepeitscht wurde, herausgepresst haben sie wohl nichts aus ihm. Er wurde in die Kreisstadt überstellt, wie es im Gendarmen-Deutsch hieß.
Vor Marcel schon war ein polnischer Jugendlicher unserem Hof ‚zugeführt‘ worden. Adam wurde er genannt, kaum über 15. Wie er zu uns kam, weiß ich nicht. Mein Vater hätte mir keine Antwort gegeben, „Das verstehst du noch nicht, dafür bist du zu klein.“ Meine Mutter, die ihrem Mann nicht widersprechen wollte, verstrickte sich in vagen Andeutungen: Adam sei elternlos und verwahrlost in Warschau von deutschen Soldaten aufgegriffen und wie andere polnische Jungen und Mädchen in einer deutschen Familie untergebracht worden. Dass man ihn wie einen Knecht behandelte, blieb uns natürlich nicht verborgen. Wir Kinder fühlten uns zu ihm hingezogen, damit meine ich mich und meine Schwester Gisela – deine verstorbene Großtante, Julika. Er war für uns eine Art älterer Bruder, kam aus einer anderen Welt, aus dem Wald, aus dem die Züge heranstampften, drei, vier Jahre jünger als mein Bruder Dietrich, der, nach Notabitur zum Offizier ausgebildet, an die Ostfront kam und 1945 in Russland gefallen ist. Adam spielte in seiner Freizeit oft mit uns: Räuber und Gendarm z.B. Wir bewunderten ihn, wenn er etwas Verbotenes tat und das passierte nicht selten. Er rauchte gern, am liebsten Zigarren. Um uns seine Zuwendung zu erhalten, klauten wir aus der Zigarrenkiste meines Vaters ab und an eine dicke Zigarre für ihn. Heute weiß ich, dass er sich mehr zu Renate, meiner zweitältesten Schwester, hingezogen fühlte, sie war in seinem Alter. Er gab ihr mehrfach zu verstehen und freute sich dabei über die Schockwirkung, die seine Drohgebärde auslöste, er würde sie heiraten, sobald er achtzehn und volljährig wäre. Als der Krieg zu Ende war, hat Renate große Angst ausgestanden, er würde als Sieger sein angedrohtes Versprechen wahrmachen. Du kannst dir bestimmt vorstellen, wie froh Renate über sein spurloses Verschwinden war. Dass Adam ein Recht auf Wiederkehr und Wiedergutmachung hatte, steht auf einem ganz anderen Blatt. Mehr als fünfzig Jahre dauerte es, bis polnischen Zwangsarbeitern von deutscher Seite aus eine Entschädigung für die geleistete Fronarbeit gewährt wurde. Wäre es nach dem Vorschlag von Manfred Gentz Daimler-Chrysler gegangen, hätte Adam keinen Anspruch gehabt; nach diesem Vorschlag sollte nur Geld empfangen, wer „unter Gefängnis ähnlichen Bedingungen“ schuften musste. Und davon konnte auf unserem Hof keine Rede sein, dennoch ist Adam für mich das lebendige Beispiel für die Deportation von Zwangsarbeitern.
Konkrete Gestalt nahm der Krieg für mich an, als die ersten Flüchtlinge aus Gebieten weit weg in unser Dorf kamen, aus Ostpreußen, wo der Krieg bereits hingekommen war. Sie suchten meistens ein Nachtlager, das ihnen durchaus gewährt wurde, erwartungsgemäß auch bei uns im Haus und in der Scheune. Doch sah man sie lieber weiterziehen als zwei Nächte in unserem Dorf verharren. Sie mussten Essen, die Pferde Futter bekommen.
Diese eigentlich nicht gern gesehenen Flüchtlinge berichteten über Gräueltaten der Russen, der russischen Armee: Kindern würden die Ohren abgeschnitten, Erwachsenen habe man die Zunge herausgedreht, als sie nicht reden wollten. Der Name Nemmersdorf, dem ersten von der sowjetischen Armee eroberten Dorf in Ostpreußen, tauchte immer öfter in ihren Berichten auf. Schreckliches musste dort passiert sein. Das verfehlte nicht seine Wirkung auf uns, waren es doch immer wieder Kinder, denen die Russen Grauenvolles angetan hätten.
So Furcht erregend die Schilderungen waren, sie wurden in ihrer Wirkung abgeschwächt, weil sie an dem vorsorglich errichteten Wall der Gewissheit abprallten, dass der Krieg nicht bis zu unserem Dorf kommen würde. Von einer Wunderwaffe war die Rede, die alles richten würde, vom Endsieg. Meine Eltern gaben sich gleicherweise dieser Hoffnung hin. Der Ernst der Lage wurde erst zu dem Zeitpunkt begriffen, als ein russisches Flugzeug ungehindert über unser Dorf flog und die Kreisstadt Bütow bombardierte. Ich weiß nicht, wie viele Male sich Reichsmarschall Hermann Göring hätte Meier nennen müssen: „Wenn auch nur eine Bombe auf Deutschland fällt, will ich Meier heißen.“ Wo blieb die deutsche Abwehr? Bei Bütow stand irgendwo die Flak, sie war weithin zu hören. Schrecken konnte sie die russischen Bomber offensichtlich nicht, die Luftangriffe wiederholten sich. Unser Dorf blieb weitgehend verschont, sieht man von Freitag, dem 2. März 1945, ab. An dem Tag mussten alle Deutschen das Dorf verlassen.
Schon im Februar durfte Irla weg, ging mit ihrem am 11. Januar 1945 geborenen Sohn Gernot auf die Flucht, zusammen mit meiner 82jährigen Oma. Zu dieser Zeit war es noch möglich, mit dem Zug zu reisen, jedenfalls gab es Züge, in die man einsteigen konnte. Spätestens da wurde meinen Eltern allmählich klar, der Krieg würde um uns keinen Bogen machen. Stell dir vor, Julika, wenige Tage nach der Geburt mussten Mutter und Baby das schützende Haus verlassen und sich der Kälte, der Ungewissheit, dem sich anbahnenden Chaos aussetzen. Von allen Seiten strömten Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten westwärts. Irla und Gernot fanden zunächst bei einer Tante in der Nähe von Köslin, in Kavelsberg eine Bleibe. Mit dem Vorrücken der Roten Armee mussten sie auch von dort fliehen und landeten endlich in dem Dorf Hohenaspe in Schleswig-Holstein, nicht weit entfernt von Itzehoe, wo sie heute lebt. Dass ihr Mann nicht wiederkehren würde, erfuhr sie viel später.
Der 2. März also war der unheilvolle Tag. Eckehard Oldenburg, der in Bernsdorf mit uns auf die Flucht ging, wie sich der aufmerksame Leser erinnern wird, schreibt in seinem Buch:
Während wir uns versammelten, und laufend noch weitere Treckwagen, Einheimische wie Flüchtlinge, eintrafen, tauchten erneut russische Tiefflieger auf und beschossen uns mit ihren Bordwaffen. Ausgerechnet den Bürgermeister Löschmann traf ein Granatsplitter genau ins Kreuz, doch seine dicke Winterjoppe verhinderte zu seinem Glück ein tieferes Eindringen. Eine Bombe schlug zudem dicht hinter dem Anwesen Kosins mit dumpfen Getöse in eine moorige Wiese, so dass der gefrorene Morast in hohem Bogen über uns hinwegflog.
Einige Tage nach meinem Geburtstag hatte es geheißen, das Dorf wird geräumt, viel zu spät, wie sich bald herausstellte. Die Deutschen mussten fliehen, die kaschubischen Dorfbewohner und die Fremdarbeiter wie Adam blieben, sie hatten nichts zu befürchten, im Gegenteil, sie konnten damit rechnen, nach Hause zurückzukommen.
Weil die Front bedrohlich näher kam, musste auf einmal schnell gepackt werden. Das eine oder andere war wohl schon vorbereitet, zum Beispiel Pökelfleisch, das ich nicht mochte, in Milchkannen an die Wagen gehängt. Da wir sechs Pferde besaßen, hätten meine Eltern mit drei Wagen voll beladen losziehen können. Aber im Dorf gab es Leute, die weder Pferd noch Wagen besaßen. Sie wurden auf die Bauernhöfe verteilt, die Fuhrwerke hatten. Meine Eltern boten den Familien eine Mitfahrgelegenheit, die auf unserem Hof gearbeitet haben. Stellmacher Wedel hatte Wohnung und die kleine Werkstatt von meinem Vater gemietet. Ihm wurde der dritte Wagen zur Verfügung gestellt.
Wie wenig meine Eltern ernstlich auf die Flucht vorbereitet waren, konnte man daran erkennen, dass wir keine überdachten Wagen hatten, wie man sie aus vielen Filmen kennt, sondern einfache Leiterwagen, wie man sie zur Einbringung der Ernte benutzte. Sie boten nicht den besten Schutz vor Wind und Kälte, obwohl man die warmen Sachen und auch das Futter für die Pferde so verstaute, dass der eisige Wind möglichst wenig Schlupflöcher fand. Gefährlich auf vereisten Straßen zudem, weil die Wagen keine Bremsen hatten. Und damals waren die Winter wirklich kalt. Als wir loszogen, lag tiefer Schnee und in der Nacht herrschten 10 – 20 Minusgrade.
Weil der Packraum arg begrenzt war, hieß es, wir Kinder dürften nur je ein Spielzeug mitnehmen. Ich wählte meine Schlittschuhe aus, ich hatte sie gerade zu Weihnachten bekommen. Bei uns im Dorf liefen fast alle Kinder Schlittschuh. Das konnte man gut und gern drei bis vier Monate lang auf Teichen, Seen und glatten Straßen. Ein Traum war für mich in Erfüllung gegangen. Ich übte jeden Tag und machte gute Fortschritte. Mit der Flucht stand mir eine große Reise bevor. Rundum toll fand ich die Vorstellung, sich an das Pferde-Fuhrwerk zu hängen und über die Straßen zu schlittern, ohne sich allzu sehr anzustrengen. Natürlich war das ein verbotenes Vergnügen. Ich malte mir aus, wie ich mit meinen untergeschnallten Schlittschuhen über die glatten Straßen ins Rettende schlittern würde. Bevor ich die Schlittschuhe mein eigen nennen durfte, war ich mit den Schuhen über die glatten Flächen geschlittert. Der Ausdruck wurde beibehalten. Wir liefen nicht Schlittschuh, sondern wir schlitterten. Was für eine Vorfreude auf die Flucht und wie hab’ ich geweint, als meine Mutter zu guter Letzt entschied, dass ich meine heißgeliebten Schlittschuhe nicht mitnehmen durfte. Sie wurden zusammen mit dem guten Geschirr und anderen Gegenständen nachts in einem Hohlraum unter der Diele versteckt. Meine Mutter tröstete mich, wir kommen bald zurück, dann bekommst du deine Schlittschuhe wieder. Sie sollte nur zum einem Teil recht behalten, wir kamen bald zurück, von meinen Schlittschuhen und all den versteckten Sachen keine Spur.
Ich weiß nicht, ob meine Mutter meine bittere Enttäuschung überhaupt mitbekam. Sie hatte schlechterdings andere Sorgen, die Kühe, Schweine, Hühner, Katzen, der Hund, alles musste zurückgelassen werden. Wer würde sie füttern, die Kühe melken? Kaum anzunehmen, dass die Zurückgebliebenen die Wirtschaft weiterführten. Eine Herz zerreißende Abschiedssituation, zu ertragen allein durch den Glauben meiner Eltern an eine baldige Rückkunft.
Ohne Schlittschuhe hatte die Flucht für mich jeglichen Reiz verloren. Ich weinte wie fast alle auf den Flüchtlingswagen, als es geordnet losging. Wir reihten uns ein in einen riesigen Flüchtlingstreck. Sehr langsam ging es gen Bütow voran, überall auf den Straßen neben den und vor den Wagenkolonnen Militärfahrzeuge, Verwundetentransporte, stundenlanges Stehen, Umleitungen, Übernachtungen zumeist in Scheunen und Pferdeställen, allerdings zwei-, dreimal in Häusern mit gemachten Betten, sonst keine Badewanne, keine Dusche, tagelang ungewaschen durchs Land ziehen, irgendwann etwas essen, was meistens nicht schmeckte, und die Front kam immer bedrohlicher näher. Ein-, zweimal tauchten Flugzeuge auf und beschossen die Wagenkolonne. Wir blieben verschont, gewiss nicht weil wir uns rechtzeitig in den Straßengraben geworfen und in den Schnee eingewühlt hatten. Zufall, purer Zufall, im Ernstfall hätte uns nichts geschützt.
Plötzlich hieß es: Es gibt nur eine Straße, auf der man weiterkommen kann. Die Trecks formierten sich neu, ein letzter Versuch. Zwei Kilometer vorwärts – Richtung Stolp und Lauenburg, und schon ist diese Hoffnung genauso dahin. Die Russen waren irgendwo bei Kolberg nicht weit von unserem Treck durchgebrochen. Die Wehrmacht sperrte das letzte Ausfalltor, um den eigenen Rückzug zu sichern. Unsere sechs Pferde, offensichtlich noch kräftig, wurden von deutschen Soldaten unter Vorweis eines militäramtlichen Papiers gegen den Protest meines Vaters ausgewechselt. Mit geschundenen, mehr als klapprigen Gäulen ging es weiter, d.h. erst einmal wieder zurück. Und die Front unter Führung von Marschall Shukow saß uns fast im Nacken. Allwissende Männer in unserem Treck konnten sicher ausmachen, wer schoss und womit geschossen wurde. Wummern hatte man das Rollen, Grollen und Stampfen des Artilleriefeuers im ersten Weltkrieg genannt. Bis heute, wenn es in der Ferne gewittert, passiert es, dass sich Assoziationen zu den Kriegserlebnissen einstellen.
Endstation am 13. März, es ging nicht mehr weiter, in einer Schule saßen wir fest. Hunderte von Gefangenen, Häftlingen, vermutlich aus einem KZ, wurden durch das Dorf getrieben, schleppen sich dahin, von Stöcken und Gewehrkolben gesteuert.
Urplötzlich schrie jemand: „Die Russen kommen“ oder etwas Ähnliches. Eine unbeschreibliche Stille – Stille aus Angst – breitete sich aus. Russische Panzer tauchten auf, zuerst Spähpanzer, dann die berühmt-berüchtigten T34, der junge Oldenburg will fernerhin Sherman-Panzer entdeckt haben. Sie ratterten vorbei, als wollten sie gar nicht anhalten. Sie mussten angehalten haben, denn auf einmal standen drei leibhaftige Russen vor uns, drei Rotarmisten, wie wir sie später nannten. „Woijna kapuut!“ Der Krieg sei für uns zu Ende, erklärte einer, fraglos der Offizier, in Deutsch. „Damoi, damoi“, wir sollten dorthin zurückkehren, wo wir hergekommen seien, nach Hause. Kein blitzendes Messer zwischen den Zähnen, kein Ohrenabschneiden, kein Zungenherausreißen.
Am nächsten Tage traten wir die Heimkehr an. Obwohl fast vierzehn Tage unterwegs, waren wir nicht weit gekommen, 60, höchstens 80 km. Von der Entfernung her war die Rückkehr kein Problem. Gleichwohl gestaltete sie sich buchstäblich zu einem Wettlauf mit dem Tode. Die von den Russen befreiten ehemaligen Häftlinge kamen zurück und nahmen sich, was sie brauchten. Wer sich ihnen in den Weg stellte wurde geschlagen, mit Stöcken entschlossen beiseite gedrängt. Mein Vater versuchte zwei von unserem Wagen fernzuhalten. Vergebens. Die Menschen trieb der Hunger, sie froren jämmerlich in ihren notdürftig zusammengehaltenen Sträflingskleidern. Was sollten sie tun? Es ging ums Überleben.
Die letzte Nacht vor der Umkehr verbrachten wir in einer Schule: Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer, Alte und Junge. An Schlaf war nicht zu denken, mindestens fünf oder sechsmal wurde die Tür zum Klassenzimmer aufgerissen, bewaffnete Russen trieben uns hoch, mal suchten sie deutsche Soldaten, mal wollten sie Schmuck haben, mal Uhren – Uris, mal beides.
Und nicht nur das. Die nächtlichen Eindringlinge zeigten sich erbarmungslos. Nach einiger Zeit kamen die geschändeten und geschundenen Mädchen und Frauen zurück. Obwohl ich nur ahnte, was ihnen angetan wurde, waren ihr Schreien, ihr Schluchzen, ihre Hilferufe unvergleichlich erschütternd, etwas Furchtbares musste mit ihnen geschehen sein. Die grausamen Ängstigungen, Demütigungen, Erniedrigungen der Nacht hätten sich in die Gesichter eingegraben, hieß es. Meine Schwester Renate, ungefähr so alt wie du jetzt, Julika, wurde gegen Morgen herausgeholt. Eine Frau hatte mit der Vergewaltigung nicht leben können und sich unter dem Dach des Schulgebäudes erhängt.
Im Physikunterricht erinnerte mich die Eselsbrücke URI für die Formel: Spannung x Widerstand = Stromstärke an die erlebte Todesangst. Ein paar Tage nach der Umkehr tauchten wieder einmal zwei wie es schien abgesprengte Russen in einem abgelegenen kleinen Dorf auf und verlangten eben diese Uris und Goldschmuck. Doch weder die Familie, bei der wir untergekommen waren, noch wir hatten etwas zu bieten, leer gebrannt war die Stätte. Da halfen keine Drohgebärden, deshalb griffen sie zum Letzten: Der eine stellte sich an die Tür mit einer Kalaschnikow im Anschlag (vielleicht war es auch ein gewöhnlicher Karabiner), der andere schubste uns alle in die Mitte des Zimmers, vor dem Tisch mussten wir niederknien, zuerst die Erwachsenen, dann die Kinder. Während die Erwachsenen unter Wimmern und Weinen immer wieder aufs Neue erklärten, es gäbe nichts mehr zu holen, weinten und schrien wir Kinder markerschütternd. Kein Erbarmen weit und breit, der neben uns stehende Russe beginnt zu zählen 1, 2 … bricht plötzlich ab, gibt seinem Kumpan ein Zeichen und beide verlassen das Zimmer und waren nie wieder gesehen. Ich habe mein Latein fast vergessen, den Satz aus Aeneis: „Horresco referens“ allerdings nicht – Mich schaudert, davon zu berichten, habe ich behalten. Wir hatten uns eine Situation auszudenken, die zeigen sollte, dass wir Vergil verstanden hatten. Ich musste nichts erfinden.
Ein Fuhrwerk war geblieben. Die zwei Pferde, die den Wagen nach Hause bringen sollten, hielten sich kaum auf den Beinen, völlig abgemagert, klapperdürr. Irgendwie setzte sich der dezimierte Treck dennoch heimwärts in Bewegung. Schon im ersten oder übernächsten Dorf wurde er gestoppt, russische und polnische Soldaten schritten die Wagenkolonne ab: Ob sie Nemetz oder Polski, Deutsche oder Polen waren, wurden alle Männer gefragt, die auf den Fuhrwerken saßen. Ich höre meinen Vater mit fester Stimme sagen: „Deutscher.“ Mit diesem Bekenntnis hatte er sein Todesurteil unterschrieben.
Er musste vom Wagen heruntersteigen und sich zu der Männergruppe unter Bewachung etwas abseits stellen: alles Männer über 50, die bestenfalls dem Volksturm angehören konnten, einer 1944 gegründeten Kampforganisation zur Unterstützung der deutschen Wehrmacht, bestehend aus 16-jährigen bis 60-jährigen Männern. Uns wurde befohlen weiterzufahren. Der Vater blieb da. Keine Verabschiedung. Ich schnappte mir die Leine und versuchte die Pferde in Bewegung zu setzen. Vater wird nachkommen, hieß es. Er kommt wieder, er kommt bestimmt wieder, er muss doch wiederkommen, und kam nicht wieder.
Nach wochenlangen Märschen gen Osten unter unmenschlichen Strapazen ist er vor Schwäche zusammengebrochen und von einer der russischen Begleitpersonen erschossen worden. Das erfuhren wir sehr viel später von einem Heimkehrer. Er sei in den Wald geflohen, den er gut kannte, und auf der Flucht erschossen worden, war eine andere Variante.
Meine Kutscherfreuden währten nicht lange, hatten sie denn zu diesem Zeitpunkt überhaupt gewährt, frage ich mich beim Korrekturlesen. Die Wehrmacht hatte sich die besten Pferde genommen, nunmehr holten Russen und Polen, was übriggeblieben war: Pferd und Wagen. Hab und Gut verringerten sich Stück um Stück. Irgendjemand nahm uns mit auf seinem Wagen, meine Mutter, meine zwei Schwestern und mich.
Wir fuhren an den Kriegsschauplätzen vorbei. Unvorstellbar und nicht zu beschreiben die Szenen, die sich vor unseren Kinderaugen abspielten oder sich abgespielt hatten: Da lagen Tote am Straßenrand, rot gefärbter Schnee markierte sie. Ich wollte nicht hinsehen, konnte es aber nicht vermeiden. Meine Mutter versuchte mehrmals, uns die Augen zuzuhalten. Man hat in Kriegsfilmen Schlimmeres gesehen, in der Verfilmung des Antikriegsromans Im Westen nichts Neues, in Apokalypse Now, in Geh und sieh, trotzdem sind die persönlich erlebten Bilder niemals überdeckt oder gar zugeschüttet worden. Ja, ich bin ein Kriegskind mit all seinen Narben.
Wieder einmal an einem Morgen tauchten russische Soldaten in unserer Unterkunft auf und verlangten, ich und weitere Jungen zwischen 10 und 15 Jahren sollten mitkommen. Meine Mutter versuchte mich festzuhalten, wurde aber bedrohlich zurückgestoßen. Das hatte es bisher nicht gegeben, dass Jungs eingesammelt wurden. Des Rätsels Lösung ließ nicht lange auf sich warten. Wir sollten mithelfen, frei herumlaufende Kühe, Bullen und Ochsen, Schafe und Ziegen in eine eingezäunte Koppel zu treiben. Mit Geländewagen wurden wir in Gruppen von vier bis fünf Treibern, geleitet von je einem Rotarmisten, fünf oder sechs Kilometer von Reckow, südlich von Bütow, abgesetzt und los ging die Jagd. Wir schwärmten nach verschiedenen Seiten aus und bewegten uns, mit Stöcken ausgerüstet, vorsichtig auf die Tiere zu – in der Mehrzahl Kühe. Das Gelände war hügelig, die verharschte Schneedecke, aus der hier und da graue Erdklumpen herausragten, erschwerte das Fortkommen. Mir machte das wenig aus, ich war in meinem Element: Kühe zusammentreiben und hüten hatte ich gelernt.
Mein Eifer und Geschick mussten den dirigierenden Soldaten aufgefallen sein. Jedenfalls wurde ich, nachdem das Tagewerk vollbracht und ich in unserer Unterkunft zur Freude meiner Mutter unversehrt abgeliefert war, kurz danach als einziger der Jungen in den Gemeinschaftsraum geholt und verpflegt wie die Russen auch: mit Brot, Wurst, gebratenen Eiern und Speck. Müde gelaufen und hungrig wie ich war, habe ich kräftig zugelangt. Kritisch wurde es erst, als man mir Wodka reichte und unbedingt erwartete, dass ich ihn hinterkippte. Gleich mehrere Soldaten machten mir vor, wie auch ich diese Aufgabe männlich bewältigen könne. Molodjetz – Prachtkerl. Das Zeug stank erbärmlich, ich wusste, das bringst du nicht runter, und fing an zu weinen. Da tauchte ein Offizier auf und bot dem nicht kindgemäßen Treiben zu meiner Erleichterung ein Ende.
Bevor wir in unser Dorf zurückkehrten, versteckten wir uns im Wald und lebten dort in und rund um eine Wagenburg länger als eine Woche. Ein starker Mann, jünger als mein Vater, war in unserem Treck geblieben. Als die Schicksalsfrage gestellt wurde, reagierte er blitzschnell und gab sich als Taubstummer aus. Er spielte die Rolle dermaßen überzeugend, dass er unbehelligt blieb und sicher nach Hause kam. Im Laufe der Zeit perfektionierte er seinen Auftritt dadurch, dass er den Siegern mit gezielter Taubstummen-Gestik aus seinem Tabakbeutel Tabak anbot. Jedes Mal bin ich vor Bewunderung erstarrt, wenn Herr Berndt und die Gefahrbringer in friedlicher Runde die Friedenspfeife rauchten. Ach ja, das Bild trifft nicht bis ins Letzte zu: erstens rauchte nur er Pfeife, während die Bedränger ihre selbstgedrehten Papirossa qualmten, zweitens war es eher ein Auszeitnehmen, gegründet auf dem grenzüberschreitenden Mitleid mit Behinderten.
Einmal jedoch enttäuschte uns der Überlebens-Künstler, nämlich an jenem Morgen, als verwilderte und wild gewordene Bullen, Ochsen und Kühe auf unsere Wagenburg losstürmten und er sich in der Stunde hoher Gefahr in Sicherheit brachte, ohne an die Frauen und Kinder zu denken, die in den Wagen schliefen oder sich auf das Aufstehen vorbereiteten. Beherzt wehrten die Frauen, die Mütter die aggressiven Tiere ab. Sie schützten ihre Kinder mit Knüppeln, Gerätschaften, die greifbar waren; meine Mutter habe ich kaum jemals wieder derart energisch handeln sehen. Zwei, drei Frauen hatten sich verletzt, wenngleich nicht ernstlich, meine Mutter darunter. Als die Bedrohung weitgehend gebannt war, tauchte unser bewunderter Taubstummer mit allerlei Ausflüchten auf. Er wurde nicht gerügt oder gar beschimpft, wohl ein wenig abschätzig betrachtet. Männer waren rar in diesen Zeiten.
Eine Frau wagte sich schließlich ins Dorf und fand heraus, dass keine unmittelbare Gefahr mehr bestand. Wir kehrten nach Hause zurück.
Haus und Hof waren inzwischen von einer polnischen Familie in Besitz genommen worden. Uns gehörte nichts mehr im Dorf, das nunmehr Ugoszcz hieß. Wir kamen im Nachbarhaus unter und mussten den neuen Besitzern zur Hand gehen, ich als Stalljunge bei dem Polen, der den Hof bewirtschaftete, auf dem wir jetzt wohnten, meine beiden Schwestern als Hausmädchen. Lohn für die Arbeit gab es nicht, genug zu essen und zu trinken schon.
Haus und Hof verloren, die Mutter ohne Mann, die Kinder ohne Vater. Mir wurde der Verlust damals nicht richtig bewusst, in mancher Hinsicht war das Leben für mich in dieser Zeit durchaus schön, reizvoll, spannend, wie man heute gern sagt: keine Schule – eine deutsche Schule gab es nicht mehr, die polnische war uns verschlossen –, mit Pferden unterwegs sein, Pflügen, Dung auf die Felder fahren, mit der Hungerharke das verstreute Heu zusammenrechen, mit dem Sohn des neuen Besitzers unseres Bauernhofes gemeinsam Kühe hüten, vorausgesetzt für ihn war keine Schule. Für das Mähen mit der Sense kam ich noch nicht in Frage. Die Kunst war für Kinder nicht erreichbar: zu schwer, zu gefährlich, selbst für Erwachsene war das alles andere als ein Zuckerschlecken. Sich als Mann beweisen, sich einreihen dürfen in die Schar der Mäher, das wäre es schlechtweg gewesen. Der Gleichschritt und Gleichklang beim Mähen, mein Vater als Taktgeber immer vorneweg. Stand die Mahd an, konnte man das Dengeln der Sensen im ganzen Dorf hören, der Klang ist mir seither im Ohr.
Völlig anders empfand verständlicherweise meine Mutter die für sie fast unerträgliche Situation: Sie konnte unser Schicksal nicht fassen, war im wahrsten Sinne des Wortes am Boden zerstört. Wie oft hat ihr Weinen uns Kinder in der Nacht aufgeweckt. Es brauchte Jahre, bis sie begriff, dass an allem Elend der Krieg schuld war, den Hitler, unterstützt von weiten Teilen des deutschen Volkes, heraufbeschworen hatte.
Nach dem Potsdamer Abkommen war vorgesehen, dass die Deutschen, die in den von Polen in Besitz genommenen Gebieten (bis zur Oder-Neiße-Grenze) lebten, nach Deutschland umgesiedelt werden. Fast drei Jahre hat es gedauert, bis wir die Erlaubnis erhielten, die Heimat zu verlassen. Warum es in unserem Fall bis Ultimo dauerte, ist mir bis heute nicht erklärlich. Waren wir billige Arbeitskräfte für die Polen, die polnischen Behörden mit der Aussiedlung überfordert oder war es purer Zufall? Facharbeiter wurden zurückgehalten, solange es ging, Arbeitsfähige generell, in diese Kategorie gehörten wir wohl eher nicht. Im Westen sprach man von Vertreibung, Zwangsaussiedlung, Abschub, Transfer, im Osten von Umsiedlung. Was wir mitnehmen durften, war äußerst begrenzt, zwei Koffer, zwei, drei Taschen. Auf dem Sammelplatz in Bütow wurde das Gepäck einer scharfen Kontrolle unterzogen. Das war’s. Nun ade, du, mein lieb Heimatland. Mit den beiden Kindern der neuen Besitzer Flissakowski, mit Janucz (12) und Theresa (13), hatten wir uns gut verstanden. Als wir Ende 1947 unser Dorf für immer verließen, gab es ein tränenreiches Abschiednehmen.
Fast vier Tage hat es gedauert, bis wir in Zeitz, 40 Kilometer von Leipzig entfernt, ankamen. Das war keine bequeme Reise, immer 20 bis 25 Personen in einem Viehwaggon. Ich dächte, in der Ecke habe ein Öfchen gestanden, von dem wir Kinder uns fernhalten sollten. Zur Notdurftverrichtung hielt der Zug in bestimmten Abständen an, an Bahnhöfen wurde Tee gereicht, in großen Abständen gab es etwas zu essen. Wie wenig von dieser Reise hängen geblieben ist. Einzig das rollende Geräusch der Schiebetüren, wenn die Waggons geöffnet wurden, die Angst, der Zug könnte sich in Bewegung setzen und ich bleibe zurück, die Scham, in der Notgemeinschaft im Graben oder auf dem freien Feld sich hinhocken zu müssen, um sich vom aufgestauten Druck zu befreien. Am schlimmsten war es, sobald der Zug ohne erkennbaren Grund anhielt und man durch die Sehschlitze nicht orten konnte, wo man war, und der Zug hielt und hielt, unzählige Minuten, Stunden.
In Zeitz wurden wir in einem der großen Säle der Moritzburg untergebracht, nachdem man uns durch eine Entlausungsstation geschleust hatte. Wir lagen mit über 50 Personen in einem ehemaligen Rittersaal. Mehr als acht Wochen mussten wir dort leben, auf dem Fußboden kampieren, zwei Decken standen jedem am Anfang zur Verfügung. Die Verpflegung war zentral geregelt. Zum Sattessen zu wenig, zum Verhungern zu viel. Hunger hatten wir immer.
Das Mittagessen wurde in Kübeln gebracht. Da sie undicht waren, klebten an den Außenseiten, besonders an den Deckeln übergeschwappte Essensreste. 20 bis 30 Jungen warteten darauf, dass die leeren Kübel auf den Hinterhof gestellt wurden. Kaum kam einer, stürzte sich die Horde darauf, um die unappetitlichen Reste abzukratzen und zu verschlingen. Jedes Mal tobte ein unerbittlicher Kampf, denn nur einer konnte jeweils der Gewinner sein. Es gab an keinem Tag genügend Kübel für alle Hungrigen. Als ich Herta Müllers Atemschaukel las, nachdem sie 2009 überraschenderweise den Nobelpreis bekommen hatte, drängte sich mir ihre Beschreibung des chronischen Hungers geradezu auf:
Was kann man sagen über den chronischen Hunger. Kann man sagen, es gibt einen Hunger, der dich krankhungrig macht. Der immer noch hungriger dazukommt, zu dem Hunger, den man schon hat. Der immer neue Hunger, der unersättlich wächst und in den ewig alten, mühsam gezähmten Hunger hineinspringt. Wie läuft man auf der Welt herum, wenn man nichts mehr über sich zu sagen weiß, als dass man Hunger hat.
Am Ende der Moritzburg-Zeit wurde uns ein Zimmer bei einer von der Einquartierung nicht gerade erbauten Familie Urban, Am Eulengrund 10 in Zeitz zugewiesen. Wir bekamen Lebensmittelkarten. Was man uns an Lebensmitteln zugestand, sicherte bedingt das Leben der vierköpfigen Familie. Deshalb waren wir ständig auf der Suche nach Essbarem. Der Schwarzmarkt blieb uns verschlossen, wir hatten nichts anzubieten, was einen sachständigen Tauschwert gehabt hätte. Wir gingen stoppeln, von einem abgeernteten Feld, dem Stoppelfeld, wurden Weizen-, Roggen-, Gerste- oder Haferähren aufgesammelt, die heruntergefallen, übersehen oder in der Boden getrampelt worden waren. Bei abgeernteten Kartoffelfeldern genügte es nicht, die erspähten Erdäpfel aufzulesen, da musste man mit der Hacke blitzschnell nachhelfen, um fündig zu werden.
Sobald ein Feld abgeerntet war, wurde es freigegeben. Zu Hunderten standen die Menschen stundenlang um die Felder und warteten auf den Moment der Freigabe. Aufseher, mit Peitschen unter dem Arm und von bissigen Hunden begleitet, hielten die Masse in Schach. Wagten Kinder sich vorzeitig aufs Feld und das geschah nicht selten, passierte kaum etwas; sie mussten nur sofort Reißaus nehmen, entdeckten die Aufseher die Grenzüberschreitung. Ich war fast immer unter den waghalsigen Kindern, meistens Jungen. Bei Erwachsenen wurde schon mal der Hund losgelassen oder die Peitsche geschwungen.
Einmal war kein Halten mehr, die Massen stürmten von zwei Seiten auf das riesige Roggenfeld bei Osterfeld – mit der Bahn 18 km von Zeitz zu fahren –, bevor das Freigabesignal ertönte. Die noch nicht vom Feld geräumten Garben verhießen volle Rucksäcke. In kürzester Frist war ein Schlägertrupp zur Stelle und jagte die Menge zurück. Diejenigen, die die Puppen, wie die Stiegen in Mitteldeutschland genannt wurden, erreicht und sich vor der Zeit bedient hatten, mussten die Taschen leeren. Zur Strafe wurde das Feld abgesperrt und erst am nächsten Tage freigegeben. Nicht nur einmal kehrte man ohne jegliche Ausbeute zurück. An solchen ertraglosen Abenden konnte es passieren, dass unsere Mutter zerknirscht, ohne etwas zu sagen, todmüde ins Bett fiel.
Man musste schnell, überaus schnell sein, um möglichst viele Ähren zu erwischen. Lange vor dem Sturm auf das jeweilige Feld spähte man guten Ertrag versprechende Stellen aus. Mit beiden Händen gezielt nach links, nach rechts, nach vorn, nach hinten grabschen, alles blitzschnell in die Schürze stopfen, die mit einer großen Tasche versehen, anfangs vor dem Bauch baumelte und nach und nach immer schwerer nach unten zog. Am Ende kam alles in einen Rucksack. Zu Hause wurden die Körner aus den Ähren geschlagen und mit der Kaffeemühle zu Mehl gemahlen. Am 31. März 2010, 17:47 fragt ein Kafka im Kaffee-Netz:
Hat schon mal jemand versucht, mit einer Kaffeemühle Getreide fürs Brotbacken zu mahlen? Funktioniert das halbwegs, oder muss ich dann eine verstopfte Mühle reinigen?
Erst jetzt – 1948 – forderte die Schule ihr Recht. Mehr als 50 Fehler im ersten Diktat machten mich zum krassen Außenseiter der Klasse. Ich schämte mich unendlich, auch wegen der grob gestrickten langen Strümpfe, die keiner mehr trug. Sie waren mithilfe von Strumpfhaltern, heute Strapse genannt, an einem Leibchen festgemacht, welches man zwischen Unterhemd und Hemd trug. Und diese ekligen gelblichen Igelitschuhe, hergestellt aus gesundheitsschädlichem Weich-PVC. Im Sommer schwitzte man furchtbar darin, im Winter fror man erbärmlich. Anfang der fünfziger Jahre wurden sie Gott sei Dank aus dem Verkehr gezogen.
Da ich in die Klasse eingestuft worden war, in die ich vor der Flucht ging, überragte ich alle, geistig schien ich ein Zwerg zu sein. Mein Banknachbar gab mir jedoch eine Chance: „Du stinkst wenigstens nicht.“ Lange hielt meine Drangsal nicht an. Durch den Krieg, den Tod des Vaters und die geschwächte Mutter vollends auf mich gestellt, lernte ich hochmotiviert und holte den Stoff relativ schnell auf, sodass ich innerhalb eines Jahres zwei Klassen überspringen konnte.
In der achten Klasse kam mein Klassenlehrer zu uns nach Hause und schlug meiner Mutter vor, mich auf die Oberschule zu schicken. Sie stimmte zu, obgleich sie lediglich Sozialfürsorge erhielt und es von ihr aus ohne Frage besser gewesen wäre, wenn ich einen Beruf erlernt und schnell Geld verdient hätte. Ich bin ihr unendlich dankbar für ihre Entscheidung, die für sie weiterhin Entsagung bedeutete.
Damit wollte ich mit dem Krieg für mich abschließen. Beim Wiederlesen des Kapitels wird mir eine Leerstelle klar: Das Thema Vergewaltigungen, sowohl in der DDR und als auch in der Sowjetunion tabuisiert, ist nicht allein aus meiner kindlichen Erlebnisperspektive zu erzählen, sie verstärkt womöglich das von westlichen Ideologen einseitig geprägte Bild von den Russen.
Im engsten Familienkreis habe ich gelegentlich angedeutet, dass ich neben meiner Mutter stand, als sie von einem Russen in einem Heuschuppen vergewaltigt wurde, wohin sie mit mir geflüchtet war. Sie wähnte, sich und mich sicher versteckt zu haben.
Hätte ich Julika mit Werner Heiduczek, dem Leipziger Schriftsteller aus Oberschlesien, kommen können? Kaum. Er brach 1977 in seinem wohl bekanntesten Roman Tod am Meer das Tabu, indem er auf die Frage „Habt ihr vergewaltigt?“ den sowjetischen Offizier antworten lässt:
Ob Griechen oder Römer, Osmanen oder Chinesen, Amerikaner oder Russen, schick sie in den Krieg, und es wird Mord geben, Raub, Plünderung und Vergewaltigung. Ich finde es dumm, den Menschen in den Zustand des Tieres zu versetzen und dann über seine Unmoral zu meditieren.
Just diese Stelle veranlasste den damaligen sowjetischen Botschafter in der DDR, Abramowitsch zu intervenieren. Einfach lächerlich, die Spatzen pfiffen es von den Dächern, kein Geringerer als Ilja Ehrenburg hatte es in seinem Tagebuch bestätigt. Gut ein Jahr vor Heiduczek hatte Christa Wolf in ihrem Roman Kindheitsmuster das heikle Thema gewissermaßen gestreift, indem sie von einem jungen russischen Offizier erzählt, den Flüchtlingsfrauen über ein eigens installiertes Alarmsystem regelmäßig gegen zudringliche Rotarmisten zu Hilfe rufen. Heiner Müller gab dem Thema in seinem letzten dramatischen Text Germania 3 Gespenster am toten Mann zudem eine neue Perspektive:
Schlafzimmer mit Doppelbett. Ein russischer Soldat vergewaltigt eine deutsche Frau. Auftritt ein Mann in der gestreiften Uniform des Konzentrationslagers mit dem roten Winkel des politischen Häftlings. Er sieht eine Weile zu, dann erschlägt er den Soldaten.
Hier beginnt die Befreiung, der Frieden mit einem Mord.
Es hat lange gedauert, bis ich die Fragwürdigkeit erkannte, sich gegenseitig die Untaten im Krieg vorzuhalten. Letztendlich dient ein solches Vorrechnen und Aufrechnen dazu, den Krieg zu humanisieren und ihn akzeptierbar zu machen.
Hätte es den Film Anonyma – eine Frau in Berlin zu der Zeit gegeben, als ich Julika eine Version meines Textes nach Thailand schickte, hätte ich ihn ihr empfohlen: Max Färberböck, der mit seinem Erfolgsfilm Aimée & Jaguar das Dritte Reich versucht hatte darzustellen, inszenierte 2008 erneut einen historischen Stoff nach Aufzeichnungen einer anonym gebliebenen Frau und behandelt darin die vielmals beschriebenen Massenvergewaltigungen durch russische Soldaten in Ostberlin am Ende des Zweiten Weltkriegs. Er bricht Stereotype auf und macht nicht den Fehler, die Russen durchweg als grobschlächtige Bestien zu zeigen.